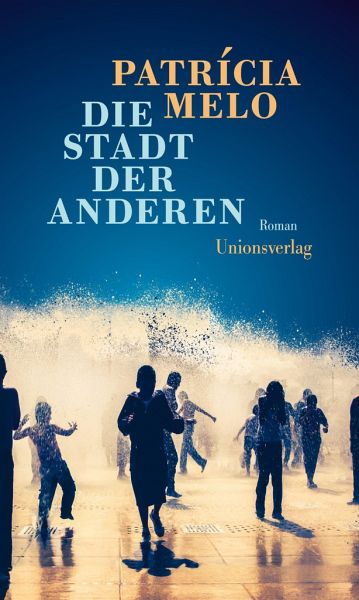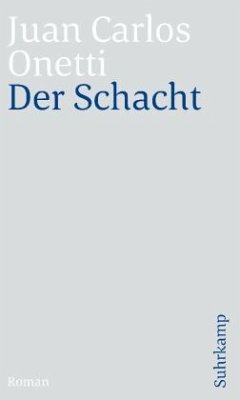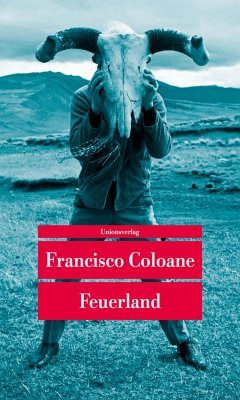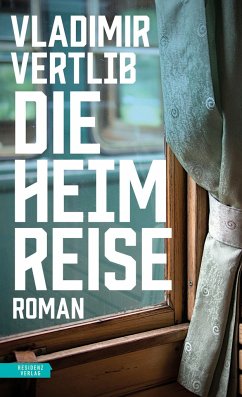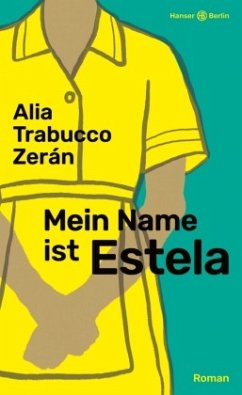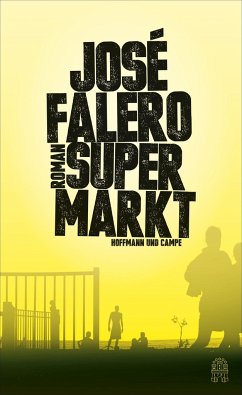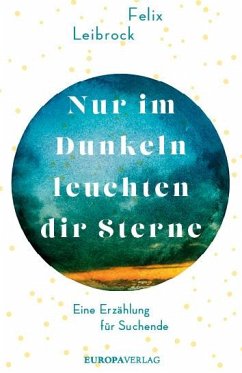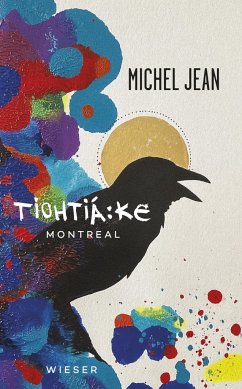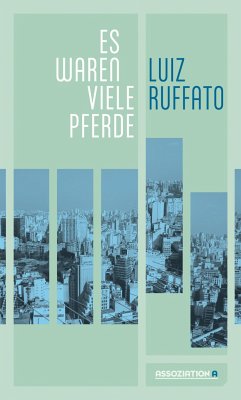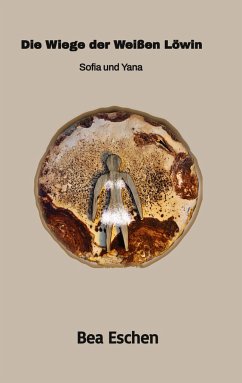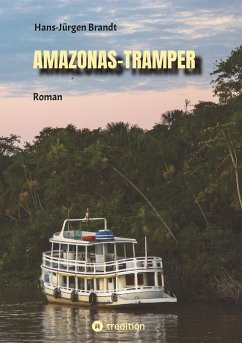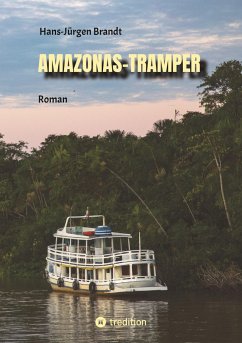Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Glitzernde Pools, kunstvolle Skulpturen und imposante Tore: Sehnsüchtig blickt Chilves auf die luxuriösen Wohnanlagen von São Paulo. Sein eigenes Leben könnte nicht weiter davon entfernt sein: Er findet Unterschlupf auf der Praça da Matriz, ein Ort, wo jene zusammenkommen, die keinen Ort mehr haben.Da ist Jéssica, seine Jéssica, die große Pläne hegt für ihre gemeinsame Zukunft. Da ist der kleine Dido mit seinem Hundewelpen, der Schriftsteller Iraquitan, der sich an der Schönheit seltsamer Worte festhält, oder Farol Baixo, der Lügner. Zwischen behelfsmäßigen Verschlägen und Ölt...
Glitzernde Pools, kunstvolle Skulpturen und imposante Tore: Sehnsüchtig blickt Chilves auf die luxuriösen Wohnanlagen von São Paulo. Sein eigenes Leben könnte nicht weiter davon entfernt sein: Er findet Unterschlupf auf der Praça da Matriz, ein Ort, wo jene zusammenkommen, die keinen Ort mehr haben.
Da ist Jéssica, seine Jéssica, die große Pläne hegt für ihre gemeinsame Zukunft. Da ist der kleine Dido mit seinem Hundewelpen, der Schriftsteller Iraquitan, der sich an der Schönheit seltsamer Worte festhält, oder Farol Baixo, der Lügner. Zwischen behelfsmäßigen Verschlägen und Öltonnen, in einer Welt, in der sich jeder selbst der Nächste ist, entsteht eine unerwartete Gemeinschaft.
Patrícia Melo reißt uns mit in eine schmutzig schillernde Metropole und fragt, was uns als Menschen ausmacht.
Da ist Jéssica, seine Jéssica, die große Pläne hegt für ihre gemeinsame Zukunft. Da ist der kleine Dido mit seinem Hundewelpen, der Schriftsteller Iraquitan, der sich an der Schönheit seltsamer Worte festhält, oder Farol Baixo, der Lügner. Zwischen behelfsmäßigen Verschlägen und Öltonnen, in einer Welt, in der sich jeder selbst der Nächste ist, entsteht eine unerwartete Gemeinschaft.
Patrícia Melo reißt uns mit in eine schmutzig schillernde Metropole und fragt, was uns als Menschen ausmacht.
Patrícia Melo (*1962 in São Paulo) zählt zu den wichtigsten Stimmen der brasilianischen Gegenwartsliteratur. Nach ihrem Studium in São Paulo arbeitete sie beim Fernsehen. In ihrem sozialkritischen Werk, bestehend aus Kriminalromanen, Hörspielen, Theaterstücken und Drehbüchern, beschäftigt sie sich mit der Gewalt und Kriminalität in Brasiliens Großstädten. Melo wurde u. a. mit dem Deutschen Krimipreis und dem LiBeraturpreis ausgezeichnet, die Times kürte sie zur 'führenden Schriftstellerin des Millenniums' in Lateinamerika. Sie lebt in Lissabon.
Produktdetails
- Verlag: Unionsverlag
- Originaltitel: Menos que um
- Seitenzahl: 397
- Erscheinungstermin: 12. Februar 2024
- Deutsch
- Abmessung: 206mm x 130mm x 37mm
- Gewicht: 535g
- ISBN-13: 9783293006027
- ISBN-10: 3293006027
- Artikelnr.: 69245786
Herstellerkennzeichnung
Nördlinger Verlagsauslfg
Augsburger Str. 67a
86720 Nördlingen
Kundenservice@beck.de
»Melos literarische Verarbeitung der Realität ist meisterhaft und entspricht dem Wesen von São Paulo - hart, dynamisch, schmutzig, verwirrend. Und trotz des bedrückenden Themas ist Die Stadt der Anderen eine hinreißende Lektüre, nicht zuletzt dank der hervorragenden Übersetzung von Barbara Mesquita.« Buchkultur
Patrícia Melo entwirft in "Die Stadt der anderen" ein schonungsloses, aber packendes Panorama der Armenviertel São Paulos zur Zeit der Bolsonaro-Regierung. Anfangs hat mich die Vielzahl der Figuren sowie die häufigen Szenenwechsel durch die sehr kurzen Kapitel etwas …
Mehr
Patrícia Melo entwirft in "Die Stadt der anderen" ein schonungsloses, aber packendes Panorama der Armenviertel São Paulos zur Zeit der Bolsonaro-Regierung. Anfangs hat mich die Vielzahl der Figuren sowie die häufigen Szenenwechsel durch die sehr kurzen Kapitel etwas verwirrt– ein Personenregister wäre hier hilfreich gewesen. Doch sobald man sich in die Geschichte eingelesen hat, entfaltet sich eine große Sogwirkung, und ich mochte das Buch kaum noch zur Seite legen.
Die Großstadt erscheint als düsterer Moloch, in dem Gewalt und Hoffnungslosigkeit allgegenwärtig sind. Polizei und Institutionen, die offiziell für Ordnung oder soziale Hilfe sorgen sollen, entpuppen sich als zutiefst korrupt, brutal und rassistisch, das Leben eines Obdachlosen ist nichts wert. Die sogenannten Ordnungshüter verüben gerne auch mal Selbstjustiz und lassen die Leichen auch gleich verschwinden. Besonders bedrückend ist die Darstellung des Lebens auf der Straße, das einer eigenen, rauen Ordnung folgt. Trotz Solidarität unter den Ausgestoßenen bleibt es ein Überlebenskampf mit eigenen Regeln, in dem Transsexuelle und Migranten auf der untersten Stufe stehen und noch stärker ausgegrenzt werden.
Melo schildert diese Realität mit sprachlicher Wucht und intensiver Bildkraft. Einige Figuren, wie etwa der auf der Straße lebende Schriftsteller, der von einem Literaturagenten entdeckt und medial gehypt wird, wirken zwar klischeehaft, doch insgesamt gelingt es der Autorin, eine bedrückende und gleichzeitig fesselnde Gesellschaftskritik zu formulieren. Besonders eindrücklich ist die Entlarvung jener Institutionen, die angeblich soziale Verbesserungen anstreben, in Wahrheit jedoch nur am Leid der Ärmsten verdienen.
Fazit: Packende brasilianische Gesellschaftkritik, teils ein wenig überzeichnet.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
São Paulo, schillernde Millionenmetropole, Kultur- und Wirtschaftszentrum und beliebtes Reiseziel Brasiliens ist Melos Geburtsstadt. Doch sie zeigt uns die andere Seite, »die Stadt der Anderen«, die der Obdachlosen, Prostituierten, Gelegenheitsdiebe, Müllsammler, …
Mehr
São Paulo, schillernde Millionenmetropole, Kultur- und Wirtschaftszentrum und beliebtes Reiseziel Brasiliens ist Melos Geburtsstadt. Doch sie zeigt uns die andere Seite, »die Stadt der Anderen«, die der Obdachlosen, Prostituierten, Gelegenheitsdiebe, Müllsammler, Straßenhändler, Bettler und Drogensüchtigen. Menschen, die oft von heute auf morgen ihren Job, ihre Wohnung verloren haben und nun auf der Praça da Matriz auf Pappen in Hauseingängen schlafen, auf Parkbänken oder unterbehelfsmäßigen Planen und ums tägliche Überleben kämpfen.
Chacoy, der auf der Suche nach einem besseren Leben aus Venezuela eingewandert ist, muss sie jeden Morgen mit dem Wasserschlauch vertreiben. Durch eine Unachtsamkeit verliert er seinen Job und wird Teil dieser bunten Gemeinschaft. Dido mit seinem Hundewelpen, der vor dem gewalttätigen Stiefvater geflohen ist, die schwangere 15-jährige Jèssica, die ihr Geld mit Putzen verdient, Chilves, der mit Müll Geld macht, im Gefängnis landet und bekehrt wird. Und da ist Douglas, der Totengräber, der während der Coronapandemie täglich mehr Gräber ausheben muss, und seinen Glauben an Gott verliert.
Es sind einige Figuren, die wir durch ihr tägliches Elend begleiten, die Melo mit der Zeit lose verknüpft. Es braucht eine Weile, bis man sich im Großstadtdschungel São Paulos zurechtfindet. Aber desto mehr man von den einzelnen Schicksalen erfährt, umso sogartiger entwickelt sich die kaleidoskopartige Geschichte. In wechselnden Perspektiven erleben wir, wie unterschiedlich die Schicksale der Gestrandeten sind, wie schnell man von heute auf morgen auf der Straße landen kann, seine Arbeit, sein Dach über dem Kopf, seinen ganzen Besitz verlieren kann. Sie alle sind einem korrupten Polizeiapparat ausgeliefert, der vor Selbstjustiz und Mord nicht zurückschreckt, sie verschwinden ohne Anklage in Gefängnissen oder in kirchlichen Einrichtungen, die mit zweifelhaften Methoden von Umerziehungs- oder Irrenanstalten arbeiten und dafür Geld von der Regierung erhalten.
Zwischen all der Aussichtslosigkeit blitzt immer wieder ein Funken Hoffnung, Menschlichkeit und gegenseitiger Hilfsbereitschaft durch. Auch wenn man ihnen alles genommen hat, sie träumen noch immer von einem besseren Leben. Und das ist auch die Stärke des Romans, denn Melos Figuren wachsen einem mit der Zeit sehr ans Herz. Man ist so mittendrin, dass man sich wünscht, ihr kleiner Traum vom Glück möge in Erfüllung gehen. Doch Melo zerstört auch diese Wünsche, das Sterben auf der Straße ist allgegenwärtig.
Melo benennt weder Details der Pandemie noch die fatale Politik des rechten Präsidenten Bolsonaros, dennoch wird schnell deutlich, welche Folgen dies für das Land hatte, die besonders für die Armen exorbitant waren. Wer in Brasilien keine Adresse hat, kann sich auch nicht für Sozialhilfe registrieren lassen. Einmal auf der Straße angekommen gibt es nahezu keinen Weg zurück.
Melo lässt es uns hautnah spüren, wie unerwünscht diese Menschen sind, die das Stadtbild verschandeln, den Einzelhändlern ein Dorn im Auge sind und wie perfide die erdachten Gegenmaßnahmen, um sie loszuwerden. Das ist stellenweise nur schwer zu ertragen, schmerzt fast körperlich, da es trotz aller Fiktion sehr realitätsnah wirkt. Und doch liest sich der Roman flüssig und schnell, die Kapitel aus den einzelnen Perspektiven sind kurz und die Zeitsprünge (oft über Monate hinweg) verdichten die Ereignisse. Besonders beeindruckt haben mich ihre stilistischen Kniffe, der immer wiederkehrenden Aufzählungen, die zeigen, dass sich hinter der oft von uns als graue Masse wahrgenommenen Obdachlosen eine Vielzahl von Schicksalen, von Sehnsüchten, von individuellen Geschichten verbirgt. Melo gibt diesen unerwünschten, ungesehenen, vergessenen Menschen in ihrer Heimat eine Stimme. Es ist ein Roman, den ich so schnell nicht vergessen werde, der mich zutiefst berührt hat und der eine unbedingte Leseempfehlung von mir bekommt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Patricia Melo versetzt ihren Leser nach Sao Paolo/Brasilien, eine 12-Millionen-Stadt. Das Eingangszitat aus Victor Hugos „Die Elenden“ stimmt den Leser schon ein auf das, was ihn erwartet: einen Roman über Obdachlose, über soziale Probleme, über ethnisch Diskriminierte, …
Mehr
Patricia Melo versetzt ihren Leser nach Sao Paolo/Brasilien, eine 12-Millionen-Stadt. Das Eingangszitat aus Victor Hugos „Die Elenden“ stimmt den Leser schon ein auf das, was ihn erwartet: einen Roman über Obdachlose, über soziale Probleme, über ethnisch Diskriminierte, über sozial Deklassierte, Menschen aller Couleur, die am Rande der Gesellschaft leben und nicht in der Lage sind, sich an ihren eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen.
Melo lässt einen Figurenreigen auftreten, dessen Figuren locker miteinander verbunden sind und die eines gemeinsam haben: alle sind auf der Straße gelandet, und sie kämpfen mit unterschiedlichen Mitteln ums tägliche Überleben. Die Autorin führt die vielen Personen sehr sicher durch die Handlung, sie behält die Erzählung souverän in ihrer Hand. Traumatisierte, Bettler, Junkies, Prostituierte, elternlose Kinder, Transvestiten, Tagelöhner, Diebe und andere Kriminelle, aber auch Studenten und ehemals Bürgerliche, die in eine Schieflage geraten sind und nicht mehr herausfinden – sie alle sammeln sich an einem Platz.
Mit dieser Situation nimmt Melo aber auch andere Probleme der brasilianischen Gesellschaft ins Visier: eine korrupte Justiz, eine gewalttätige Polizei, die Lynchjustiz praktiziert, den alltäglichen Rassismus, die staatliche Förderung von Großkapital, den Pauperismus breiter Gesellschaftsschichten – kurz: die gewaltige Schieflage der brasilianischen Gesellschaft und das Versagen eines Staatswesens.
Melos Sozialkritik ist überdeutlich und auch berechtigt. Gelegentlich geht ihre Empörung mit ihr durch, etwa wenn sie als Autorin Informationen über das Gesundheitswesen gibt, die die Perspektive der jeweiligen Figur übersteigen.
Die einzelnen Figuren des großen Reigens sind voller Empathie gezeichnet. Sehr anrührend ist es, wenn sie selber ihre Träume schildern: eine Steuernummer, eine Arbeit, das tägliche Essen für sich und die Familie, ein Dach über dem Kopf. Im Zentrum der Handlung steht das sog. Makan-Gebäude, das einem weiblichen Immobilien-Tycoon gehört, die es als Spekulationsobjekt verkommen lässt. Eine Gruppe besetzt das Haus, renoviert es, installiert eine funktionierende Gemeinschaft – ein Hoffnungsschimmer für die Obdachlosen und zugleich der Ansatz einer Revolution, die allerdings durch Polizei und Militär zerschlagen wird. Was bleibt? Wer hat eine Zukunft?
4,5/5*
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Berührende Einblicke
Die Stadt der Anderen. Welcher Anderen? Wer sind diese Anderen? Patrícia Melo beschreibt in ihrem Buch „Die Stadt der Anderen“ die Welten der Obdachlosen von São Paulo. Sie gibt diesen Anderen Gesichter, sie gibt diesen Anderen Leben, macht sie …
Mehr
Berührende Einblicke
Die Stadt der Anderen. Welcher Anderen? Wer sind diese Anderen? Patrícia Melo beschreibt in ihrem Buch „Die Stadt der Anderen“ die Welten der Obdachlosen von São Paulo. Sie gibt diesen Anderen Gesichter, sie gibt diesen Anderen Leben, macht sie der Leserschaft greifbar.
Patrícia Melo lässt uns in eine andere Welt blicken, ermöglicht diesen vielbeschworenen Blick über den Tellerrand. Nun könnte man sich in seiner vermeintlich sicheren Welt zurücklehnen und für sich schlussfolgern, dass es hier eben diese Anderen sind, um die es hier geht. Doch ist dies wirklich so? Sind diese hier beschriebenen Anderen wirklich die Anderen, oder sind es wir alle?
Das ist eine Frage, die schmerzlich sein könnte!
Denn in unserer leistungsorientierten Welt zählt der Leistende. Und es zählt der Vermögende. Und diese Anderen? Da wir ein sozialer Staat sind, werden auch die Anderen unterstützt. Noch. Denn auch bei uns werden diese Stimmen lauter, die diesen Anderen ihre Sicherung minimieren möchten. Kürzungen im sozialen Bereich liefen schon und laufen weiter. Was kommt dann noch? Wie weit sind wir dann von diesen hier beschriebenen Verhältnissen in São Paulo entfernt? Wann ist diese Stadt der Anderen bei uns? Wollen wir das?
Aus dieser Sicht heraus ist „Die Stadt der Anderen“ ein überaus wichtiges Buch. Man kann es lesen und diese hier beschriebene Welt in São Paulo verorten. Man kann sich nach der sehr berührenden Lektüre zurücklehnen und sich in seiner Sicherheit wiegen. In dieser vermeintlichen Sicherheit.
Man könnte auch bei den Anderen verbleiben und ihnen diese sich schnell anbietende Schuldzuweisung zukommen lassen. Man könnte das. Aber will man das als lesender Mensch? Denn die Welt der Literatur macht ja etwas mit uns. Sie gewährt Einblicke. Und diese Anderen sind meiner Meinung nach wir alle. Suchterkrankungen sind Erkrankungen. Punkt. Wie viele anderen Erkrankungen gibt es, die die eigene Leistung behindern und auch verhindern? Was ist man dann wert in dieser leistungs- und gewinnorientierten Gesellschaft, in der sich zunehmend auch recht gewissenlose Subjekte in höheren Positionen tummeln?
Diese Frage tut weh, ich weiß.
Und die vermeintliche Sicherheit, in die man sich zurückziehen möchte, ist schwankend und fragil. Und diese Sicherheit wird immer fragiler. Sie ist zerbrechlich.
„Die Stadt der Anderen“ zeigt eine Welt, in der wir nicht leben wollen, in der aber Teile unserer Gesellschaft in einem gewissen Maße schon leben. Auch dies sollte uns bewusst sein. Suchterkrankungen gibt es auch bei uns, Menschen in ausweglosen Situationen ebenso, auch Obdachlose befinden sich schon in unseren Städten. „Die Stadt der Anderen“ ist also schon da, auch wenn wir sehr gern die Augen davor verschließen möchten. Diese Stadt der Anderen ist bei uns sicher noch nicht so ausgeprägt wie hier in São Paulo beschrieben. Aber müssen wir so lange warten bis diese Zustände auch bei uns zutreffen?
Das Buch stellt die Frage wie wertvoll jeder Mensch in unseren Landen ist. Manche sehen hier ja Unterschiede. Andererseits kann man auch fragen, wie krank so eine Unterteilung ist. Denn in der Geschichte zeigt sich ja, wohin solche Einteilungen führen können.
Patrícia Melo hat mit „Die Stadt der Anderen“ ein soghaft-spannendes Buch geschrieben, ein berührend-emotionales Buch. Es zeigt auf was in unseren Gesellschaften los ist, es zeigt diese Anderen, gibt ihnen Stimmen und Gesichter, macht sie erlebbar. Was dieses Buch mit uns als Lesenden macht, muss jede/r für sich selbst entscheiden.
Mich hat „Die Stadt der Anderen“ tief berührt und für mich war dieses Buch von Patrícia Melo ein Lesehighlight in diesem Lesejahr 2025. ❤
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Jedermann/Jedefrau ist seines Glückes Schmied
Dieser Satz war schon bei den alten Römern im Umlauf. Heute in neoliberalen Zeiten ist er aktueller denn je, teilt er doch die Menschen in zwei Klassen. Die, die es schaffen, sich in der Gesellschaft erfolgreich zu behaupten und die …
Mehr
Jedermann/Jedefrau ist seines Glückes Schmied
Dieser Satz war schon bei den alten Römern im Umlauf. Heute in neoliberalen Zeiten ist er aktueller denn je, teilt er doch die Menschen in zwei Klassen. Die, die es schaffen, sich in der Gesellschaft erfolgreich zu behaupten und die Anderen, die den „Bodensatz“ einer Gesellschaft bilden.
Patricia Melo gelingt es meisterhaft, dass wir uns den Menschen des Großstadtdschungels Sao Paulos lesend nähern, sie kennenlernen: wer sie sind, woher sie kommen, warum sie auf der Straße leben, ihre Ängste und vor allem auch ihre Träume. Es sind Individuen wie du und ich. In klaren Schilderungen ohne Betroffenheitsduselei werden die einzelnen Charaktere ausgeleuchtet und lebendig:
Seno Chacoy, der Venezolaner
Douglas, der Totengräber, verheiratet mit Regiana, der eine gedankliche Pyramide entwirft:
Am Fuße die Menschen und die Primaten, die auch grausam sein und Kriege führen können. Mittig die Tiere, die nur töten, um zu überleben. Und an der Spitze die Pflanzen mit den Bäumen als höchstem Ausdruck des Guten.
Zélia Firmino, ihre Kinder João Henrique und Jessica
Chilves, Jessicas Partner und Vater ihrer neugeborenen Tochter
Glenda, die Transfrau,
Dido und sein Hund Afonsinho
ZJ, der Rapper
Farol Baixo, der Lügner
Iraquitan Soares, der Schriftsteller, der Funken sprühende Worte sammelt
Die wenigen der „anderen Seite“:
Rita, die Journalistin
Ciro Andrade Filho, der Verleger
Padre Augusto
Und als Beispiel für die Ausführenden der staatlichen Executive:
Marreco und Cleber, zwei Polizisten, die Einsatzberichte fälschen, Tatorte manipulieren und Hinrichtungen arrangieren.
Da wird ein Mikrokosmos im Makrokosmos sichtbar mit seinen vielfältigen Regeln und Repressionen: Die staatlichen Herbergen, ein Platz für Ansteckungen und Diebstähle, sind tagsüber geschlossen
Die christlichen Heime, auch dort verwanzte Betten, missionarische Gehirnwäsche.
Ganze Gemeinden, die sich mit Milizen, der Polizei und den Drogenkartellen zusammenschließen.
Psychosoziale Zentren, die mit Elektroschocks arbeiten.
Die morgendliche Überlebensroute: immer in Bewegung bleiben, sonst ist man eine Zielschreibe für die Militärpolizei, die braven Bürger und die Evangelikalen.
Der Zusammenhalt unter den „Erniedrigiten“, aber auch dort sind manche Schafe schwarz.
Alle sind miteinander verbunden. Niemand glänzt im Scheinwerferlicht der Autorin. Patricia Melo nutzt die Einzelschicksale als Gesamtschicksal, um die Politik und die Gleichgültigkeit der braven Bürger anzuprangern, die vergessen, dass der Absturz in die Namenlosigkeit und Unsichtbarkeit jeden treffen kann. Sie präsentiert uns staatliche Gewalt, durchsetzt von Korruption und Kriminalität und lässt wenig Hoffnung auf einen funktionierenden Rechtsstaat.
Ein beeindruckendes Porträt einer Gesellschaft und ihrer Menschen. Unbedingt lesenswert, um vielleicht im Hier und Jetzt die Augen offen zu halten für „die Anderen“-
„Denn die einen sind im Dunkeln Und die andern sind im Licht“. (Brecht
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für