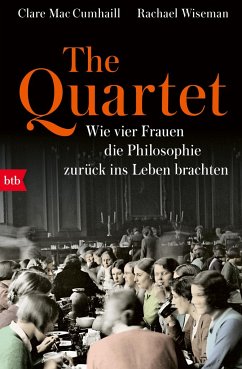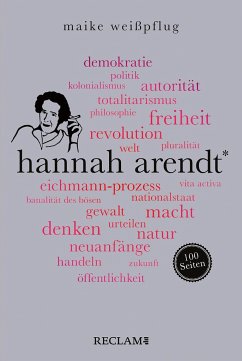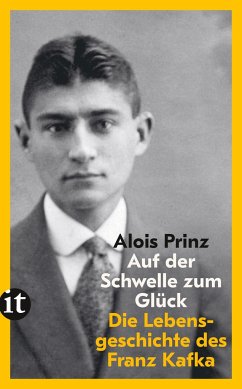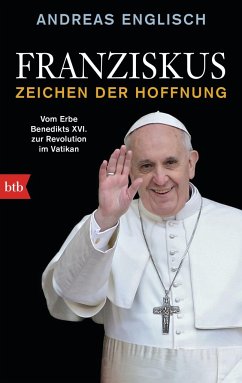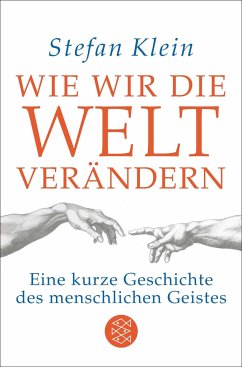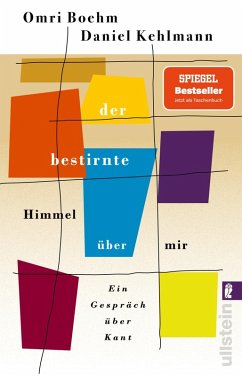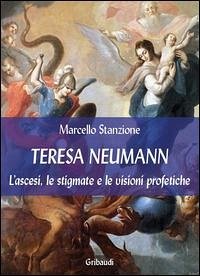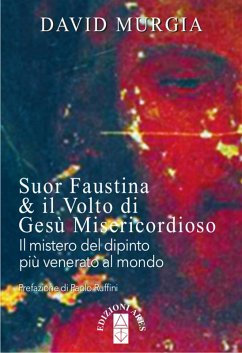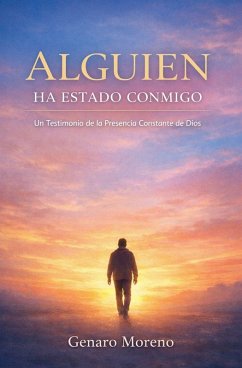Der Philosoph
Habermas und wir Ein neuer Blick auf einen der weltweit einflussreichsten Intellektuellen der Nachkriegszeit

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Das intellektuelle Gesicht einer EpocheSolange Philipp Felsch zurückdenken kann, war Jürgen Habermas around: als mahnende Stimme der Vernunft, als Stichwortgeber der Erinnerungskultur, als Sohn der Nachbarn seiner Großeltern in Gummersbach.Neigt sich die intellektuelle Lufthoheit des Philosophen heute ihrem Ende zu, oder bekommen seine Ideen in der Krise unserer »Zeitenwende« neue Brisanz?Felsch liest in einem kaum zu überblickenden Oeuvre nach, folgt dessen Autor in die intellektuelle Kampfzone der Bundesrepublik und fährt nach Starnberg, um Habermas zum Tee zu treffen. Dabei entsteht ...
Das intellektuelle Gesicht einer Epoche
Solange Philipp Felsch zurückdenken kann, war Jürgen Habermas around: als mahnende Stimme der Vernunft, als Stichwortgeber der Erinnerungskultur, als Sohn der Nachbarn seiner Großeltern in Gummersbach.
Neigt sich die intellektuelle Lufthoheit des Philosophen heute ihrem Ende zu, oder bekommen seine Ideen in der Krise unserer »Zeitenwende« neue Brisanz?
Felsch liest in einem kaum zu überblickenden Oeuvre nach, folgt dessen Autor in die intellektuelle Kampfzone der Bundesrepublik und fährt nach Starnberg, um Habermas zum Tee zu treffen. Dabei entsteht nicht nur das Porträt eines faszinierend widersprüchlichen Denkers, sondern auch der Epoche, der er sein Gesicht verliehen hat.
Solange Philipp Felsch zurückdenken kann, war Jürgen Habermas around: als mahnende Stimme der Vernunft, als Stichwortgeber der Erinnerungskultur, als Sohn der Nachbarn seiner Großeltern in Gummersbach.
Neigt sich die intellektuelle Lufthoheit des Philosophen heute ihrem Ende zu, oder bekommen seine Ideen in der Krise unserer »Zeitenwende« neue Brisanz?
Felsch liest in einem kaum zu überblickenden Oeuvre nach, folgt dessen Autor in die intellektuelle Kampfzone der Bundesrepublik und fährt nach Starnberg, um Habermas zum Tee zu treffen. Dabei entsteht nicht nur das Porträt eines faszinierend widersprüchlichen Denkers, sondern auch der Epoche, der er sein Gesicht verliehen hat.