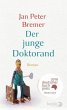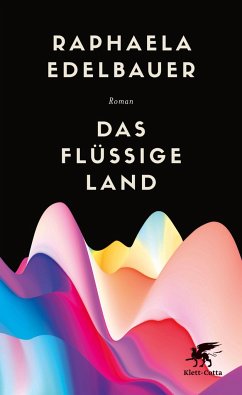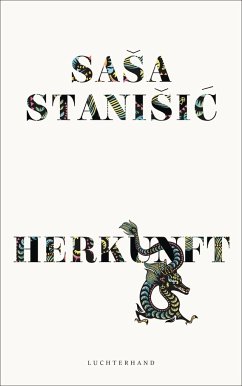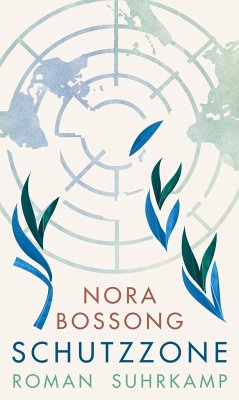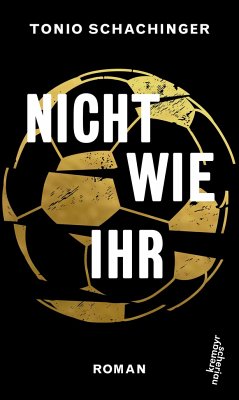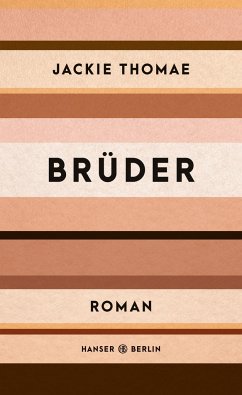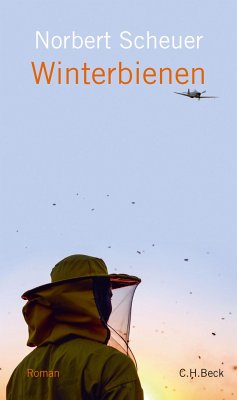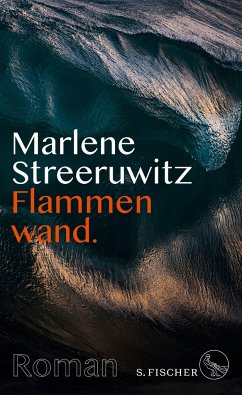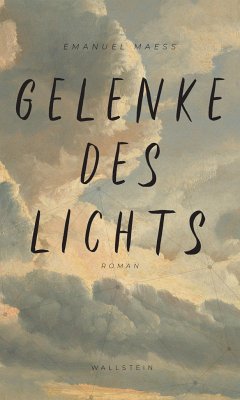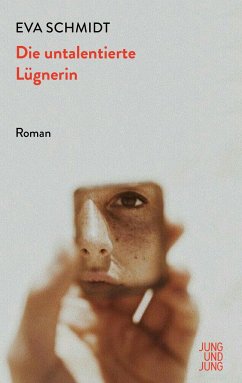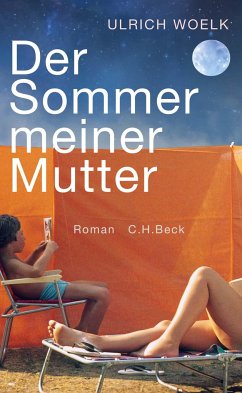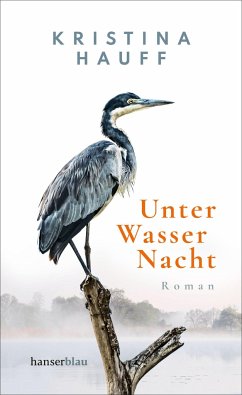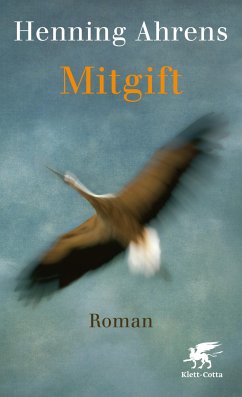Nicht lieferbar
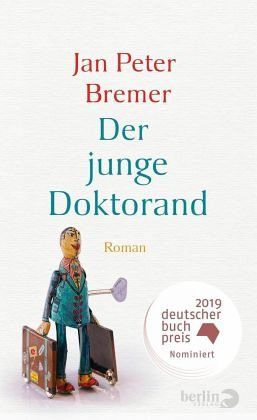
Jan Peter Bremer
Gebundenes Buch
Der junge Doktorand
Roman. Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2019 (Longlist)





Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2019!»Was war denn das für ein Doktorand!«Zwei Jahre schon warten die Greilachs mit an Verzweiflung grenzender Vorfreude auf die Ankunft eines jungen Doktoranden in ihrer abgelegenen Mühle. Er soll dem alternden Maler Günter Greilach zu neuem Ruhm verhelfen. Für seine Frau Natascha dagegen wird er zum Lichtblick ihrer Alltagsroutine. Ihre Hoffnungen reichen nahezu bis ins Unendliche, doch als der junge Mann nach mehreren Absagen plötzlich doch vor ihrer Tür steht, kommt alles anders als selbst in wildesten Träumen ausgemalt.Nach »Der amerikanisc...
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2019!
»Was war denn das für ein Doktorand!«
Zwei Jahre schon warten die Greilachs mit an Verzweiflung grenzender Vorfreude auf die Ankunft eines jungen Doktoranden in ihrer abgelegenen Mühle. Er soll dem alternden Maler Günter Greilach zu neuem Ruhm verhelfen. Für seine Frau Natascha dagegen wird er zum Lichtblick ihrer Alltagsroutine. Ihre Hoffnungen reichen nahezu bis ins Unendliche, doch als der junge Mann nach mehreren Absagen plötzlich doch vor ihrer Tür steht, kommt alles anders als selbst in wildesten Träumen ausgemalt.
Nach »Der amerikanische Investor« gelingt dem vielfach preisgekrönten Jan Peter Bremer eine wunderbare Gesellschaftsparabel über unser allgegenwärtiges Bedürfnis gesehen zu werden. Kurzweilig, klug und voller Sprachwitz erweist er sich einmal mehr als »ein wahrer Chaplin der Schreibfeder« (FAZ).
»Die karge, hinterlistige Prosa Bremers, seine träumenden, gebrochenen Narrenfiguren, haben dem Autor nicht ganz zu Unrecht den gern bemühten Vergleich mit Kafka und Robert Walser eingehandelt. Dabei sollte sich Bremers Prosa inzwischen selbst genug sein.« Der Tagesspiegel
»Was war denn das für ein Doktorand!«
Zwei Jahre schon warten die Greilachs mit an Verzweiflung grenzender Vorfreude auf die Ankunft eines jungen Doktoranden in ihrer abgelegenen Mühle. Er soll dem alternden Maler Günter Greilach zu neuem Ruhm verhelfen. Für seine Frau Natascha dagegen wird er zum Lichtblick ihrer Alltagsroutine. Ihre Hoffnungen reichen nahezu bis ins Unendliche, doch als der junge Mann nach mehreren Absagen plötzlich doch vor ihrer Tür steht, kommt alles anders als selbst in wildesten Träumen ausgemalt.
Nach »Der amerikanische Investor« gelingt dem vielfach preisgekrönten Jan Peter Bremer eine wunderbare Gesellschaftsparabel über unser allgegenwärtiges Bedürfnis gesehen zu werden. Kurzweilig, klug und voller Sprachwitz erweist er sich einmal mehr als »ein wahrer Chaplin der Schreibfeder« (FAZ).
»Die karge, hinterlistige Prosa Bremers, seine träumenden, gebrochenen Narrenfiguren, haben dem Autor nicht ganz zu Unrecht den gern bemühten Vergleich mit Kafka und Robert Walser eingehandelt. Dabei sollte sich Bremers Prosa inzwischen selbst genug sein.« Der Tagesspiegel
Bremer, Jan PeterJan Peter Bremer, 1965 in Berlin geboren, erhielt für einen Auszug aus seinem Roman »Der Fürst spricht« 1996 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Er nahm Aufenthaltsstipendien im In- und Ausland wahr, unterrichtete am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und veröffentlichte zahlreiche weitere ausgezeichnete Romane, Hörspiele und ein Kinderbuch. Für seinen Roman »Der amerikanische Investor« (2011) wurde Bremer zuletzt mit dem Alfred-Döblin-Preis, dem Mörike-Preis und dem Nicolas-Born-Preis ausgezeichnet. Sein neuer Roman »Der junge Doktorand« ist für den Deutschen Buchpreis 2019 nominiert. Jan Peter Bremer lebt in Berlin.
Produktdetails
- Verlag: Berlin Verlag
- 4. Aufl.
- Seitenzahl: 176
- Erscheinungstermin: 26. August 2019
- Deutsch
- Abmessung: 210mm x 132mm x 24mm
- Gewicht: 333g
- ISBN-13: 9783827013897
- ISBN-10: 3827013895
- Artikelnr.: 56142299
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
"Jan Peter Bremer zwirbelt Gegenwart und Vergangenheit, Hoffnung und Enttäuschung ineinander und entwickelt eine zauberhafte Poetik verschraubter Projektionen." Meike Fessmann Süddeutsche Zeitung 20191126
Posse grenzenloser Selbstüberschätzung
Die Anklänge an Samuel Beckett sind unverkennbar in Jan Peter Bremers neuestem Roman «Der junge Doktorand», wie bei «Warten auf Godot» sind hier in einem kammerspielartigen Plot die Hoffnungen der beiden Protagonisten …
Mehr
Posse grenzenloser Selbstüberschätzung
Die Anklänge an Samuel Beckett sind unverkennbar in Jan Peter Bremers neuestem Roman «Der junge Doktorand», wie bei «Warten auf Godot» sind hier in einem kammerspielartigen Plot die Hoffnungen der beiden Protagonisten ebenfalls auf eine erwartete Erlöserfigur gerichtet. Um einen weiteren Vergleich zu bemühen, dieser absurde Roman erinnert mit seinen erbitterten Disputen auch an das Kammerspiel «Der Gott des Gemetzels» von Yasmina Reza, das Polanski so erfolgreich verfilmt hat, stilistisch sind Anklänge an Thomas Bernhard erkennbar, und manches scheint sogar kafkaesk.
Der ehemals berühmte, inzwischen aber wenig erfolgreiche Maler Günter Greilach wartet mit seiner Frau Natascha schon seit zwei Jahren auf einen jungen Doktoranden, der eine Dissertation über den Künstler schreiben will. Sie leben in einer abgelegenen Mühle, in die sie sich vor Jahrzehnten zurückgezogen haben, während seiner Recherche werden sie den Doktoranden bei sich beherbergen. Mehrmals hat der schon den vereinbarten Termin für seine Ankunft kurzfristig abgesagt, zu Beginn der Geschichte nun trifft er diesmal mit dem Auto nach langer Suche aber tatsächlich doch noch spätabends bei ihnen ein. Er wird im Gästezimmer einquartiert und bekommt Gulasch als verspätetes Abendessen, - ziemlich versalzen, wie Günter kritisch anmerkt. Danach wird der junge Doktorand noch in ein langes Gespräch mit dem Maler verwickelt, bei dem er nur stummer Zuhörer bleibt. Sein Atelier will ihm Günter Greilach erst am nächsten Nachmittag zeigen, nachdem er dort aufgeräumt hat. Für das ältere Paar verkörpert der Doktorand einerseits die Hoffnung auf mehr Anerkennung und Publicity für den introvertierten Künstler, andererseits aber auch eine hochwillkommene Abwechslung von der Alltagsroutine für Natascha. Sie mischt sich häufig in die Unterhaltungen ein, sehr zum Missvergnügen ihres Mannes, der sie ziemlich barsch zurückweist und am liebsten auf ihre Pflichten als Hausfrau zurückstutzen würde.
Ein «Gemetzel» sind die Dispute der Eheleute zwar nicht, aber es wird vehement debattiert und mit spitzer Zunge geredet. Beide bleiben sich nichts schuldig bei ihrem Dauergezänk, dessen stummer Zeuge der junge Doktorand ganz unfreiwillig werden muss. Natürlich redet das Ehepaar ständig aneinander vorbei, sie interpretieren die Situation völlig unterschiedlich und streiten über Geschehnisse der Vergangenheit. Günters selbstgefälliges Ego als verkannter Maler wird arg ramponiert dabei, der Sarkasmus seiner Frau scheint grenzenlos, aber auch das Absurde der Kunstwelt wird hier gnadenlos entlarvt. Das jahrelang selbstgefällig aufgebaute Image als Maler erweist sich als reine Fassade, Günters wortreich dargelegter künstlerischer Genius gründet auf seinem egozentrischen, pseudointellektuellen Geschwätz, nicht auf seinem Werk!
Diese durchaus komplexe Geschichte ist narrativ auffallend leichtgewichtig ohne dramatische Effekte angelegt und wird in einer wohltuend klaren, leicht lesbaren Sprache erzählt. Gleichwohl vermag es der Autor, die subtilen Hintergründe der Selbsttäuschungen offenzulegen und die erkennbaren Defizite im menschlichen Miteinander aufzuzeigen, die beiderseitig vorhandenen psychischen Abgründe also ebenfalls deutlich werden zu lassen. Bei all dem ist eine feine Komik nicht zu übersehen, die aber nie in Sarkasmus umschlägt. Der titelgebende Doktorand erweist sich als ausgesprochener Pechvogel, nicht nur in seiner Rolle als unfreiwilliger Zuhörer, sondern auch als «unfreiwilliger» Doktorand. Über den hier aber mehr nicht verraten werden soll, denn der Plot dieses gleichermaßen als Ehe- wie auch als Kunstsatire angelegten, absurden Romans lebt durchaus auch von einer gewissen Spannung. Man will ja schließlich wissen, wo denn all die funkelnden Wortgefechte des, - übrigens an Loriots archetypisch absurde Figuren erinnernden, heillos zerstrittenen Ehepaares letztendlich hinführen werden in dieser Posse grenzenloser Selbstüberschätzung!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Der junge Doktorand ist ein Buch, das mich gelinde gesagt, ziemlich verloren zurück ließ. Zwar fand ich es sprachlich nicht schlecht, nein, es war flüssig und teilweise sogar nett zu lesen und da es keine Kapitelunterteilung hat, kann man es in einem Rutsch durchlesen. Aber im …
Mehr
Der junge Doktorand ist ein Buch, das mich gelinde gesagt, ziemlich verloren zurück ließ. Zwar fand ich es sprachlich nicht schlecht, nein, es war flüssig und teilweise sogar nett zu lesen und da es keine Kapitelunterteilung hat, kann man es in einem Rutsch durchlesen. Aber im Großen und Ganzen weiß ich nicht, was mir der Autor Jan Peter Bremer mit dem Werk inhaltlich sagen will.
Es ist eine Geschichte voller Missverständnisse, Gehässigkeiten, erkalteter Liebe, falschem Schein, Lügen und aktuellen Themen wie der Flüchtlingskrise. Mittendrin Florian, gemeinhin „der Doktorand“ genannt und das Ehepaar Günter und Natascha Greilach. Irgendwie hat der Autor bei Kafka gewildert (die Geschichte ist kurz und besteht zu großen Teilen aus Dialogen und inneren Monologen), manchmal war die Atmosphäre aber auch so bissig und biestig, dass ich mich wie bei Edgar Allan Poe fühlte und darauf wartete, dass jemand wie im Verräterischen Herz zerlegt unter den Dielenbrettern verschwindet.
Das in die Jahre gekommene Ehepaar hat lange auf den Doktoranden gewartet, seinen Besuch herbeigesehnt und er hatte ihn mehrfach abgesagt und verschoben. Aber jetzt, wo er da ist, wissen sie nicht so richtig, was sie mit ihm anfangen sollen. Sie überfahren ihn mit geballten Informationen zu Dingen und Menschen über die er vermutlich gar nichts wissen will, erhoffen sie sich doch, dass er die ins Stocken geratene Karriere von Günter mit seiner Doktorarbeit wieder ankurbeln kann.
Mehr kann ich über die Geschichte gar nicht sagen, ohne zu spoilern. Allerdings kommt mir der arme Doktorand zum Teil so fehl am Platz und so verloren vor, dass ich fast damit gerechnet hätte, dass er irgendwann sagt, er sei nur der Mann vom Elektrizitätswerk und wolle eigentlich den Stromzähler ablesen.
Sympathisch ist mir das Ehepaar Greilach nicht. Sie sind undurchschaubar, verlogen und verkrampft. Ihr Verhalten einander gegenüber ist in der Hauptsache schroff und kalt, von Liebe und Zuneigung ist in dieser Ehe nichts mehr zu spüren. Die Außenwirkung und wie sie im Dorf wahrgenommen werden ist beiden wichtig, dafür wird auch gerne mal gelogen. Florian, der Doktorand ist mir da schon sympathischer. Er ist zurückhaltend und scheint gutmütig und großherzig zu sein. Er ist als Freiwilliger im Flüchtlingscafé tätig und gibt Deutschunterricht. Und er lässt sich geduldig von den Greilachs in Beschlag nehmen und hört ihnen bereitwillig zu.
Das Buch ist kurz und bündig. Stilistisch am ehesten eine Novelle, es hat weder einen wirklichen Anfang aber einen offenen Schluss. So siedle ich es irgendwo zwischen Kafka und Sartre an, denn auch in diesem Buch sind die Hölle eindeutig die anderen. Oder auch der eine dem anderen der Wolf („homo homini lupus est“). Irgendwie war das Buch für mich von Anfang an wie ein Unfall. Eigentlich wollte ich es beiseitelegen und vergessen, aber es reizte mich dann doch zu sehr zu erfahren, wie es denn ausgeht. Von mir daher wegen des geringen (aber vorhandenen) Unterhaltungswerts und der Spannungskurve 2 Punkte.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Zwei lange Jahre schon haben die Greilachs die Ankunft des Doktoranden erwartet und sich ausgemalt, wie sich der Aufenthalt des Bewunderers gestalten könnte. Viel haben sie im Dorf darüber gesprochen, dass das Werk des Malers Günter Greilach nun wissenschaftlich betrachtet und …
Mehr
Zwei lange Jahre schon haben die Greilachs die Ankunft des Doktoranden erwartet und sich ausgemalt, wie sich der Aufenthalt des Bewunderers gestalten könnte. Viel haben sie im Dorf darüber gesprochen, dass das Werk des Malers Günter Greilach nun wissenschaftlich betrachtet und gewürdigt werden soll und Natascha erwartet eine spannende Abwechslung von dem ansonsten etwas eingefahrenen Alltag. Nun ist er da und der erste Eindruck ist eher enttäuschend, aber das kann ja noch werden, man muss dem jungen Mann nur richtig begegnen und ihn auf den richtigen Weg geleiteten. Schnell jedoch zeigt sich, dass der Aufenthalt sich völlig anders gestaltet als von Günter und Natascha ausgemalt und dass vorhandene Gräben plötzlich noch tiefer und unüberwindbar werden.
Jan Peter Bremers kurzer Roman erinnert stark an ein Stück des absurden Theaters, in dem die Protagonisten in ihrer Gedankenwelt gefangen sind und auf den tragischen Höhepunkt hinsteuern, ohne das Unglück kommen zu sehen. In der Tat setzt er den Rahmen sehr eng und hält die dramatischen Einheiten ein, die durch die Präsenz des Doktoranden in der Wohnung der Greilachs örtlich und zeitlich begrenzt werden sich einzig um dessen antizipierten Aufenthalt drehen. Fasziniert bis erschreckt schaut man dem tragikomischen Sinnieren des älteren Ehepaars zu und verfolgt ihre sprachlich ausgereizten Dialoge, die ihre Unfähigkeit zu kommunizieren und die fehlende gedankliche Flexibilität vortrefflich entlarven.
Neun Mal hatte Florian Sommer sein Ankommen angekündigt und kurzfristig wieder abgesagt, sein plötzliches Erscheinen überrumpelt die Greilachs, so dass sie sich erst sortieren müssen, bevor sie sich tatsächlich mit ihm auseinandersetzen können. Natascha, die sich für eine bescheidene, aber großartige Zuhörerin hält, sieht sich in Gedanken wie ein junges Mädchen aufblühen und den Doktoranden mit ihren immer noch vorhandenen Reizen becircen. Günter wiederum will sich auch nicht größer machen als er ist, aber nun ja, er hat einiges erreicht, sogar eine Ausstellung hatte man ihm schon in Aussicht gestellt und gerade seine unprätentiöse Haltung zu seinem Werk und der Kunst im Allgemeinen ist es doch, die faszinieren muss, weshalb er auch großzügig sein Atelier für den Doktoranden öffnen wird. Statt Florian Sommer zu fragen, weshalb er da ist und was er vorhat, projizieren sie nicht nur gedanklich, sondern auch verbal ihre Vorstellungen auf den jungen Mann, der gar keine Chance hat, den andauernden Wortschwall zu unterbrechen.
„Was soll den Florian sonst von uns denken“, fuhr sie fort und deutete mit dem Kopf in seine Richtung. „Gerade du kannst es dir gar nicht leisten, dass er denkt, wir beide wären schon ganz verknöcherte Menschen.“
Diametreal steht ihr Verhalten ihrem Agieren entgegen und schafft so einen unterhaltsamen Kontrast dem man amüsiert folgt. Ab einem gewissen Punkt jedoch, wird das mentale Gefängnis, in dem Natascha und Günter unwissentlich festsitzen auch traurig, denn was sich dem Leser und Florian Sommer als fiktivem Zuhörer schnell offenbart, bleibt ihnen verborgen und so dreht sich der Strudel immer schnell und zieht sie hinab ins Verderben und lässt die Situation regelrecht eskalieren.
Auf der persönlichen Ebene wird die Hybris der Figuren aufgedeckt, aber auch der Kunstbetrieb als Ganzes mit seiner Selbstüberschätzung, die durch die kleine abgeschottete Welt, in der sich die Protagonisten nur um sich selbst drehen und sich mit ihresgleichen auseinandersetzen, ohne je den Blick nach außen zu wagen oder dem Außenblick Aufmerksamkeit zu schenken, wird in dem Roman entlarvt. Jan Peter Bremer bringt dies in aller Kürze und Enge sprachlich ausgefeilt auf den Punkt. Ein Roman, der eigentlich auf eine Bühne gehört, denn er braucht kein großes Dekor, sondern spricht für sich selbst. Die Nominierung auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2019 daher völlig zurecht.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für