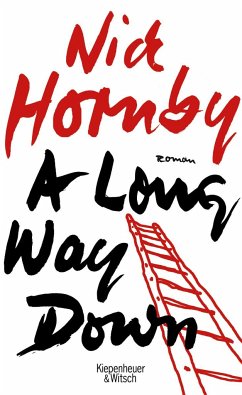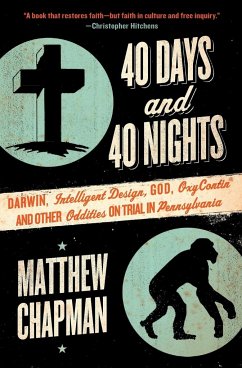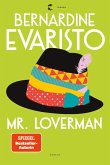Vier Menschen auf dem Dach eines Londoner Hochhauses, die sich an Silvester das Leben nehmen wollen, schließen einen Pakt: neuer gemeinsamer Selbstmord-Termin ist der Valentinstag. Es bleiben sechs Wochen, die gemeinsam überlebt werden müssen.
Silvester, auf dem Dach eines Hochhauses: Pech, dass gleich vier Menschen auf die Idee gekommen sind, sich dort das Leben zu nehmen. Da man sich schlecht umbringen kann, wenn einem andere dabei zusehen, steigt die seltsame Gruppe erst mal vom Dach, um das Problem der jüngsten Kandidatin, die nicht weiß, warum ihr Freund sie verlassen hat, zu lösen. Nach und nach erzählen sie sich ihre Geschichten. Da ist die altjüngferliche Maureen, deren Sohn Matty schwerstbehindert ist und die diese Belastung allein tragen muss - da ist Martin, der berühmte Talkmaster, den nach einem Gefängnisaufenthalt niemand mehr auf dem Bildschirm sehen will - Jess, die aufmüpfige Tochter eines Politikers, ist so direkt, dass sie alle vor den Kopf stößt - und JJ, der seinem besten Freund, dem Sänger seiner Band, im Stich gelassen wurde. Die vier verabreden, mit dem finalen Sprung bis zum Valentinstag zu warten - und so findet eine Gruppe von Menschen zueinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die einander doch auf wundersame Weise zu helfen wissen.
Hornby at his best - in diesem urkomischen, rasanten und mit schwarzem Humor gespickten Roman beweist Hornby wieder einmal seine ganze Meisterschaft. Leser, freut Euch!
Silvester, auf dem Dach eines Hochhauses: Pech, dass gleich vier Menschen auf die Idee gekommen sind, sich dort das Leben zu nehmen. Da man sich schlecht umbringen kann, wenn einem andere dabei zusehen, steigt die seltsame Gruppe erst mal vom Dach, um das Problem der jüngsten Kandidatin, die nicht weiß, warum ihr Freund sie verlassen hat, zu lösen. Nach und nach erzählen sie sich ihre Geschichten. Da ist die altjüngferliche Maureen, deren Sohn Matty schwerstbehindert ist und die diese Belastung allein tragen muss - da ist Martin, der berühmte Talkmaster, den nach einem Gefängnisaufenthalt niemand mehr auf dem Bildschirm sehen will - Jess, die aufmüpfige Tochter eines Politikers, ist so direkt, dass sie alle vor den Kopf stößt - und JJ, der seinem besten Freund, dem Sänger seiner Band, im Stich gelassen wurde. Die vier verabreden, mit dem finalen Sprung bis zum Valentinstag zu warten - und so findet eine Gruppe von Menschen zueinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die einander doch auf wundersame Weise zu helfen wissen.
Hornby at his best - in diesem urkomischen, rasanten und mit schwarzem Humor gespickten Roman beweist Hornby wieder einmal seine ganze Meisterschaft. Leser, freut Euch!

Ohne den Mut der Verzweiflung: Nick Hornbys "A Long Way Down"
Von den roten Telefonen an der Clifton Suspension Bridge in Bristol, dem am häufigsten aufgesuchten Selbstmordort Großbritanniens, kann man kostenlos die Samariter anrufen. Ob diese den Verzweifelten am anderen Ende der Leitung künftig allerdings tatsächlich ausgerechnet Auszüge aus Nick Hornbys Roman "A Long Way Down" vorlesen werden, wie die englische Presse prophezeit hat? Bestenfalls hätte dies eine ähnliche Wirkung wie einst die Klänge des kitschigen Folksongs "Mhairis Wedding" auf A. L. Kennedy, die sie in "Stierkampf" festhielt: "Die Stimmung des Tages ist dahin. Ich kann nicht hier sitzen und Mhairis Wedding anhören und mich in angemessener, glaubwürdiger Weise auf den Tod vorbereiten. Ich kann mich nicht mit solcher Begleitmusik umbringen."
Daß Nick Hornbys Suizid-Club ebenfalls am Selbstmord-Projekt scheitert, verdankt sich keinem fremden Lied, sondern einzig der eigenen Kakophonie, die alle anderen Lebensnebengeräusche schrill übertönt. In einer Silvesternacht kommen sie einander in die Quere, weil sie alle zur selben Zeit am selben Ort dasselbe suchen: den Sinn des Weiterlebens. Maureen, JJ, Jess und Martin begegnen sich auf dem Dach von Topper's House, alle mit dem latenten Vorsatz, sich hinunterzustürzen. Maureen ("Außerdem bin ich katholisch und glaube darum sowieso weniger an Glück als ans Büßen.") ist nach mehr als fünfzig Probejahren des Lebens vor allem deshalb müde, weil sie sich Tag und Nacht um ihren schwerbehinderten Sohn kümmern muß und sie die Teilnahmslosigkeit ihrer Umgebung nicht mehr erträgt. Der Amerikaner JJ ("Okay, ihr kennt mich nicht, deswegen müßt ihr mir einfach abnehmen, daß ich nicht blöd bin.") ist rettungslos verzweifelt, weil seine Band sich aufgelöst und seine Freundin ihn verlassen hat. Die grundwütende Jess ("Ich weiß die meiste Zeit nicht, warum ich was sage. Ich kotze und kotze mich auf irgendwen aus und kann erst aufhören, wenn ich leer bin.") trauert um ihre verschwundene Schwester und leidet unter dem privilegiert ignoranten Dasein als höhere Tochter. Und Martin ("Ich hatte es geschafft, mir einzureden, daß ich mich irgendwie wieder zurückversetzen könnte, als wäre die ewige Jugend ein Ort, den man aufsuchen kann, wann immer einem danach ist. Und nun die weltbewegende Neuigkeit: Das ist sie nicht. Wer hätte das gedacht."), einst Moderator im Frühstücksfernsehen, hat im Bett einer Fünfzehnjährigen nicht nur seine Ehre und seinen Job, sondern auch seine Familie verloren.
Nur war die generelle Nachvollziehbarkeit der Gründe noch nie ein relevantes Kriterium für Suizidkandidaten. Nick Hornbys Quartett jedoch, das Topper's House statt im freien Fall angeregt schwätzend über die Treppe verläßt, fehlt mit der existentiellen Verzweiflung auch die Glaubwürdigkeit. Das liegt nicht etwa daran, daß Hornby dem Tod, diesem uralten Topos der Literatur, ironisch begegnen will, sondern daran, daß es ihm nicht gelingt. Für ein wahrhaft tragikomisches Stück Literatur fehlt es dem Roman an Aberwitz, Tempo und Drastik. Die zur Verzweiflung aufgebauschte Harmlosigkeit der vier Figuren, in ihrer Jämmerlichkeit, ihren Gedanken und Sehnsüchten angeblich so realistische Durchschnittsbewohner der Moderne, ist weder komisch noch tragisch, sondern sie ist schlicht fad.
Nach so angenehm leichtgewichtigen Romanen wie "Ballfieber", "High Fidelity", "About a Boy" und "How to be Good" hat Nick Hornby zwei Millionen Pfund Vorschuß für seine beiden nächsten Romane eingeheimst. Das ist schön für den Autor und stört keinen Leser. Gestört hat es offenbar jedoch Hornby selbst, der plötzlich eine Art Verantwortung beim Schreiben gefühlt zu haben scheint, ähnlich wie Paulo Coelho, der ebenfalls zu meinen scheint, daß der, der ein Millionenpublikum unterhalten will, auch irgendeine Botschaft gratis mitliefern muß. Doch wer tief in Abgründe schaut, die er nicht versteht, wird darüber nicht unbedingt selbst tiefgründiger.
Kein Zweifel: Hornbys Ausgangsidee ist originell. Vier Menschen stolpern bei der einsamsten Entscheidung des Lebens übereinander, und man beschließt, sich einstweilen weiterhin gegenseitig vom Äußersten abzuhalten. Doch außer Not hat die Notgemeinschaft nicht viel gemeinsam, und so geht die Erleichterung bald in Dauerzank über. Um die vier unterschiedlichen Charaktere und Lebenssituationen zu beleuchten, greift Hornby zu einem alten erzählerischen Trick: Er läßt die Personen abwechselnd berichten. So ergeben sich unterschiedliche Perspektiven auf gemeinsame Erlebnisse wie einen Teneriffa-Urlaub, der für die rührend weltfremde Maureen zur Offenbarung wird, während Jess und Martin nichts als Verachtung für das schlechte Essen und den billigen Fusel aufbringen. Doch es gelingt Hornby nicht, die Charaktere und Stimmen sauber zu trennen. Jess nimmt man Wut, Frust und Verzweiflung noch einigermaßen ab, aber alle anderen verschwimmen in dieser Suada aus Larmoyanz und Vergeblichkeit, und mit Ausnahme von Maureen empfindet man ihre Probleme und sie selbst als so aufgesetzt, daß man auch für die Art ihres Überlebens wenig Interesse und Empathie aufzubringen vermag. Daß Hornbys Roman sich nicht mit dem Tod auseinandersetzt, sei ihm verziehen; daß er sich aber auch dem Leben nur auf die Armeslänge eines Dylan- und Wilde-Zitats nähert, ist unentschuldbar. Man wird den Verdacht nicht los, daß Hornby seine Figuren nur als Spielmasse benutzt, ohne sich wirklich für sie zu interessieren. Der Schock des einzig gewagten Moments des Buches, als die vier nämlich noch einmal sentimentalisch aufs Dach von Topper's House steigen und dort unversehens Zeugen des schnellen, wortlosen Todessprungs eines Fremden werden, wird mit Hornbyscher Effizienz rasch wieder ausgeblendet. Und so kommt Nick Hornby mit diesem Roman vielleicht heil im Erdgeschoß an, aber nicht auf dem Boden der Tatsachen.
FELICITAS VON LOVENBERG
Nick Hornby: "A Long Way Down". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Clara Drechsler und Harald Hellmann. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2005. 341 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

In Nick Hornbys Roman „A Long Way Down” beschließen vier Selbstmörder, doch noch eine Weile zu leben
Manchmal entstehen aus Pressemeldungen ganze Romane, aus kleinen Zeitungsnotizen große Literatur: Er habe einen Zeitungsartikel über Beachy Head gelesen, einen Küstenabschnitt in England, der als beliebter Ort für Selbstmörder gilt, hat Nick Hornby neulich über seinen neuen Roman erzählt. Und er habe sich gefragt, wie das an so einem Ort eigentlich ist, wenn zufällig mehrere Selbstmörder aufeinandertreffen. Ob sie sich grüßen? Ob sie sich in die Augen sehen? Oder anfangen, miteinander zu reden? „Ich habe für mein Buch nur den Ort verändert”, sagt er. „Meine Selbstmordkandidaten treffen sich nicht an der Küste, sondern auf dem Dach eines Londoner Hochhauses. Ich wollte nicht, dass sie abhauen können.”
Also stehen sie zu Beginn von „A Long Way Down”, am Silvesterabend, ganz oben auf dem Dach von „Toppers House”, einem Wohnsilo im Londoner Norden. Vier völlig unterschiedliche Menschen, die in dieser Nacht die „Topper”-Treppen hochgekommen sind, bis es nicht mehr weitergeht: Ein Selbstmörder-Quartett, das feststellt, wie schwer es ist, sich umzubringen, wenn einem andere dabei zusehen.
Denn je länger sie da oben stehen und miteinander reden, desto mehr schwindet auch ihre Todessehnsucht. Sie kommen sozusagen nicht zu ihrem Selbstmord, weil sie als plötzliche Konkurrenten am Abgrund erst mal die Frage zu klären haben, wer von ihnen überhaupt einen nachvollziehbaren Grund hat, zu springen. Das ist absurdes Theater und, so wie Hornby es beschreibt, vor allem sehr komisch. Doch lauert hinter der Hornby-Komik, wie immer, trauriger Ernst. An keiner Stelle macht er sich über eine seiner Figuren lustig.
Talkmaster ohne Talkshow
Martin Sharp, allseits bekannter Frühstücksfernsehen-Moderator, vor dessen Haustür schon morgens die Hyänen von der Boulevardpresse stehen, weil er mit einer Fünfzehnjährigen geschlafen hat (die ihm, nun ja, älter vorkam) und daraufhin ins Gefängnis musste, kriegt keine TV-Sendung mehr. Frau und Kinder sind weg, alles verballert für kleine Mädchen in Nachtclubs. Doch besteht das eigentliche Todesurteil darin, nicht mehr auf dem Bildschirm zu sein. Ein Talkmaster ohne Talkshow - wer ist das? Einer, der springen sollte. Oder etwa nicht?
Er zögert noch, da ist Jess, rebellische Tochter eines Bildungspolitikers, von ihrem Freund verlassen, ohne zu erfahren warum, beinahe schon auf dem halben Weg nach unten. Der Pizzabote JJ erfindet eine tödliche Krankheit namens CCR (was in Wirklichkeit für eine seiner Lieblingsbands, Creedence Claerwater Revival, steht), um seine wahren Probleme gar nicht erst verraten zu müssen. Und Maureen, ja Maureen, das finden alle, hätte wirklich einen Grund. Jedenfalls verstummen die drei anderen, als sie ihnen erzählt, wie sie sich seit mittlerweile neunzehn Jahren um ihren schwerbehinderten Sohn kümmert, der nichts versteht und nichts sagen kann, der nie reagiert. In all den Jahren ist sie abends nicht mehr weg gewesen, ist nie in den Urlaub gefahren, weil sich alles um den Sohn drehte, den sie alleine nicht lassen konnte, ohne von schlechtem Gewissen gemartert zu sein. Ein ungewolltes Kind, das nicht einmal einen Vater hat. Sie kann nicht mehr.
Zu viert steigen die Todgeweihten dann aber doch die vielen Stufen des „Toppers House” wieder herunter und geben sich eine Frist: Weiterleben bis zum Valentinstag. Das Leben verdient eine letzte Chance.
Man kann Nick Hornby lieben oder hassen. Dazwischen scheint es nichts zu geben. Die einen feiern ihn hymnisch - und das natürlich zu recht -, die anderen wenden sich maulig ab, weil, wie es dann immer heißt, der ewige Midlife-Krisen-Hornby wieder mal nur über sich selbst geschrieben habe. Natürlich findet, wer das denn will, auch diesmal den Autor in all seinen Figuren: Wie Maureen hat er ein behindertes Kind. Wie Jess gilt er als ewig Pubertierender, der nicht erwachsen werden will. Mit Martin teilt er das zweifelhafte Vergnügen, als Prominenter auf der Straße erkannt und blöd angesprochen zu werden. Und JJ, der gescheiterte Rockstar, ist, so kann man es in Interviews nachlesen, die Alter-Ego-Figur schlechthin.
Diese Art autobiografischen Schreibens ist sicher nicht jedermanns Sache. Aber zum Vorwurf machen kann man sie einem Autor nicht. Es ist schon merkwürdig, dass, wo immer in der Literatur gelebtes Leben durchscheint, wo es nicht kompliziert verschlüsselt, ästhetisch geschönt oder artifiziell verdunkelt wird, Romane unter Verdacht geraten. ,Das ist platt!, heißt es dann. ,Das ist keine Kunst! Es gehört zu den chronischen Krankheiten der Kritik, dass sie immerzu Parallelen zum Leben sucht, während die Figuren sich längst davon abgelöst und ein Eigenleben entwickelt haben.
Solange Nick Hornby aus seinem Leben Funken zu schlagen weiß, ist die Frage, ob diese autobiografisch sind oder nicht, völlig zweitrangig. Und wie er Funken schlägt! Er erfindet Figuren, die man so schnell nicht wieder vergisst: So wie der erwachsene Will und der 12-jährige Markus in „About a boy”, die miteinander ringen und hadern, bis Will seinen Panzer und seine Coolness endlich ablegt, und der andere einen Freund hat, den er braucht, weil das Leben eine Akrobatennummer ist, bei dem man ganzallein oben auf einer Pyramide steht, während die anderen einen stützen, damit man nicht stürzt. „About a boy” war, ganz klar, einer der anrührendsten Romane der neunziger Jahre.
Zurück im befristeten Leben
In „A Long Way Down” ist Hornbys Funken-Figur Maureen. Als sie einmal alle bei ihr zu Besuch sind, in ihrem neuen befristeten Leben, kommt Jess irgendwann mit zwei Postern vom Klo zurück - auf dem einen ein Mädchen, auf dem anderen ein schwarzer Fußballer. „Es sind Mattys Poster”, sagt Maureen mit Blick auf ihren Sohn, der abwesend und stumm daneben sitzt. „Er weiß es nicht, aber es sind seine.” Sie habe sie für ihn ausgesucht, weil sie dachte, dass es schön für ihn wäre, eine attraktive Frau im Haus zu haben, da er doch jetzt in diesem Alter sei. Der andere sei Fußballer bei Arsenal . Matty könne doch nicht Zeit seines Lebens in einem Kinderzimmer leben, mit Clowns auf den Vorhängen und Häschen auf der Bordüre entlang der Wand. Also habe sie ihm alles gekauft, was ein Junge mit neunzehn so braucht: Kassetten, Bücher und Fußballschuhe, jede Menge Uhren, Computerspiele, flippige Stifte und Videos. Ein komplettes ungelebtes Teenagerleben.
Was es heißt, am Ende zu sein, spürt man in keiner von Hornbys „Toppers House Four” so eindringlich wie bei Maureen. Trotzdem ist sie es, die von allen vieren am entschiedensten wieder ins Leben zurückfindet. „Wahrscheinlich war ich gar nicht bereit zu springen”, gesteht sie sich ein, als sie sich am Stichtag, wie verabredet, wieder auf dem Dach treffen. Als sie oben ankommen, sitzt jenseits des Maschendrahts jemand am Hochhausrand. Er weigert sich, mit ihnen zu reden. Er schnippt die Zigarette weg - und springt.
JULIA ENCKE
NICK HORNBY: A Long Way Down. Roman. Aus dem Englischen von Clara Drechsler und Harald Hellmann. Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 2005. 342 Seiten, 19,90 Euro.
Springen? Nicht springen? Darüber muss erst mal geredet werden. Dieses Ölbild von Christina Rodriguez entstand 1996.
Foto: bridgemanart.com
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
"Nichts als Tumult" - das ist die gute Nachricht, die Walter van Rossum nach der Lektüre des neuen Romans von Nick Hornby, "A long way down", zu überbringen hat. Vier Leute treffen sich an einem Silvesterabend zufällig auf dem Dach eines Londoner Hauses, und sie alle haben einen Wunsch gemeinsam: Sie möchten aus dem Leben scheiden. Aus den verschiedenen Motiven, die die Suizidalen haben - der eine hat zusammen mit seiner Band auch seine Freundin und zugleich die Würze seines Lebens verloren, die andere opfert sich seit Jahren alleinstehend für ihr behindertes Kind auf, ohne zu wissen, ob dieses sie überhaupt wahrnimmt, und fühlt sich nun erschöpft -, entwickelt Hornby, so van Rossum, "kakofone Kammermusik der Meisterklasse". Der Rezensent ist hingerissen; zwar fehlt ein Happy End, teilt er mit, dafür aber bleiben dem Leser auch "metaphysische Erörterungen über den Sinn des Lebens erspart". Besonders angetan hat es van Rossum die 18 Jahre alte Jess, eine "durchgeknallte Göre", die den Rezensenten zuweilen "von der Wiedereinführung der Prügelstrafe träumen" ließ.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Nie zuvor hat Nick Hornby mit so großer Sensibilität unter die Oberfläche geschaut.« Kulturnews 202009