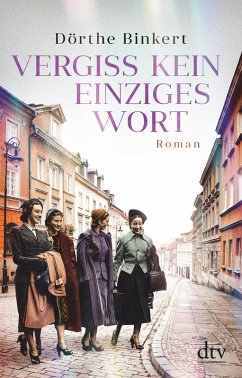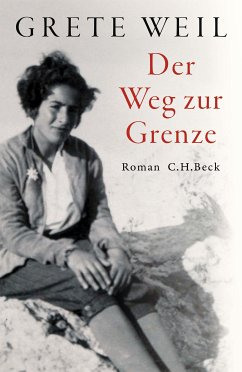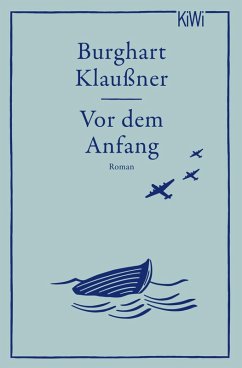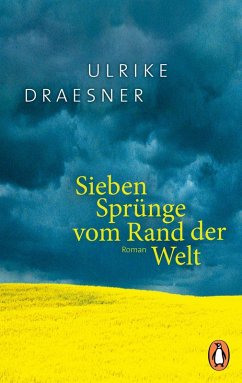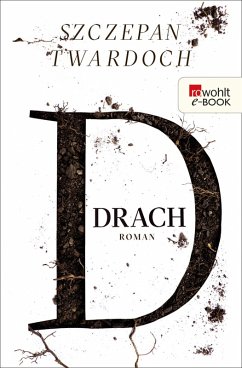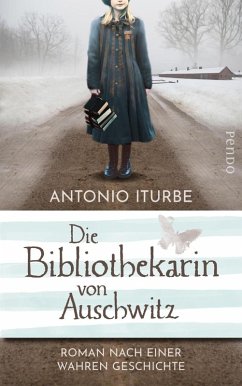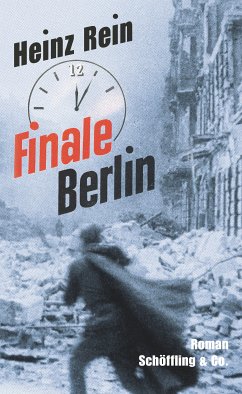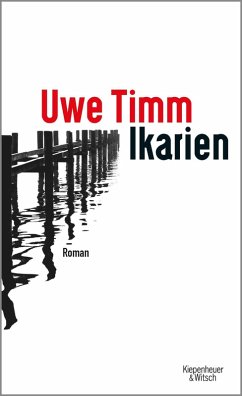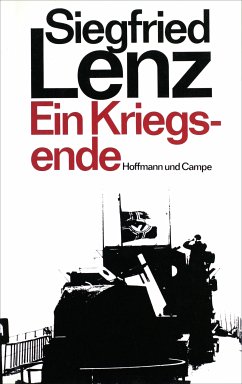Sofort per Download lieferbar
Statt: 24,00 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)






Der alte Mann, eine Berühmtheit, Nobelpreisträger, verlässt mit seiner Frau das Sanatorium, wo beide Erholung gesucht haben, und wird mit militärischem Begleitschutz zum Zug gebracht. Doch es ist März 1945, das Sanatorium Dr. Weidner liegt im eben zerstörten Dresden und der Zug fährt nach Osten. Gerhart und Margarete Hauptmann nämlich wollen nirgendwo anders hin als nach Schlesien, in ihre Villa "Wiesenstein", ein prächtiges Anwesen im Riesengebirge. Dort wollen sie ihr immer noch luxuriöses Leben weiterleben, in einer hinreißend schönen Landschaft, mit eigenem Masseur und Zofe, Bu...
Der alte Mann, eine Berühmtheit, Nobelpreisträger, verlässt mit seiner Frau das Sanatorium, wo beide Erholung gesucht haben, und wird mit militärischem Begleitschutz zum Zug gebracht. Doch es ist März 1945, das Sanatorium Dr. Weidner liegt im eben zerstörten Dresden und der Zug fährt nach Osten. Gerhart und Margarete Hauptmann nämlich wollen nirgendwo anders hin als nach Schlesien, in ihre Villa "Wiesenstein", ein prächtiges Anwesen im Riesengebirge. Dort wollen sie ihr immer noch luxuriöses Leben weiterleben, in einer hinreißend schönen Landschaft, mit eigenem Masseur und Zofe, Butler und Gärtner, Köchin und Sekretärin - inmitten der Barbarei. Aber war es die richtige Entscheidung? Überhaupt im Dritten Reich zu bleiben? Und was war der Preis dafür? Können sie und ihre Entourage unbehelligt leben, jetzt, da der Krieg allmählich verloren ist, russische Truppen und polnische Milizen kommen? Und das alte Schlesien untergeht? Hans Pleschinski erzählt erschütternd und farbig, episodenreich und spannend vom großen, genialen Gerhart Hauptmann, von Liebe und Hoffnung, Verzweiflung und Angst. Er erzählt vom Ende des Krieges, dem Verlust von Heimat, von der großen Flucht, vergegenwärtigt eine Welt, die für uns verloren ist, und das Werk Gerhart Hauptmanns, auch mit unbekannten Tagebuchnotizen. "Wiesenstein" ist die Geschichte eines irrend-liebenden Genies und einer untergehenden und sich doch dagegenstemmenden Welt. Ein überwältigender Roman.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 3.99MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
Hans Pleschinski, geboren 1956, lebt als freier Autor in München. Er veröffentlichte u. a. die Romane ¿Leichtes Licht¿ (C.H.Beck, 2005), ¿Ludwigshöhe¿ (C.H.Beck, 2008) und ¿Königsallee¿ (C.H.Beck, 62013), der ein Bestseller wurde, und gab die Briefe der Madame de Pompadour, eine Auswahl aus dem Tagebuch des Herzogs von Croÿ und die Lebenserinnerungen der Else Sohn-Rethel heraus. Zuletzt erhielt er u. a. den Hannelore-Greve-Literaturpreis (2006), den Nicolas-Born-Preis (2008) und wurde 2012 zum Chevalier des Arts et des Lettres der Republik Frankreich ernannt. 2014 erhielt er den Literaturpreis der Stadt München und den Niederrheinischen Literaturpreis. Hans Pleschinski ist Mitglied der Bayerischen Akademie der Künste.
Produktdetails
- Verlag: C.H. Beck
- Seitenzahl: 552
- Erscheinungstermin: 26. Januar 2018
- Deutsch
- ISBN-13: 9783406700620
- Artikelnr.: 50277111
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.04.2018
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.04.2018Der Opel Blitz kroch über die Mordgrundbrücke
Der letzte große Geist des deutschen Geniekults: Hans Pleschinski erzählt das Leben des Dramatikers Gerhart Hauptmanns
Mit dem Roman "Königsallee" hatte Hans Pleschinski 2013 großen Erfolg. Eigentlich ging es nur um eine Nebensache: Thomas Manns "letzte Leidenschaft" beim fiktiven unverhofften Wiedersehen mit einem Geliebten. Wie unversehens aber ließ die Kunst des witzigen und geschichtsbewussten Erzählers auch das Lebensgefühl der frühen Bundesrepublik erstehen.
Nun legt Hans Pleschinski einen Roman über Gerhart Hauptmann vor, den anderen Anwärter auf den Thron des deutschen Dichterkönigs im zwanzigsten Jahrhundert. Ein Gegenstück zu "Königsallee" konnte
Der letzte große Geist des deutschen Geniekults: Hans Pleschinski erzählt das Leben des Dramatikers Gerhart Hauptmanns
Mit dem Roman "Königsallee" hatte Hans Pleschinski 2013 großen Erfolg. Eigentlich ging es nur um eine Nebensache: Thomas Manns "letzte Leidenschaft" beim fiktiven unverhofften Wiedersehen mit einem Geliebten. Wie unversehens aber ließ die Kunst des witzigen und geschichtsbewussten Erzählers auch das Lebensgefühl der frühen Bundesrepublik erstehen.
Nun legt Hans Pleschinski einen Roman über Gerhart Hauptmann vor, den anderen Anwärter auf den Thron des deutschen Dichterkönigs im zwanzigsten Jahrhundert. Ein Gegenstück zu "Königsallee" konnte
Mehr anzeigen
daraus aber nicht werden, dazu sind die Voraussetzungen zu verschieden. Thomas Manns Ruhm als Romancier wie als politisch engagierter Akteur der europäisch-amerikanischen Geschichte strahlt nach wie vor hell. Dagegen wurde in Hauptmanns Fall schon anlässlich der zum 150. Geburtstag 2012 von Peter Sprengel vorgelegten Biographie gefragt, ob der Dichter nicht schon weitgehend vergessen sei.
Unzweifelhaft ist Hauptmann als Autor im Habitus des deutschen Geniekults längst historisch geworden. Den meisten Jüngeren ist der Name nicht mehr geläufig. Das schmälert Hauptmanns Verdienste nicht. Manchen Avantgardisten hat der Schimmel noch früher ereilt. Ein Dramatiker muss für das Publikum seiner Zeit schreiben, wenn er Erfolg haben will, und das wollte Hauptmann zweifellos.
Hans Pleschinski hat angesichts dieser Lage der Rezeption ein Verfahren entwickelt, das historische Distanz kenntlich machen soll, gleichzeitig aber Vergegenwärtigung ermöglichen. Das zeigt sich bereits in dem verblüffenden ersten Satz der Erzählung. "Der Opel Blitz kroch über die Mordgrundbrücke." Der Erzähler schildert den einstmals legendären Krankentransporter als ein Dingsymbol, an dem die raumzeitliche Ausgangssituation entfaltet wird. Das Gefährt ist notdürftig instand gesetzt, mangels Benzin läuft es mit einem Holzvergaser.
Es ist März 1945, und Deutschland ist am Ende. Der Wagen ist mit Sondergenehmigung der Gauleitung von Pirna nach Dresden gekommen, um einen berühmten Mann abzuholen. Einer der jungen Fahrzeugführer kennt ein Drama des Dichters, "Die Weber"; für seine Mutter, so berichtet er, ist der Nobelpreisträger "der letzte große Geist Deutschlands". Etwas von solcher Verehrung, wenngleich nicht ohne kritische Töne, erkennt der Leser von vornherein in Hans Pleschinskis Text.
Gerhart Hauptmann und seine Frau Margarete haben sich einer Kur in einem noblen Sanatorium unterzogen. Währenddessen wurde Dresden zerstört, aus Schlesien hat die Flucht eingesetzt. Trotzdem wollen die Hauptmanns unbedingt dorthin zurück, in ihre Villa im Riesengebirge. So führt sie der Weg durch das ganze grausame Elend in Schlesien, über einen "mit Leichen gedüngten Boden", den Pleschinski in beinahe barocker Fülle beschreibt.
Dabei gerät die Handlungsführung zeitweise außer Proportion. Zu gewaltig erscheint die Kulisse im Verhältnis zu denen, die nach Hause wollen. Daher könnte es so scheinen, als sollte den exzentrischen Hauptmanns das Bedürfnis nach gutem Leben als Schuld drastisch vor Augen geführt werden.
Empörte Schuldzuweisung ist aber so wenig Pleschinskis Absicht wie eine neue Deutung der Rolle Hauptmanns im Nationalsozialismus. Es bleibt bei dem Motivkomplex der partiellen Übereinstimmung mit nationalsozialistischer Ideologie, der mythisch unterlegten Heimatbindung und des Opportunismus aus Sorge um den Lebensstandard. Auf der anderen Seite aber steht ein Werk, das den Nazis gar nicht passte und auch eine wie immer heimliche Verweigerung des Mitmachens.
Gegen jede Wahrscheinlichkeit erreichen die Hauptmanns ihr Anwesen, eigentlich eher eine "Schutz- und Trutzburg", gebautes Rückzugsbedürfnis. Der als Dramatiker der Unterschicht berühmt und vermögend wurde, führte hinter dicken Mauern ein aristokratisches Leben mit Dienstboten und strenger Etikette, zum Diner hatten die Gäste Abendkleidung zu tragen.
Zum Charakter dieser Villa Wiesenstein gehört auch die Lage in der schlesischen Landschaft. Hauptmanns mythisch aufgeladenes Landschaftserlebnis, in dem jeder Grashalm das Deutsche repräsentiere, spielte zweifellos auch eine Rolle bei seiner Entscheidung, Deutschland nicht zu verlassen. Nicht zufällig hat der Erzähler von Manns "Doktor Faustus" die Romantisierung der Landschaft als bedenklichen vernunftwidrigen Zug des deutschen Wesens beschrieben. Zu Recht nennt Pleschinski den Roman "Wiesenstein": In dem Haus spiegelt sich umfassend Hauptmanns feierliches Lebensgefühl, in dem sich eine mythische Siegesgewissheit mit Angst vor der Welt paaren konnte. Seine letzten Worte vor seinem Tod im Juni 1946 sollen gelautet haben: "Bin ich noch in meinem Haus?"
Pleschinski erzählt die Geschichte des "liebend irrenden" Dichters mit offensichtlicher Entdeckerfreude, gerade was das mythisch beseelte Spätwerk angeht. Daran will er den Leser in langen Zitaten teilhaben lassen, wofür der Erzählanlass oft künstlich geschaffen wird. Auch wollte er nicht darauf verzichten, aus den unveröffentlichten Tagebüchern der Hauptmanns zu zitieren. Auch war es Pleschinskis Ehrgeiz, die Figurenrede weitgehend aus authentischen Dokumenten zu entwickeln, die einmontiert oder in wörtlicher Rede nachgeahmt werden bis hin zum Stottern des Dichters. Das klingt dann gelegentlich ziemlich hölzern. Bei der Kürze der erzählten Zeit, nur etwas mehr als Hauptmanns letztes Jahr, musste schließlich die Möglichkeit für die Episoden aus dem früheren Leben Hauptmanns in manchmal recht konstruiert wirkenden Zusammenkünften von Nebenfiguren je neu geschaffen werden.
Die gewählte Konzeption fordert also dem Leser einiges an Konzentration und Geduld ab und beeinträchtigt die Lesbarkeit und Flüssigkeit der Erzählung, die Pleschinskis Bücher bisher ausgezeichnet hat. Der Roman basiert auf einer gewaltigen Recherche- und Energieleistung, und der Leser wird Respekt davor haben, dass Pleschinski es sich in der Rekonstruktion von Hauptmanns Welt und Zeit nicht einfach gemacht hat. Im Übrigen gibt es in "Wiesenstein" viele Episoden, in denen man den gewitzten, warmherzigen und unterhaltsamen Erzähler Hans Pleschinski wiedererkennt.
FRIEDMAR APEL
Hans Pleschinski:
"Wiesenstein".
Roman.
Verlag C. H. Beck, München 2018. 552 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Unzweifelhaft ist Hauptmann als Autor im Habitus des deutschen Geniekults längst historisch geworden. Den meisten Jüngeren ist der Name nicht mehr geläufig. Das schmälert Hauptmanns Verdienste nicht. Manchen Avantgardisten hat der Schimmel noch früher ereilt. Ein Dramatiker muss für das Publikum seiner Zeit schreiben, wenn er Erfolg haben will, und das wollte Hauptmann zweifellos.
Hans Pleschinski hat angesichts dieser Lage der Rezeption ein Verfahren entwickelt, das historische Distanz kenntlich machen soll, gleichzeitig aber Vergegenwärtigung ermöglichen. Das zeigt sich bereits in dem verblüffenden ersten Satz der Erzählung. "Der Opel Blitz kroch über die Mordgrundbrücke." Der Erzähler schildert den einstmals legendären Krankentransporter als ein Dingsymbol, an dem die raumzeitliche Ausgangssituation entfaltet wird. Das Gefährt ist notdürftig instand gesetzt, mangels Benzin läuft es mit einem Holzvergaser.
Es ist März 1945, und Deutschland ist am Ende. Der Wagen ist mit Sondergenehmigung der Gauleitung von Pirna nach Dresden gekommen, um einen berühmten Mann abzuholen. Einer der jungen Fahrzeugführer kennt ein Drama des Dichters, "Die Weber"; für seine Mutter, so berichtet er, ist der Nobelpreisträger "der letzte große Geist Deutschlands". Etwas von solcher Verehrung, wenngleich nicht ohne kritische Töne, erkennt der Leser von vornherein in Hans Pleschinskis Text.
Gerhart Hauptmann und seine Frau Margarete haben sich einer Kur in einem noblen Sanatorium unterzogen. Währenddessen wurde Dresden zerstört, aus Schlesien hat die Flucht eingesetzt. Trotzdem wollen die Hauptmanns unbedingt dorthin zurück, in ihre Villa im Riesengebirge. So führt sie der Weg durch das ganze grausame Elend in Schlesien, über einen "mit Leichen gedüngten Boden", den Pleschinski in beinahe barocker Fülle beschreibt.
Dabei gerät die Handlungsführung zeitweise außer Proportion. Zu gewaltig erscheint die Kulisse im Verhältnis zu denen, die nach Hause wollen. Daher könnte es so scheinen, als sollte den exzentrischen Hauptmanns das Bedürfnis nach gutem Leben als Schuld drastisch vor Augen geführt werden.
Empörte Schuldzuweisung ist aber so wenig Pleschinskis Absicht wie eine neue Deutung der Rolle Hauptmanns im Nationalsozialismus. Es bleibt bei dem Motivkomplex der partiellen Übereinstimmung mit nationalsozialistischer Ideologie, der mythisch unterlegten Heimatbindung und des Opportunismus aus Sorge um den Lebensstandard. Auf der anderen Seite aber steht ein Werk, das den Nazis gar nicht passte und auch eine wie immer heimliche Verweigerung des Mitmachens.
Gegen jede Wahrscheinlichkeit erreichen die Hauptmanns ihr Anwesen, eigentlich eher eine "Schutz- und Trutzburg", gebautes Rückzugsbedürfnis. Der als Dramatiker der Unterschicht berühmt und vermögend wurde, führte hinter dicken Mauern ein aristokratisches Leben mit Dienstboten und strenger Etikette, zum Diner hatten die Gäste Abendkleidung zu tragen.
Zum Charakter dieser Villa Wiesenstein gehört auch die Lage in der schlesischen Landschaft. Hauptmanns mythisch aufgeladenes Landschaftserlebnis, in dem jeder Grashalm das Deutsche repräsentiere, spielte zweifellos auch eine Rolle bei seiner Entscheidung, Deutschland nicht zu verlassen. Nicht zufällig hat der Erzähler von Manns "Doktor Faustus" die Romantisierung der Landschaft als bedenklichen vernunftwidrigen Zug des deutschen Wesens beschrieben. Zu Recht nennt Pleschinski den Roman "Wiesenstein": In dem Haus spiegelt sich umfassend Hauptmanns feierliches Lebensgefühl, in dem sich eine mythische Siegesgewissheit mit Angst vor der Welt paaren konnte. Seine letzten Worte vor seinem Tod im Juni 1946 sollen gelautet haben: "Bin ich noch in meinem Haus?"
Pleschinski erzählt die Geschichte des "liebend irrenden" Dichters mit offensichtlicher Entdeckerfreude, gerade was das mythisch beseelte Spätwerk angeht. Daran will er den Leser in langen Zitaten teilhaben lassen, wofür der Erzählanlass oft künstlich geschaffen wird. Auch wollte er nicht darauf verzichten, aus den unveröffentlichten Tagebüchern der Hauptmanns zu zitieren. Auch war es Pleschinskis Ehrgeiz, die Figurenrede weitgehend aus authentischen Dokumenten zu entwickeln, die einmontiert oder in wörtlicher Rede nachgeahmt werden bis hin zum Stottern des Dichters. Das klingt dann gelegentlich ziemlich hölzern. Bei der Kürze der erzählten Zeit, nur etwas mehr als Hauptmanns letztes Jahr, musste schließlich die Möglichkeit für die Episoden aus dem früheren Leben Hauptmanns in manchmal recht konstruiert wirkenden Zusammenkünften von Nebenfiguren je neu geschaffen werden.
Die gewählte Konzeption fordert also dem Leser einiges an Konzentration und Geduld ab und beeinträchtigt die Lesbarkeit und Flüssigkeit der Erzählung, die Pleschinskis Bücher bisher ausgezeichnet hat. Der Roman basiert auf einer gewaltigen Recherche- und Energieleistung, und der Leser wird Respekt davor haben, dass Pleschinski es sich in der Rekonstruktion von Hauptmanns Welt und Zeit nicht einfach gemacht hat. Im Übrigen gibt es in "Wiesenstein" viele Episoden, in denen man den gewitzten, warmherzigen und unterhaltsamen Erzähler Hans Pleschinski wiedererkennt.
FRIEDMAR APEL
Hans Pleschinski:
"Wiesenstein".
Roman.
Verlag C. H. Beck, München 2018. 552 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
"Ein großes Epos über den Untergang einer Epoche, einer Landschaft, eines großen Schriftstellers, das bei aller Trauer und Wehmut auch ein Stück Hoffnung enthält."
Martin Halter, Die Reihnpfalz, 14. Juli 2018
"Überaus präzises, höchst lebendiges Porträt (...) Eine subtile, profunde Studie"
Mannheimer Morgen, 18. Juli 2018
"(Ein) großartiger Roman."
Stephan Opitz, Schleswig-Holstein am Wochenende, Mai 2018
"Ein fast schon vergessener Raum mit spektakulärem Ambiente und skurrilem Personal kann jenen Überschuss an poetischer Energie evozieren, der das Schreiben eines guten Romans erst möglich macht. Eine solche Location hat der Münchner Autor Hans Pleschinski (...)
Martin Halter, Die Reihnpfalz, 14. Juli 2018
"Überaus präzises, höchst lebendiges Porträt (...) Eine subtile, profunde Studie"
Mannheimer Morgen, 18. Juli 2018
"(Ein) großartiger Roman."
Stephan Opitz, Schleswig-Holstein am Wochenende, Mai 2018
"Ein fast schon vergessener Raum mit spektakulärem Ambiente und skurrilem Personal kann jenen Überschuss an poetischer Energie evozieren, der das Schreiben eines guten Romans erst möglich macht. Eine solche Location hat der Münchner Autor Hans Pleschinski (...)
Mehr anzeigen
entdeckt."
Martin Doerry, Literatur SPIEGEL, 16. Juni 2018
"Großartig, der neue Roman von Hans Pleschinski!!"
Denis Scheck, SWR Fernsehen, 26. April 2018
"Pleschinski macht daraus eine Auseinandersetzung mit der Rolle eines großen Dichters in der NS-Zeit und mit dem, was Flucht und Aufgabe der Heimat bedeuten."
Rainer Moritz, Chrismon, 5/2018
"Ein souverän erzähltes Buch über die Leistungen, Verdienste, Halbheiten, Irrtümer und Illusionen eines großen Dichters (...) und zugleich ein packendes Zeitbild."
Klaus Belli, Lesart, Frühjahr 2018
"Dieser Roman ist etwas Besonderes. Ein Fall von enthusiastischer Überwältigung."
Peter von Becker, Tagesspiegel, 18. März 2018
"Ein großer Roman über das Ende eines großen Schriftstellers - und gleichzeitig über das Ende des Zweiten Weltkrieges und das Ende Schlesiens."
Anne-Dore Krohn, Kulturradio rbb, 3. März 2018
"Zum Versinken schön ist dieses Buch einerseits; aber zum Versinken überhaupt angesichts der menschlichen Moral."
Peter Pisa, Kurier Wien, 10. Februar 2018
"Ein ehrenwerter Versuch, noch einmal auf Gerhart Hauptmann aufmerksam zu machen. Wer weiß schon etwas über diese wunderbare Villa Wiesenstein? Ein interessantes Buch, es ist wert, es zu lesen."
Sigrid Löffler, Radio Bremen, 4. Februar 2018
"Ein faszinierender Roman (...) Damit erinnert 'Wiesenstein' nicht zuletzt an ein Lebenselixier, das zu allen Zeiten nötig ist. Und, kein geringes Verdienst, er macht Lust auf mehr von Gerhart Hauptmann."
Tilman Krause, Die WELT, 27. Januar 2018
"Hans Pleschinski bändigt den Stoff meisterhaft. Sein tiefes Hintergrundwissen entrollt er mit einer Souveränität, die elegant und mühelos wirkt, und doch zittert nach der Lektüre das eigene Gedankengerüst angesichts des Neuen, das hier so furios erzählt wird."
Annemarie Stoltenberg, NDR, 23. Januar 2018
Martin Doerry, Literatur SPIEGEL, 16. Juni 2018
"Großartig, der neue Roman von Hans Pleschinski!!"
Denis Scheck, SWR Fernsehen, 26. April 2018
"Pleschinski macht daraus eine Auseinandersetzung mit der Rolle eines großen Dichters in der NS-Zeit und mit dem, was Flucht und Aufgabe der Heimat bedeuten."
Rainer Moritz, Chrismon, 5/2018
"Ein souverän erzähltes Buch über die Leistungen, Verdienste, Halbheiten, Irrtümer und Illusionen eines großen Dichters (...) und zugleich ein packendes Zeitbild."
Klaus Belli, Lesart, Frühjahr 2018
"Dieser Roman ist etwas Besonderes. Ein Fall von enthusiastischer Überwältigung."
Peter von Becker, Tagesspiegel, 18. März 2018
"Ein großer Roman über das Ende eines großen Schriftstellers - und gleichzeitig über das Ende des Zweiten Weltkrieges und das Ende Schlesiens."
Anne-Dore Krohn, Kulturradio rbb, 3. März 2018
"Zum Versinken schön ist dieses Buch einerseits; aber zum Versinken überhaupt angesichts der menschlichen Moral."
Peter Pisa, Kurier Wien, 10. Februar 2018
"Ein ehrenwerter Versuch, noch einmal auf Gerhart Hauptmann aufmerksam zu machen. Wer weiß schon etwas über diese wunderbare Villa Wiesenstein? Ein interessantes Buch, es ist wert, es zu lesen."
Sigrid Löffler, Radio Bremen, 4. Februar 2018
"Ein faszinierender Roman (...) Damit erinnert 'Wiesenstein' nicht zuletzt an ein Lebenselixier, das zu allen Zeiten nötig ist. Und, kein geringes Verdienst, er macht Lust auf mehr von Gerhart Hauptmann."
Tilman Krause, Die WELT, 27. Januar 2018
"Hans Pleschinski bändigt den Stoff meisterhaft. Sein tiefes Hintergrundwissen entrollt er mit einer Souveränität, die elegant und mühelos wirkt, und doch zittert nach der Lektüre das eigene Gedankengerüst angesichts des Neuen, das hier so furios erzählt wird."
Annemarie Stoltenberg, NDR, 23. Januar 2018
Schließen
Gebundenes Buch
Hans Pleschinsiki erzählt in seinem Roman Wiesenstein die letzten beiden Lebensjahre von 1945-1946 von Gerhard Hauptmann in seiner Villa Wiesenstein in Agnetendorf in Schlesien. Er war berühmter deutscher Dramatiker und Schriftsteller, der 1912 den Nobelpreis für Literatur …
Mehr
Hans Pleschinsiki erzählt in seinem Roman Wiesenstein die letzten beiden Lebensjahre von 1945-1946 von Gerhard Hauptmann in seiner Villa Wiesenstein in Agnetendorf in Schlesien. Er war berühmter deutscher Dramatiker und Schriftsteller, der 1912 den Nobelpreis für Literatur erhielt.
Die Geschichte ist nicht leicht zu lesen, etwas zu ausschweifend, sie fordert große Aufmerksamkeit.
Der Schreibstil ist klar, Bildhaft und kraftvoll, mit seinen Figuren wurde ich nicht sehr warm. Sehr gut sind die Flucht , Vertreibung, die Angst und Hoffnungslosigkeit der Bevölkerung beschrieben.
Gerhard Hauptmann ist nach einem Sanatorium Aufenthalt und der Bombardierung Dresdens mit seiner Frau in ihre Villa gezogen. Hier leben sie mit ihren Angestellten, wie auf einer einsamen Insel, während draußen der Krieg tobt und die Menschen vor den Russen fliehen. Sie leben ihr Leben, geben Empfänge, essen und trinken ihnen geht es gut. Gerhard und seine Frau Margarete waren mir sehr unsympathisch, sehr von sich eingenommen und überzeugt das ihnen nichts passiert,
Die einzigsten Menschen für die ich Sympathie empfand waren ihre Angestellten, durch diese bekam man Einblicke in Hauptmanns Leben. Das Ehepaar nutzte die Gunst seiner Berühmtheit, mit ihren Beziehungen zu den Nazis, Polen, Russen und anderen Nationen, sie hängten ihr Mäntelchen nach dem Wind, sie waren und blieben Privilegierte und genossen den Schutz der vielen Machthaber, sogar noch als Hauptmann starb, setzte man sich für ihn ein.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Der alte Mann und das Gebirge: Das Riesengebirge in Niederschlesien, genauer gesagt. Dort haust der alte Mann, nämlich der berühmte Literaturnobelpreisträger Gerhart Hauptmann, zum Ende des zweiten Weltkriegs und will auch nicht fort aus seiner schlesischen Heimat, obwohl er nicht nur …
Mehr
Der alte Mann und das Gebirge: Das Riesengebirge in Niederschlesien, genauer gesagt. Dort haust der alte Mann, nämlich der berühmte Literaturnobelpreisträger Gerhart Hauptmann, zum Ende des zweiten Weltkriegs und will auch nicht fort aus seiner schlesischen Heimat, obwohl er nicht nur dort bekannt ist wie ein bunter Hund. Auch, wenn dem nationalsozialistischen Deutschland schon das Feuer unter dem Allerwertesten brennt - Hauptmann gilt als eine der Ikonen Deutschlands und wird auch jetzt noch hofiert und gut versorgt - wie es übrigens unter allen Regierungen der Fall war.
Hauptmann ist kein Nazi, aber er hat es sich bequem gemacht im Regime, kann er doch in seinem geliebten Haus Wiesenstein wohnen bleiben und wird mit allem Komfort versorgt, den man sich nur denken kann. Dafür erwartet das Regime das ein oder andere flammende Statement zur rechten Zeit - nun ja, aus Hauptmanns Sicht kein allzu großes Opfer.
"Wiesenstein", der Roman, der nach Hauptmanns Haus, nach seiner Trutzburg sozusagen - denn genau als solche sieht er sein in jüngeren Jahren erworbenes und selbst geschaffenes bzw. zumindest erweitertes Heim - gibt die aller- aber wirklich allerletzten Zuckungen des Nationalsozialistischen Deutschland wider und beginnt unmittelbar nach der Bombardierung Dresdens, die Hauptmann ausgerechnet in der Stadt bzw. in deren unmittelbaren Umgebung erleben musste.
Jetzt soll es heimgehen und so zieht der bereits bettlägerige Hauptmann gemeinsam mit seiner Frau Margarete in Begleitung der Sekretärin Annie Pollak und des sich gerade erst angedienten Masseurs Paul Metzkow entgegen allen Flüchtlingsströmen alle düsteren Vorhersagen ignorierend gen Osten: Nur nach Hause, lautet die Devise! Und zum ersten Mal kommt ein Bedürfnis zum Vorschein, das sich wie ein roter Faden durch den ganzen Roman zieht: die Menschen in seiner Umgebung, hier also Annie und Paul, erhoffen sich Schutz durch die Nähe zu Gerhart Hauptmann, Sicherheit vor feindlichen Truppen, ebenso aber eine gewisse Gewährleistung von Komfort - was 1945 vor allem bedeutet, satt zu werden und etwas zum Anziehen zu haben, vielleicht sogar zum Wechseln. Und daheim auf Wiesenstein wartet noch ein ganzes (naja, kleines, aber immerhin) Bataillon von Bediensteten mit denselben Erwartungen.
Der Hauptteil des Romans, auf Wiesenstein, hat etwas Unwirkliches, ja Groteskes. Autor Hans Pleschinski vermag diese Endzeitstimmung, die auch in Haus Wiesenstein herrschte, trotz einiger Längen und Umständlichkeiten, die ich empfunden habe, unglaublich kraftvoll und dicht, mit einer starken Präsenz wiederzugeben. Fast empfand ich mich als Teil der Hauptmann'schen Entourage. Das "normale" Leben, auch wenn es das eines alten, ja sterbenden Mannes und seines Umfelds ist, in harten Zeiten und in einer Gegend, die quasi schutzlos ist, zumindest im Verlauf des Romans dazu wird - das hat etwas sehr, sehr Frappierendes, betroffen machendes.
Ein kluger, unglaublich umfangreich recherchierter Roman, der dem Thema dank eindringlicher Schilderung eine kraftvolle Präsenz einzuhauchen vermag! Ja, es gibt Passagen, in denen Hauptmanns Werke seitenweise zitiert werden. Ja, es gibt Passagen, in denen der Meister parodiert, oder vielmehr: bloßgestellt wird. Ja, diese Teile fügen sich nahtlos in den Roman. Nein, ich habe sie nicht gerne gelesen, überhaupt nicht gerne.
Aber ich muss auch nicht jede Kleinigkeit dieses absolut opulenten Werkes, nein: Meisterwerkes schätzen, um es in seiner Gesamtheit würdigen zu können. Und das tue ich hiermit und empfehle es jedem weiter, der Romane über signifikante historische Personen und Entwicklungen so liebt wie ich. Die Lektüre ist eine wahre Herausforderung, aber was für eine! Ich jedenfalls knie nieder vor einem Meilenstein der deutschen Literatur!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Bin ich noch in meinem Haus?
Das schon recht betagte Ehepaar Gerhart und Margarete Hauptmann reisen im März 1945 zu ihrer Villa Wiesenstein im Siebengebirge. Mit von der Partie der Masseur Paul Metzkow, und die Sekretärin Annie Pollak, aus deren Sicht und Erzählungen erfährt …
Mehr
Bin ich noch in meinem Haus?
Das schon recht betagte Ehepaar Gerhart und Margarete Hauptmann reisen im März 1945 zu ihrer Villa Wiesenstein im Siebengebirge. Mit von der Partie der Masseur Paul Metzkow, und die Sekretärin Annie Pollak, aus deren Sicht und Erzählungen erfährt man vieles über Hauptmanns Leben, auch längst vergessene Werke des Dramatikers werden zitiert. Viele weitere Charaktere tauchen im Buch auf, und bereichern es gekonnt.
Das Leben Hauptmanns allein hätte nicht für diesen Roman gereicht, denn teilweise war es sehr anstrengend sich mit Hauptmanns Art auseinanderzusetzen. Er war sehr auf seinen Vorteil bedacht und lebte sein Leben ohne nach unten zu sehen, zu den Menschen denen es schlechter ging als ihm, denn was sollte ihm das bringen? Auf seinem Anwesen Wiesenstein scheint die Zeit still zu stehen, die Kriegswirren scheinen dort gar nicht präsent.
Durch den Roman von Hans Pleschinski wird dem Leser nicht nur ein tiefer Einblick ins Leben des Literaten geboten, es ist auch ein anschauliches Stück der deutschen Geschichte. Dieser Aspekt hat mich gefangen genommen, denn der Autor schafft es, das Bild sehr präsent wiederzugeben. Die Emotionen während des Lesens waren sehr intensiv.
Nach diesem Roman muss ich sagen, dass ich mein Bild von Gerhart Hauptmann, das ich durch die Schule habe, revidieren muss. Allein deshalb bin ich froh den Roman gelesen zu haben. Er bescherte mir eine neue Sicht und Denkweise zu diesem Thema.
Der Schreibstil ist ein wenig anstrengend, man muss konzentriert lesen, überfliegen geht nicht, daher brauchte ich für diesen Roman relativ lange., dennoch war es keine verschenkte Zeit, im Gegenteil!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Zu spät gekommen
Leider habe ich kurz vorher das Buch von Modick über Keyserling gelesen und muss sagen: „Keyserlings Geheimnis“ ist besser.
Ein guter Roman erzählt drei Geschichten. Der Roman Wiesenstein aber nur zwei, das letzte Lebensjahr von Gerhart Hauptmann und …
Mehr
Zu spät gekommen
Leider habe ich kurz vorher das Buch von Modick über Keyserling gelesen und muss sagen: „Keyserlings Geheimnis“ ist besser.
Ein guter Roman erzählt drei Geschichten. Der Roman Wiesenstein aber nur zwei, das letzte Lebensjahr von Gerhart Hauptmann und die Biographie Gerhart Hauptmanns mit Ausschnitten aus seinen Werken.
Letzteres gelingt überhaupt nicht. Während Modick laut Interview im Stile Keyserlings schreibt, zitiert Pleschinski in kursiver Schrift, aber keines der Zitate vermag Lust auf Hauptmanns Werk zu erzeugen. Dadurch wird dieses Buch 200 Seiten zu lang.
In den Jugendbüchern von Willi Fährmann habe ich früher von der Vertreibung aus den Ostgebieten gelesen, aber die Schilderung von der Villa Wiesenstein ist fast beeindruckender. Nachdem Hauptmann den Krieg während der Bombardierung Dresdens hautnah miterlebt hatte, zog der Krieg an Schlesien, also insbesondere am Hirschberger Tal, dem Wohnort Hauptmanns, ohne Kampfhandlungen vorüber. Wir erleben mit, wie die Bevölkerung östlich von Oder und Neiße um ihre Zukunft bangt und letztlich fliehen muss. Gerade dieser Kriegs- und Nachkriegsalltag macht das Buch doch lesenswert. Modicks Buch spielt 1901 und teilweise im Baltikum, noch weiter im Osten und zeitlich früher, kann dieses Thema also nicht behandeln.
Wegen der realistischen Kriegsdarstellung erhält dieses Buch 3 Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für