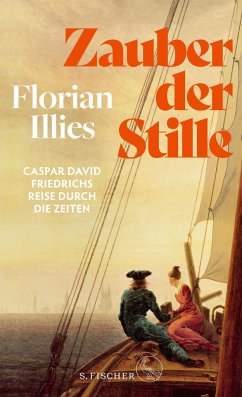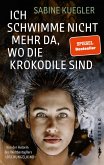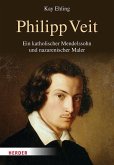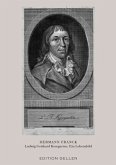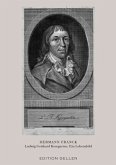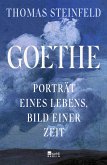»So elegant und mühelos erzählt. Dieses neue Buch von Florian Illies zu lesen, ist wie einen Billy-Wilder-Film zu schauen - einfach großartig.« Ferdinand von Schirach
Mit Florian Illies kann man Vergangenheit plötzlich als Gegenwart erleben. In »Zauber der Stille« breitet er erstmals die abenteuerlichen Geschichten Caspar David Friedrichs vor uns aus. Eine wilde Zeitreise zu dem Mann, der für die Deutschen die Sehnsucht erfand.
Friedrichs abendliche Himmel wecken seit Jahrhunderten die leidenschaftlichsten Gefühle: Goethe macht ihre Melancholie so rasend, dass er sie auf der Tischkante zerschlagen will, Walt Disney hingegen verliebt sich so heftig in sie, dass er sein »Bambi« nur durch Friedrich'sche Landschaften laufen lässt. Von Hitler so verehrt wie von Rainer Maria Rilke, von Stalin so gehasst wie von den 68ern, von der Mafia so heiß begehrt wie von Leni Riefenstahl - am Beispiel von Caspar David Friedrich werden in diesem mitreißend erzählten Buch 250 Jahredeutscher Geschichte sichtbar. Und Friedrich, der Maler, wird zu einem Menschen aus Fleisch und Blut.
Nach »1913« und »Liebe in Zeiten des Hasses« das dritte große historische Epochenportrait von Florian Illies.
Mit Florian Illies kann man Vergangenheit plötzlich als Gegenwart erleben. In »Zauber der Stille« breitet er erstmals die abenteuerlichen Geschichten Caspar David Friedrichs vor uns aus. Eine wilde Zeitreise zu dem Mann, der für die Deutschen die Sehnsucht erfand.
Friedrichs abendliche Himmel wecken seit Jahrhunderten die leidenschaftlichsten Gefühle: Goethe macht ihre Melancholie so rasend, dass er sie auf der Tischkante zerschlagen will, Walt Disney hingegen verliebt sich so heftig in sie, dass er sein »Bambi« nur durch Friedrich'sche Landschaften laufen lässt. Von Hitler so verehrt wie von Rainer Maria Rilke, von Stalin so gehasst wie von den 68ern, von der Mafia so heiß begehrt wie von Leni Riefenstahl - am Beispiel von Caspar David Friedrich werden in diesem mitreißend erzählten Buch 250 Jahredeutscher Geschichte sichtbar. Und Friedrich, der Maler, wird zu einem Menschen aus Fleisch und Blut.
Nach »1913« und »Liebe in Zeiten des Hasses« das dritte große historische Epochenportrait von Florian Illies.
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
"Gegensätze ziehen sich an", sagt man. Florian Illies' und Caspar David Friedrich sind ein gutes Beispiel dafür, findet Rezensent Tilman Krause. Der eine ein spirituell veranlagter, in sich gekehrter Einzelgänger, bereits zu Lebzeiten vergessen, mit einer Biografie, die nicht wirklich zu einer spannenenden Erzählung gereicht. Der Andere ein Star der deutschen Literaturszene, einer, der durchaus ab und an Gefahr läuft ein "Thomas Gottschalk der Kunstgeschichtsschreibung" oder auch der Geschichtsschreibung im Allgemeinen zu werden, wie Krause es liebevoll spöttelnd ausdrückt. Viel Gutes entsteht aus der Verbindung dieser Gegensätze, findet der Rezensent: Geschickt, einfühlsam, effektvoll schreibt Illies über den Maler und vor allem dessen Rezeption, denn diese ist es, die die interessanten Fragen aufwirft - Fragen, die Illies gern stellt, die er sich jedoch nicht oder nur ansatzweise zu beantworten anmaßt. Mit intellektuellem Interpretationsgeschwafel hält sich der Autor erfreulicherweise zurück, so Krause. Lässig und unterhaltsam ist sein Stil, manchmal vielleicht ein wenig allzu unterhaltsam. Großartig ist dieses Buch jedoch vor allem dort, wo der Autor analysiert, wo er sich dem "Zauber der Stille" hingibt und seiner Demut und Liebe zu Friedrichs Malereien Ausdruck verleiht. Diese Passagen sind es, in denen der Funke der Leidenschaft auf den Leser überspringt, so der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Florian Illies feiert den Maler Caspar David Friedrich und das Wunder der Kunst in „Zauber der Stille“
So elegant, so leicht, so umfassend gebildet und belesen, ohne all das oder die natürlich auch gründlichen Recherchen heraushängen zu lassen, fächert uns Florian Illies seit einigen Büchern bedeutende Jahre wie das Vorkriegsjahr 1913 auf und ganze Epochen wie die Dreißigerjahre in „Liebe in Zeiten des Hasses“. Schon um die Jahrtausendwende lieferte er mit „Generation Golf“ ein Porträt seiner Generation, den Teenagern der Achtziger, er brillierte als Kunsthistoriker, Kurator, Journalist, verirrte sich kurzzeitig als Verleger – und legt jetzt schon wieder eins dieser federleichten Bücher hin, die man wie süchtig liest und mit denen man durch die Zeiten fliegt. Der Untertitel sagt es: „Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten.“
Der dunkelste aller Romantiker feiert im nächsten Jahr seinen 250. Geburtstag, das wirft jetzt schon Schatten voraus, Ausstellungen, Bücher, und in diesen unruhigen, blutigen und entsetzlichen Zeiten ist Illies’ „Zauber der Stille“ ganz genau das: Zauber. Stille. Trost. Was für ein Wunderbuch. Und keine reine Schwärmerei, Illies gibt zu: „Manche Bilder von Caspar David Friedrich sind schwach, manche bemüht. Nein, nicht alles ist meisterlich bei ihm, er ist zum Glück kein Gott, sondern ein Mensch gewesen.“ Aber: „Die Natur hält kurz inne, wenn Friedrich sie sieht, sie hält den Atem an für ihn.“
Aufgeteilt ist das Buch in vier große Kapitel, die nach den Elementen benannt sind. Los geht es mit dem „Feuer“: Ich hatte keine Ahnung, wie viele der Friedrich-Bilder in verschiedenen Feuern (Weltausstellung, Krieg, Hausbrände) verloren gegangen sind! Da brennt während der Weltausstellung 1931 der Münchner Glaspalast ab, der wie die Titanic als unsinkbar, als unbrennbar galt – ach, immer dieser menschliche Hochmut! –, und in ihm gehen 110 der schönsten romantischen Werke zugrunde, darunter neun Gemälde von Caspar David Friedrich. Das ist der 6. Juni, der 56. Geburtstag von Thomas Mann, der in seinem Roman „Lotte in Weimar“ Adele Schopenhauer vom „himmlischen David Caspar Friedrich“ schwärmen lässt – das wissen wir, aber das Tagebuch, in dem er vermutlich vom Brand berichtet, hat er, schreibt Illies, „1945 im Garten seines Hauses im kalifornischen Exil von Pacific Palisades ganz unromantisch, nun ja, verbrannt“.
Diese raffinierte Querverbindung über zig Ecken und dieses lässig eingestreute „nun ja“ – das ist es, was die Bücher dieses Autors schier unwiderstehlich macht, keiner kann das so wie er. Ja, viel Information, natürlich, aber immer so, dass es wie selbstverständlich wirkt – ach, das wussten Sie nicht, dass 1901 das Geburtshaus des Malers in Greifswald niederbrannte? Nachkommen wohnten noch dort, Bilder lagerten da, und wieder verbrannten neun Gemälde. Und so kam es, dass dieser Maler allmählich komplett vergessen wurde.
Irgendwann landete eines seiner Bilder beim Kunsthändler Gurlitt, der „ständig abgebrannt“ (!) war und irgendwann Deutschland verließ. Friedrichs Bild nahm er mit – gut gemacht, denn seine Berliner Wohnung brennt 1943 aus. Und so geht es weiter mit den abenteuerlichen Geschichten der Bilder, die Jahrhunderte und Feuersbrünste überstanden haben, und man fragt sich: Woher weiß der das alles? Fiktion und Wirklichkeit verweben sich wohl aufs Allerschönste, und dazu gibt’s eine gehörige Dosis Zeitgeschichte – aber so elegant und oft im Präsens, mit wenigen Worten, dass wir glauben, in dieser Mondnacht dabei gewesen zu sein, und haben wir nicht selbst gesehen, wie sich der Maler eine blaue Blume ans Revers steckt?
Ach ja, und 1911 brennt in Dresden das Taschenbergpalais der Prinzessin Mathilde aus, und da hingen auch zwei Friedrichs… Das Feuer greift immer wieder auf die Werke dieses Malers über, vor allem im Zweiten Weltkrieg, in dem die Nazis den schmalen rothaarigen Mann als blonden deutschen Helden vereinnahmen, der das Vaterland gemalt hat. Das gefällt dem Führer, er versteckt Bilder, 1945 kommt die Rote Armee und brennt alles nieder, wieder brennen auch Friedrichs Gemälde. Was für ein nicht endendes Desaster.
Das nächste große Kapitel heißt „Wasser“, wir sehen: Illies erzählt nicht chronologisch, sondern an den Elementen entlang. Wasser hat Friedrich zeitlebens angezogen, die Elbe, auf die er vom Arbeitszimmer blickte, das Meer, er malt traumverlorene Hafenbilder und sein kühnstes, modernstes Bild, „Mönch am Meer“. So verloren steht der da in seiner Welt wie wir heute in der unseren. Keine Gewissheiten mehr. Die Besucher einer Berliner Ausstellung sind irritiert, das Bild wird verspottet, „alles untrügliche Anzeichen dafür, dass hier wirklich etwas Neuartiges zu sehen ist“, schreibt Illies, und er weiß, dass der Dichter Kleist in diesem Bild seine eigene Verlorenheit erkennt, und er spekuliert, dass der Mönch unter seiner Kutte vielleicht eine Pistole trägt, und er weiß, dass Bilder wie dieses Samuel Beckett zum Stück über das sinnlose Warten auf Godot angeregt haben.
„Die Romantik“, schreibt Illies, „ist auch eine Geschichte der Missverständnisse.“ Friedrichs Hoffnung, Professor an der Dresdner Akademie zu werden, zerschlägt sich – der Obrigkeit sind seine Bilder zu trübsinnig. „Diese Idioten“, merkt Illies kurz an und beschreibt, wie Friedrich seinen Kummer in das gewaltige Bild vom Eismeer hineinmalt, das ein Schiff zermalmt.
Es folgt das Kapitel „Erde“: Caspar David Friedrich wandert, immer wieder, er liebt seine Heimat, er malt Landschaften, erdverbunden, meist menschenleer. Aber, Achtung: nie naturgetreu. Nie einen konkreten Ort. Er fügt verschiedene Skizzen von verschiedenen Orten in einem Bild zusammen, es ist sinnlos, nach dieser Eiche, diesem Hafen zu suchen. Er baut sozusagen Collagen aus naturgetreuen Vorlagen – auch das: modern. Und Illies findet einen hinreißenden Kommentar dazu: „Caspar David Friedrich atmet Natur ein, um sie als Kunst wieder auszuatmen.“ Kann man es schöner sagen? Das Gemälde „Der einsame Baum“ ergreift Rainer Maria Rilke so sehr, dass er ein Gedicht darüber schreibt – es handelt vom Fühlen, nicht vom Begreifen, und Illies kommentiert: „Denn erst dann, wenn der Wille zum Begreifen besiegt ist, erst dann hat man überhaupt eine Chance, Friedrich wirklich zu verstehen.“ Durch mein Leben zieht sich ein Zitat, das der heiligen Teresa von Ávila zugeschrieben wird: „Es ist zu lehren, wie man nicht versteht.“ Einfach etwas zulassen. Läge ich diesem Autor nicht eh schon, nun ja, zu Füßen: spätestens jetzt.
Man durfte den Maler in seinem Atelier an der Elbe jederzeit aufsuchen und stören, es gab nur eine Ausnahme, erfährt man im Abschnitt „Luft“: „Jetzt malt er gerade Luft“, lässt Illies Friedrichs Frau Line sagen, „jetzt darf man ihn nicht stören, denn wissen Sie, Himmelmalen ist für ihn wie ein Gottesdienst.“ Illies ergänzt kühn: „Ja, genau so hat sie es gesagt.“ Wir glauben es sofort. Friedrich liebt den Himmel, die Gestirne, die Wolken, immer wieder malt er auch den Mond, den Nebel, und, schwärmt Illies: „Wer von seinen Zeitgenossen einmal das Glück hat, Caspar David Friedrich in die Augen zu blicken, der beschreibt deren Farbe hinterher als: himmelblau.“ Wolken malt er bei geschlossenen Fensterläden, er sieht sie mit dem erinnernden Auge, sie sind so weit weg – spiegeln sie einen Himmel, den es gibt? „Die Gefahr des Verlorenseins springt einem nicht entgegen aus Friedrichs Bildern, sie schleicht sich an (…). Vielleicht kann sich deshalb unsere Sehnsucht auch zweihundert Jahre später noch immer nicht daran sattsehen.“ So schreibt Illies, und im nächsten Satz lässt er die Luft wieder raus: „Keine Angst, komplizierter wird es nicht.“
Keine Angst: Nichts an diesem Buch ist kompliziert, nichts verstört, auch wenn das Wort „verstörend“ sehr oft vorkommt. Denn es sind verstörende Bilder, die dieser so gar nicht romantische große Maler der Romantik gemalt hat. Alles atmet eine ruhige Gelassenheit, die uns daran erinnert, dass wir auf dem Fluss der Zeit schwimmen, mit unseren Ängsten und Sehnsüchten und Erinnerungen, wie alle vor uns, wie alle nach uns. Die Künstler können es benennen, malen, in Töne und Bilder setzen. Die klugen und weitsichtigen Schriftsteller können es erklären, ohne es zu zerfasern. „Alles ist Stille“, hat Caspar David Friedrich gesagt, und Illies spürt, wie sich „die Stille auch über unsere unruhigen Augen legt“. Er hat ein Wunderbuch über das Wunder der Kunst geschrieben.
ELKE HEIDENREICH
Ja, viel Information, natürlich,
aber immer so, dass es wie
selbstverständlich wirkt
Nichts an diesem Buch verstört,
auch wenn das Wort „verstörend“
sehr oft vorkommt
„Jetzt malt er gerade Luft, jetzt darf man ihn nicht stören, denn wissen Sie, Himmelmalen ist für ihn wie ein Gottesdienst.“ Friedrich-Gemälde „Der Morgen“ (1821/1822).
Foto: Niedersachsisches Landesmuseum Hannover/Mauritius Images /SuperStock
Florian Illies: Zauber der Stille - Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2023. 256 Seiten, 25 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Im kommenden Jahr wird der 250. Geburtstag des Malers Caspar David Friedrich gefeiert. Eine Ausstellung in Hamburg und Florian Illies' Buch "Zauber der Stille" machen den Auftakt - und helfen, einen der rätselhaftesten Künstler der Moderne neu zu entdecken.
Von Niklas Maak
So sieht ein Aufbruch aus: Ein Mann und eine Frau sitzen auf einem Boot, der Wind fährt in die Segel, aus dem Dunst, als sei sie vielleicht auch nur eine Fata Morgana, taucht schemenhaft eine Stadt auf. Ob die beiden ergriffen sind von der Leere und dem warmen, goldleuchtenden Sommerlicht, kann man schwer sagen; jedenfalls ergreift er ihre Hand oder sie seine. Man kann zu diesem Bild, das um 1819 entstand, einiges sagen - zum Beispiel dass sich Caspar David Friedrich hier beim Malen vermutlich an eine Bootstour erinnerte, die er ein paar Monate nach seiner Hochzeit mit der 19 Jahre jüngeren Caroline Bommer im August 1818 machte; damals segelte das Paar von Rügen nach Stralsund.
Als Friedrich im Alter von 44 Jahren dieses Bild in Erinnerung eines glücklichen Moments zwischen Sandbänken und Seehunden, Gischt und Möwen malte, galt er schon als einer der rätselhaftesten und düstersten Künstler der deutschen Romantik. Dieser Ruf verdankte sich vor allem jenen Gemälden, die der 1774 in Greifswald geborene Künstler zehn Jahre zuvor gemalt hatte und die ihre Spuren in der Geschichte der Kunst hinterließen: Die Stimmung in seiner "Abtei im Eichwald" ist düsterer als das meiste, was damals in Europa auf Leinwände gebracht wurde. Man sieht einen Klosterfriedhof im Winter; zwischen abgefackelt aussehenden Eichen, deren Äste gekappt wurden, erhebt sich die Ruine eines gotischen Chores. Ein paar Mönche sind zu erkennen und ein offenes Grab, alles befindet sich in einem End- und Zerfallszustand, die Bäume sehen nicht aus, als ob sie je wieder ausschlagen würden, selbst der schmutzig bräunliche Himmel sieht eher aus wie die Ruine des Himmels nach dem Ende der Welt.
Die Reaktionen auf solche Totalverfinsterungen fielen unterschiedlich aus. Einige unter Friedrichs Zeitgenossen empfanden einen wohligen Grusel. Der mit Friedrich befreundete malende Gynäkologe Carl Gustav Carus, der seinerzeit vor allem ein bedeutender Mediziner war, heute aber als Künstler bekannt ist, schrieb, dass "Friedrich in seinen Landschaftstragödien in weiter wüster Ebene durch ein paar Granitblöcke, dürftiges Gestrüpp und aufgehenden Mond, oder durch ein einsames Meeresufer mit darüber ziehenden Wolken den ganzen Ernst des Lebens zur Erscheinung brachte".
Tragödien und der Ernst des Lebens: Damit war der Ton gesetzt, in dem seither über Friedrich geredet wurde. Dass der Maler gern dramatische Dämmerstimmungen, das fahle Morgenlicht oder den wild verfärbten Abendhimmel malte, wie man ihn sonst nur von Claude Lorrain kennt, bestärkte die Interpreten darin, in ihm einen gefährdeten Romantiker zu sehen, der sich den Schatten- und Nachtseiten des Lebens widmete und bei dem die wilde, erhabene Natur eine Gegenwelt zur einsetzenden rationalistischen Entzauberung der Welt durch die beginnende Industrialisierung und die Maschinenmoderne mit ihren Dampfmaschinen und rauchenden Schloten wird.
Berichte über das dunkle, gereizte Wesen von Friedrich und über traumatische Kindheitserfahrungen - die Mutter starb früh, der jüngere Bruder ertrank bei einem gemeinsamen Ausflug - wurden als weitere Beweise dafür herangezogen, dass man es bei dem Maler mit einem Melancholiker zu tun habe, der sich vor den Menschen und der Moderne in den Trost der Religion und die Einsamkeit von düsteren Naturbildern flüchtete - Seelenlandschaften, in denen schematische Rückenfiguren (Friedrich konnte, wie kein Biograph vergisst zu erwähnen, leider keine Menschen von vorn malen) in altdeutschen Kostümen wie Zombies in idealisierten deutschen Landschaften herumstehen und den Untergang der alten Welt und ihrer Werte betrauern.
Aber ob es etwa bei Friedrichs berühmtem "Mönch am Meer" nun "düster" zugeht oder nur stürmisch, ist Interpretationssache. Auf jeden Fall ist das Bild auf eine derart revolutionäre Weise leer, dass Kleist beim Anschauen befand, es fühle sich an, als seien einem "die Augenlider weggeschnitten". Wären da nicht der leichte Schwung der Dünen im Vordergrund, die Schaumkronen auf dem aufgewühlten Meer und die kleine Mönchsfigur, könnte man das Gemälde, das eigentlich nur aus drei Streifen von Sand, Meer und Himmel besteht, für abstrakte Farbfeldmalerei des 20. Jahrhunderts halten. Die mühseligen Details, an denen Friedrichs Malerkollegen sich festmalten, Kopfsteinpflaster, Ladenschilder, Kutschenräder, Kordeln und Mundwinkel, waren nicht Friedrichs Sache. Seine Bilder sind offener und freier, als wehte in ihnen ein stärkerer Wind: Alles Nichtwesentliche ist weggeblasen, nur wenige zerzauste, überraschte Dinge bleiben übrig.
Um formale Traditionen kümmerte Friedrich sich wenig. Sein frühes Gemälde für den Tetschener Altar von 1808, mit dem er berühmt wurde, zeigt einen Berg im Anschnitt, Sonnenstrahlen schießen hinter Tannen hervor, das Kreuz steht verdreht wie eine dürre Fußnote im Licht - das Drama der Natur ist der eigentliche Gegenstand des Altarbilds. Nicht das Anekdotische, sondern die Stimmung ist wichtig, nicht das Idyll, sondern das Erhabene, "le grand large", wie das bei den Franzosen heißt, die der Maler als Anti-Napoleonist nicht besonders schätzte; nicht sklavische Abbildung der Realität, sondern die Wiedergabe der Essenz. Friedrich will keine realistischen Wolkenformationen zeigen, sondern das Luftige und Dunstige an sich, nicht den Baum, sondern das Knorrige selbst.
Darin kann man die Modernität seiner Gemälde sehen - und in ihrer Deutungsoffenheit, im interpretationsabweisenden Zwielicht der Bilder. Genau damit konnten viele seiner Zeitgenossen nichts anfangen. Der Sammler und Kunsthistoriker Sulpiz Boisserée beschreibt in seinem Tagebuch, wie Goethe darüber, dass "die Bilder von Maler Friedrich ebenso gut auf dem Kopf gesehen werden" könnten, so in Wut geraten sei, dass er sich zum "Zerschlagen der Bilder an der Tischecke" habe hinreißen lassen. Die "Zeitung für die elegante Welt" klagte, bei Friedrich erscheine Natur nur "verdunkelt und vernebelt". Nebel und Winter seien zurzeit "leider in Verschiss" gekommen, notierte Friedrich achselzuckend in einem Brief, aber bald würden von den Kunstkritikern bestimmt auch Sommer und Frühling attackiert werden, dann passe es wieder. Es dauerte dann aber doch noch bis Ende des 19. Jahrhunderts, dass Friedrich wiederentdeckt wurde. Seitdem erfindet sich jede Generation den Friedrich, den sie gerade brauchen kann.
Die Beschwörung eines alten Deutschlands, gotischer Ruinen und riesiger Eichen verleitete die Nationalsozialisten dazu, Friedrich als Maler einer nationalen Erneuerung zu feiern. Psychologen schleiften Friedrichs Motive so lange durchs Dickicht ihrer Assoziationen, bis sie wie der Ausdruck einer kranken, bedrohten Seele dastanden. Ein besonders fragwürdiger Wikipedia-Eintrag spekuliert unter der Rubrik "Friedrichs Pathographie" darüber, ob seine Kunst Ausdruck einer psychischen Erkrankung sei. Friedrichs "infantile Verhaltensweisen" und "Schwierigkeiten im Smalltalk" sprächen außerdem für "Autismus und Asperger-Syndrom", hält Wikipedia fest, die zwei Männer mit einer Frau am Kreidefelsen seien Ausdruck einer gespaltenen Persönlichkeit - so wird munter weiterpsychopathologisiert.
In den fortschrittskritischen Siebzigerjahren machte eine Generation, die Adornos "Dialektik der Aufklärung" im Gepäck hatte, aus Friedrich einen Maler, der sich den verdrängten Schattenseiten der Moderne widmete. Und im großen Friedrich-Jahr 2024 (neben der schon eröffneten Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle zeigt Berlins Alte Nationalgalerie ab dem 19. April Friedrichs Naturmalerei, es folgt Dresdens Galerie Neue Meister ab dem 24. August mit einer Schau über die Dresdner Anfänge) wird sicherlich jemand auf die Idee kommen, Friedrichs Aktualität darin zu erkennen, dass er zum Beginn der ressourcenintensiven Verbrennermoderne schon den Preis erkannte, den Natur und Menschen für die Ausbeutung des Planeten zahlen müssen: verwüstete Landschaften und verwüstete Seelen, tote Bäume, zerschellte Schiffe, Klimakatastrophen aller Art, die Apokalypsen des Anthropozäns.
Aber was über Friedrich geschrieben wurde, verrät meist mehr über die Autoren und die Obsessionen und Ängste und Idealvorstellungen ihrer Zeit als über Friedrichs Kunst selbst. Von kaum einem anderen Werk muss ein so dicker Interpretations-Firnis abgenommen werden, um die Kunst überhaupt wieder sehen zu können. Sicher kann man in vielen Werken eine melancholische Grundstimmung erkennen, aber gebrochene Farben sind noch kein Beweis für gebrochene Menschen. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass Florian Illies für sein Buch über Friedrich ("Zauber der Stille", Fischer Verlag, 252 Seiten) als Titelmotiv genau jenes Gemälde gewählt hat, das am wenigsten ins Klischeebild des selbstzerstörerischen Romantikers passt, nämlich "Auf dem Segler" von 1819.
Illies verfolgt unter anderem das Schicksal dieses Gemäldes - vor allem aber erschließt er das Werk und Leben des Maler überraschend neu. Was lllies gelingt, ist eine Vergegenwärtigung der Geschichte durch kurze, blitzlichtartige literarische Anekdoten, in denen man wie mit einer Handkamera durch das Haus von Friedrich, aufs Boot und dann direkt in die Bilder hineingeführt wird. Illies erzählt, wie Walt Disney 1935 nach München reist, wo er "nicht weniger als 149 Bildbände und illustrierte Bücher" kauft, darunter einige über Friedrich, und wie dann Disneys "Bambi" durch Friedrichs "Felsenschlucht" läuft; Hollywood bringt Friedrichs Gefühl auf noch größere Leinwände. Zuvor war die Buchvorlage des jüdischen Autors Felix Salten für den Film von den Nazis verbrannt worden; als Disneys "Bambi" 1942 in die Kinos kommt, gehört Adolf Hitler zu den Ersten, die ihn in Europa sehen: "Er schaut Bambis Flucht vor dem Feuer inmitten des Krieges in seinem privaten Kino auf dem Berghof an und ist gerührt."
Illies ermöglicht einen neuen Blick auf Friedrich über die Seiteneingänge des Werks, etwa über die Rolle der Vögel, die dem Kanarienvogelzüchter Friedrich auch als Motiv wichtig waren. Wann bringen Möwen die Dynamik des Windes ins Bild, wann sitzt ein Adler als deutsches Symbol dort? Wie bei einem pointillistischen Gemälde baut sich aus den Einzelpunkten der von Illies beschriebenen Szenen, Anekdoten und Beobachtungen ein Gesamtbild zusammen, das flirrender, lebendiger (und darin Friedrich angemessener) ist als alle Versuche, ihn per Indizienbeweiskette in eine hermeneutische Parklücke zu bugsieren. Das, was Illies generell an Malerei schätzt, gelingt ihm in diesem Buch auf erzählerischer Ebene - das Skizzenhafte, die Lebendigkeit eines Malgestus, der die Energie des Windes, die er darstellen will, über den Pinsel rasant auf die Leinwand leitet, statt sie in peniblen fotorealistischen Rekonstruktionen zu verlieren.
Ein Vergleich drängt sich auf: der mit Edward Hopper. Immer wieder wurde erklärt, Hopper zeige in seinen Gemälden die Melancholie des vereinsamten Großstadtmenschen. Aber wer sagt, dass die "Nighthawks" an der erleuchteten Bar nicht heilfroh sind, der Enge ihres Dorfs entkommen zu sein, wer sagt, dass die allein auf einem Bett sitzende Frau in "Morning Sun", die immer als Bild schmerzhafter Einsamkeit herhalten muss, nicht gerade eine wunderbare Nacht mit jemandem verbracht hat, der gerade um die Ecke im Badezimmer ist? Roland Barthes hat einmal über die "Idiorrhythmie" geschrieben, die Kunst, sich einen Raum und einen Rhythmus für das Selbst-Sein zu schaffen. Ähnlich kann man bei Friedrich fragen, ob das Repertoire seiner Bilder immer nur als Ausdruck von Trauer ausgelegt werden muss - oder ob die Personen, die da allein über dem Nebelmeer oder an endlosen Stränden mit Blick auf tobende Meere stehen, nicht auch als Verkörperungen eines solchen Selbst-Seins gelesen werden könnten, die angesichts der gigantischen Naturschauspiele mit zumindest unbestimmten, nämlich entweder mulmigen oder aber auch euphorischen Gefühlen die eigene Unbeschränktheit erfahren: die Geburt des Selbst-Denkers als Gegenfigur zum Mitläufer.
Friedrich war keinesfalls nur ein Maler der Melancholie. Er hatte einen oft völlig übersehenen Humor. "Über Friedrichs Mund", schreibt sein Freund Gotthilf von Schubert, "schwebte immer ein leichter Zug des Scherzes." Ganze drei Monate, schreibt Friedrich einmal einer Freundin, habe sich "der Eisbär, dessen Sie sich so gütig erinnern, an der Küste der Ostsee herumgetrieben und sich öfter in die grünlichen Fluten getaucht und hat gesehen wie Seehunde ihr nasses Haupt aus den Wellen erheben". Vielleicht muss man sich den Maler des "Mönchs am Meer" auch als heiteren Mann im Meer vorstellen.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Es ist ein Wunder, wie vital er Friedrichs Schwermut und Versunkenheit in seinem Buch "Zauber der Stille" präpariert. Lars Grote Märkische Allgemeine 20240419