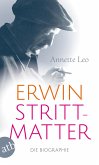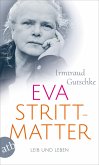"Ich habe zu früh Erfolg gehabt, den falschen Mann geheiratet, in den falschen Kreisen verkehrt; ich habe zu vielen Männern gefallen und an zu vielen Gefallen gefunden", schreibt Brigitte Reimann 1959. Vielleicht sind diese Tagebücher ihr eigentlicher Roman: die Lebensgeschichte einer leidenschaftlichen, lebenshungrigen, kompromißlosen Frau und zugleich eine Dokumentation des Alltags in den fünfziger und sechziger Jahren. "Ich weiß nicht, wann ich wahrhaftig ich selbst bin, am Schreibtisch oder sonst. Ich frage mich, ob all meine Kraft und meinen Mut die auf einem Blatt Papier geschaffenen Menschen fressen oder ob ich gar keine Kraft und keinen Mut habe und sie gerade deshalb meinen Gestalten gebe." Brigitte Reimann schrieb diese Sätze mit 29 Jahren. Mit der für sie typischen Radikalität benannte sie ihre Konflikte als Autorin und als Frau: leben wollen und schreiben müssen, geliebt werden wollen und wahrhaftig sein müssen. Sich allem immer ganz hinzugeben, und zwar sofort, gehörte zu ihren dominierenden Charakterzügen, und sie selbst stand hilflos der eigenen Lebenswut gegenüber und trieb sich doch ständig an: "Wer weiß, wie lange ich noch lebe ..." Gestorben ist sie zehn Jahre später an Krebs, aber eigentlich war es die Überdosis Leben, die sie ihrem Körper zugemutet hat - Affären, Arbeit, Alkohol -, die sie so früh sterben ließ, und eben jene zerstörerischen Selbstzweifel. So manisch, wie sie alles betrieb, hat sie seit ihrer Jungmädchenzeit Tagebuch geführt. Die frühen Aufzeichnungen hat sie selbst vernichtet. Dieser erste Band der Edition ihrer Tagebücher setzt ein, als sie sich von ihrem ersten Ehemann zu trennen beginnt, den Schriftsteller Siegfried Pitschmann kennenlernt und mit ihm in eines der neuen Industriezentren, nach Hoyerswerda, zieht. Dort schreibt sie zwei ihrer wichtigsten Bücher, und die Lebensbedingungen in Hoyerswerda drängen ihr den Stoff für "Franziska Linkerhand" auf. Wegen ihres leidenschaftlichen Engagements wird sie in Kommissionen des Politbüros berufen, aber bald wird ihr klar, daß die falschen Leute sie für ihre Ziele vereinnahmen wollen. Und so sind die Tagebücher nicht nur Dokument der Emanzipation einer Frau von herrschenden Moralvorstellungen und einer Schriftstellerin von dogmatischen Erwartungen, sondern auch einer politischen Desillusionierung.
"Ein Parlando, in dem der Odem großer Literatur weht. Ich kann mich nicht erinnern, das Buch einer Frau in deutscher Sprache gelesen zu haben, in dem die Sehnsucht nach Liebe mit einer solchen Sinnlichkeit und Intensität gezeigt wurde. Dieses Buch hat die Qualität eines Romans und die Vorzüge eines Tagebuchs. Es hat mich ergriffen." Marcel Reich-Ranicki im Literarischen Quartett
"Ein Parlando, in dem der Odem großer Literatur weht. Ich kann mich nicht erinnern, das Buch einer Frau in deutscher Sprache gelesen zu haben, in dem die Sehnsucht nach Liebe mit einer solchen Sinnlichkeit und Intensität gezeigt wurde. Dieses Buch hat die Qualität eines Romans und die Vorzüge eines Tagebuchs. Es hat mich ergriffen." Marcel Reich-Ranicki im Literarischen Quartett

Brigitte Reimanns Tagebücher · Von Mark Siemons
Vom Osten her gesehen war West-Berlin 1964 ein exotisches Land. Allein der Kurfürstendamm, diese "Orgie von buntem Licht", versetzt die DDR-Schrifstellerin Brigitte Reimann, die bei aller Empfindsamkeit sonst doch ganz andere Erschütterungen gewohnt war, in veritable Irritation. "Wie kann man da bloß leben", notiert sie in ihr Tagebuch, "als Mensch existieren zwischen Lichtschreien und flachschnäuzigen gefräßigen Stahltieren? Ich zitterte vor Aufregung, war den Tränen nahe - nun ja, Provinz." Das ist schon fast der ganze Reimann-Ton, wie er auf jeder Seite der jetzt unzensiert veröffentlichten Tagebücher den Leser für sich einnimmt: viel Gefühl, einige Selbstironie und das stets gegenwärtige Bewußtsein von zwei deutlich verschiedenen Typen Mensch, die das Nachkriegsdeutschland in nur wenigen Jahren ausgebildet habe.
Der Westen blieb für Brigitte Reimann, so kritisch ihre Haltung zur DDRFührung mit der Zeit auch wurde, immer eine fremde Welt. Eine Verständigung sei kaum mehr möglich, befindet sie mehrmals, sogar dieselben Wörter hätten verschiedene Bedeutung angenommen. "Die Westdeutschen halten uns für primitiv", heißt es 1961 von einem gesamtdeutschen Schriftstellerkongreß, "weil sie in ihren Köpfen die Weisheit und Freiheit und Ästhetik des Abendlandes gestapelt haben, und weil sie unsere klaren Diktionen, unsere einfache, zuweilen nüchterne Sprache nicht verstehen." Der Reiz der Tagebücher ist für den westdeutschen Leser nicht zuletzt ein perspektivischer: Er erfährt, wie sich auch jenseits von Propagandaformeln eine DDR-Identität bildete und welchen Platz er darin einnahm, kurz, er lernt sich selbst von außen kennen, als ein einigermaßen merkwürdiges Wesen.
Man versteht zum Beispiel, weshalb die westdeutsche Literaturkritik lange Zeit mit Brigitte Reimann wenig anfangen konnte. Über das postum 1974 erschienene Hauptwerk "Franziska Linkerhand" urteilte Gabriele Wohmann befremdet, sie könne für diesen "geplänkelhaften Text" keine "vertiefte Anteilnahme" aufbringen. Das Buch wurde von der Kritik als überladen, konventionell und privatistisch abgetan; frühere Werke wie die Erzählung "Geschwister", für den die Autorin in der DDR den Heinrich-Mann-Preis erhielt, überwanden erst gar nicht die Wahrnehmungsschwelle. Es irritierte offenbar ein Ton, für den es in den westlichen Mustern keine Entsprechung gab. Er stimmte weder mit den Vorstellungen überein, die man sich von "politischer", zumal sozialistischer Literatur machte, noch mit den Ansprüchen an subjektives, existentiell grundiertes Erzählen.
Man war eine DDR-Literatur gewohnt, die ihre Gebrauchsanweisung immer schon mitlieferte, die in jedem Satz und noch im konkretesten Detail die Erfahrung einer ganzen Generation, die Idee des Sozialismus sowie die Tücken von dessen Verwirklichung gleich mitbedachte. Alles war Symptom und Symbol für irgend etwas anderes, und die Wahrheit stand grundsätzlich zwischen den Zeilen. Dabei kam nicht selten ein Stil zustande, der seine Authentizität durch Gewundenheit auswies. Schuld daran war weniger die Angst vor einem äußeren, als die Rücksicht auf den inneren Zensor, der es einem verbot, mit Verweis auf die frustrierende Wirklichkeit das Ideal zu verraten. So bildete sich eine Art Geheimsprache für ernüchterte Geschichtsphilosophen aus; sie war in der Lage, auch im offensichtlichsten Scheitern am Ende das Ganze triumphieren zu sehen, bei Bedarf also jedwede Wirklichkeit dialektisch aufzuheben. "Können uns heute noch an einem Wort, einer Losung erkennen", heißt es programmatisch in Christa Wolfs "Nachdenken über Christa T.": "Blinzeln uns zu."
Mit dieser Blinzel-Literatur hat Brigitte Reimann in der Tat nichts zu schaffen. Bei ihr steht die Wahrheit nie zwischen den Zeilen. Gleich ob sie ihre zahlreichen Affären, ihre idealistischen, fast kindlich naiven Hoffnungen oder ihre Desillusionierungen schildert: Sie beschreibt immer nur den Augenblick, ohne ihn in ein größeres Raster einordnen und damit relativieren zu wollen. Sie widersteht der Versuchung, sich nachträglich zu stilisieren, in welche Richtung auch immer. Viele Einschätzungen, die sie von sich selbst und anderen gibt, widersprechen einander sogar. Auch das Leben "politischer Menschen", so lernt man daraus, ist aus Details gewoben, die zur Notwendigkeit des Geschichtsverlaufs allenfalls in einem akzidentiellen Verhältnis stehen. "Manchmal fühlen wir uns wie mißratene Kinder", bemerkt sie über ihre Zeit mit einem Geliebten: "Wir spielen Indianer, rauchen Friedenspfeife und sprechen über Büffeljagden und Politökonomie."
Der eigentümliche Charme solch absichtsloser Konkretion hat ihr im Westen früher den Ruf der Harmlosigkeit, der Irrelevanz eingetragen. Heute macht gerade er die Tagebücher zu einem unvergleichlichen Dokument: Sie zeigen die DDR nicht als Konglomerat abstrakter Begriffe, sondern von innen her, aus der Perspektive einer Frau, die sich von Ideen nicht ihre Erlebensfähigkeit nehmen läßt. Damit löst dieses Werk auch das Monitum vieler Ostdeutscher ein, die ihr Dasein in der DDR nicht auf die Absichten der führenden Partei reduziert sehen wollen.
Zu großen Teilen und vor allem im ersten Band ist der Inhalt durchaus nicht politisch. Brigitte Reimann vertraut dem Tagebuch vor allem ihre Affären und alkoholischen Exzesse an. 1933 wird sie in Burg bei Magdeburg in einem bürgerlichen Elternhaus geboren, das ihr später immer wieder zum Zufluchtsort wird. Mit zwanzig heiratet sie zum ersten Mal; zwei Jahre später setzen die erhaltenen Tagebücher ein. Als sie, 39 Jahre alt, 1973 einem Krebsleiden erliegt, hat sie vier Ehen hinter sich. Der Leser der Tagebücher kann oft von Tag zu Tag, dann wieder mit monatelangem Abstand, die Entwicklung ihrer amourösen Verstrickungen verfolgen, die sie mit viel Sinn für komische Nebeneffekte ausbreitet. Ihr gelingt es dabei nur höchst unvollkommen, die Tagebücher versteckt zu halten; immer wieder muß sie berichten, wie ihr Mann die Aufzeichnungen findet und sie gegen sie verwenden will.
Bei aller ungeschönten Disparatheit der Notizen scheint ihr der Gedanke an spätere Leser nicht unlieb zu sein. Die Tagebücher und der stark autobiographisch getönte Roman, der sie die letzten zehn Jahre in Atem hält, bilden ein einziges literarisches Projekt mit verschiedenen Mitteln. Anfangs ist es vielleicht nur Selbstbestätigung, die Verdrängung der sie häufig plagenden Minderwertigkeitskomplexe, was sie zum Schreiben treibt; der kokette Ton, die häufige Erwähnung, welchen Eindruck sie auf diesen oder jenen Mann macht (meistens einen überwältigenden) deuten darauf hin. Doch mit den Jahren schält sich immer deutlicher ein weitergehendes Motiv heraus: die literarische Fixierung der eigenen Vitalität, die sie ihren frühen, sich mit der Zeit verdichtenden Todesahnungen entgegenstellt. "Ich weiß selbst, das Buch besteht aus lauter Abschweifungen", bemerkt sie einmal über den Roman, "kann aber nicht erklären, warum ich's gerade so schreiben will: einfach Leben ballen, Alltäglichkeit mit Zufälligem, Nicht-notwendigem."
Man kann nicht sagen, daß es dabei allzu diskret zugeht, aber peinlich oder kitschig wird es eigentümlicherweise nie. Ob in der Lust oder im Unglück, immer schafft sie es, zu den eigenen Stimmungen auf Distanz zu gehen. "Ich habe alle Schrecken des Lebens, das eine geschiedene Frau führen muß, vorweggenommen", beginnt sie einmal ziemlich melodramatisch, fügt dann aber gleich hinzu: "Bald werde ich laut mit mir selber reden". Ein anderes Mal sitzt sie, keine dreißig Jahre alt, in ihrer Neubauwohnung in Hoyerswerda, hin- und hergerissen zwischen der Liebe zu ihrem lebensuntüchtigen Mann und einem exzentrischen Geliebten, verzweifelt über die Größe des Romanprojekts, das sie sich vorgenommen hat. "Ich hörte Blues und ließ mich methodisch vollaufen", berichtet sie und fährt dann fort: "Dieser Blues . . . man versteht, warum einer weisen Regierung diese destruktive Negermusik unerwünscht ist."
Von einer Rebellion gegen die verklemmten Konventionen der DDR-Gesellschaft - als solche werden die Aufzeichnungen im Westen zuweilen begriffen - kann dabei kaum die Rede sein. Am meisten greift sie sich selbst an. "Mein mieses provisorisches Leben", klagt sie einmal, als sie das kleine Kind ihrer Schwester betrachtet, eine kaputte Ehe, kein Kind, ein lebensuntüchtiger Mann, ein armer geexter Geliebter, mittelmäßige Bücher . . ." Solche Bilanzen häufen sich gegen Ende ihres Lebens. Die immer wiederkehrende Grundkonstellation, eine gleichzeitige Neigung zu verschiedenen Männern, bereitet ihr die schrecklichsten Gewissensqualen.
Dank dem Personenregister und dem umfangreichen Anmerkungsteil kann man die Tagebücher auch als Nachschlagewerk zur DDR-Literatur gebrauchen. Aus der Ferne verehrt sie Anna Seghers ("ich glaube, ich würde einfach tot umfallen, wenn sie ein Wort an mich richtete"), aus der Nähe Christa Wolf, die ausdauernde Brieffreundin der letzten Jahre ("wie sollte man diese Frau nicht lieben!"). Für Reiner Kunze ("auf eine schwerbestimmbare Weise schön") und Günter de Bruyn ("auf seine stille Weise sehr fest in Meinung und Haltung") hegt sie alle Jahre hindurch freundschaftliche, bewundernde Gefühle.
Gerade durch ihren Verzicht auf Verallgemeinerungen setzt sich aus den Notaten ein einzigartiges Bild der Generation zusammen, die in den fünfziger Jahren voller Enthusiasmus angetreten war, einen Staat neuen Typs zu bauen. Als sie mit vierundzwanzig Jahren von der Stasi unter Druck gesetzt wird, klagt sie, daß ausgerechnet ihr das passiert: "mir, die ich den Sozialismus, unsere Idee liebe, so ehrlich wie nicht viele andere, und bereit bin, für diese Idee zu arbeiten, auf saubere, anständige Weise zu arbeiten". Durch ein ausführliches Gespräch gelingt es ihr, ihren "Betreuer" loszuwerden ("blutenden Herzens ist er abgezogen").
Anfang der sechziger Jahre zieht sie mit ihrem Mann in die junge Industriestadt Hoyerswerda, um dort im Sinne des gerade propagierten "Bitterfelder Wegs" als Schriftsteller Seite an Seite mit den Werktätigen zu leben und zu schreiben. "H. ist überwältigend", schreibt sie nach einem ersten Besuch, "das Kombinat von einer Großartigkeit, daß ich den ganzen Tag wie besoffen herumlief." Doch kaum wohnt sie dort, ändert sich der Ton: "Diese ganze Stadt Hoyerswerda war mir unsympathisch in ihrer aufdringlichen Neuheit".
Eine Woche vor dem Mauerbau ergreift sie eine panische Angst vor dem Atomkrieg, sie wartet nur darauf, am Himmel "die fremde Sonne" zu sehen, die alle versengen würde. Sie bittet ihren Mann, Schlaftabletten für den Notfall zu besorgen. Der Mauerbau selbst ist ihr dann keine einzige Erwähnung wert - ganz im Gegensatz zur immer frostigeren Eiszeit des Jahres 1965, die im berüchtigten elften Plenum kulminiert. Fast täglich berichtet sie über eine neue Domestizierung von Künstlern und Schriftstellern. Man ermißt am Grad der Enttäuschung die Größe der Hoffnungen, die zuvor auf eine selbständige Kultur gesetzt wurden. Nach einem Gespräch mit dem jungen Chefredakteur der "Neuen deutschen Literatur", der sie auf "problematische Stellen" in ihrem Manuskript hinweist, entfährt es ihr: "Diese feigen Idioten. 'Problematisch'. Wofür ist die Literatur denn zuständig, wenn nicht für Probleme? Ein widerliches Land."
Einen neuen Höhepunkt erreicht diese Desillusionierung 1968 nach dem Einmarsch in Prag ("bin wie gelähmt"). Sie verwirft, was sie früher geschrieben hat: "Ich war ein gutgläubiger Narr. Seit der CSSR-Affäre hat sich mein Verhältnis zu diesem Land, zu seiner Regierung sehr geändert. Verzweiflung, manchmal Anfälle von Haß." Doch auch danach schreibt sie noch "Wir", wenn von der DDR die Rede ist. "Eine schwierige Situation für uns", notiert sie am 19. März 1970. In Erfurt ist gerade Willy Brandt mit Jubel empfangen worden.
Brigitte Reimann: "Ich bedaure nichts". Tagebücher 1955 bis 1963". Herausgegeben von Angela Drescher. Aufbau-Verlag, Berlin 1997. 429 S., geb., 39,90 DM.
Brigitte Reimann: "Alles schmeckt nach Abschied. Tagebücher 1964 bis 1970". Herausgegeben von Angela Drescher. Aufbau-Verlag, Berlin 1998. 464 S., geb., 44,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
» "Brigitte Reimann taucht nun auf wie ein Phönix aus der Asche." « Der SPIEGEL