Insgesamt 210 Bewertungen
Zur vorherigen Seite 1 Zur Seite 1 2 Aktuelle Seite 3 Zur Seite 3 4 Zur Seite 4...Weitere Seiten21Zur letzten Seite, Seite 21Zur nächsten SeiteZur letzten Seite
Zur vorherigen Seite 1 Zur Seite 1 2 Aktuelle Seite 3 Zur Seite 3 4 Zur Seite 4...Weitere Seiten21Zur letzten Seite, Seite 21Zur nächsten SeiteZur letzten Seite





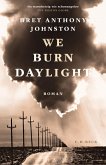
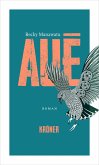


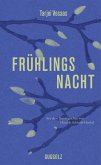

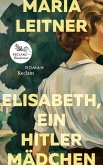
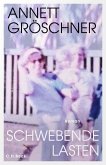
Benutzer