BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 14 Bewertungen| Bewertung vom 14.11.2020 | ||

|
Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Es ist einer der nicht so häufigen historischen Romane, die scheinbar mühelos Bilder ihrer Zeit zeichnen können, die Personen in die Webarbeit einflechten, die leuchten und funkeln oder dunkel und düster sind. |
|
| Bewertung vom 14.11.2020 | ||

|
Nach dem ersten Mal Lesen war ich berauscht von Ransmayers Einfällen, Geschichten, seiner Sprache, seiner Poesie, seinen fabelhaften Vergleichen, den Worten, die er findet, um ungewöhnlich Schönes und ungewöhnlich Schreckliches so sorgsam und gewählt zu fassen, wie kostbare Edelsteine gefasst werden. |
|
| Bewertung vom 14.11.2020 | ||

|
Es ist eine junge, schöne Frau, die sich in den Körper, die Gedanken, die Befindlichkeiten einer sehr Alten, ca. 90 Jährigen, begibt, und damit zeigt, dass die körperliche Zerbrechlichkeit, die Beschäftigung mit der eigenen Vergänglichkeit, Verletzlichkeiten und Ängste uns ein Leben lang begleiten – nur kommt bei Baba Dunja eine gewisse Form der Furchtlosigkeit und Gelassenheit hinzu. |
|
| Bewertung vom 14.11.2020 | ||

|
Es ist ein Buch über das Alter, das Älterwerden, das Nichtälterwerdenwollen, und es ist ein Buch über - wenn es so etwas gibt - Vernachlässigung aus Güte. |
|
| Bewertung vom 14.11.2020 | ||
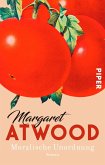
|
Erzählt werden die Geschichten – denn es ist eher eine Sammlung von Geschichten als ein Roman – aus der Perspektive von Nell, der Stellvertreterin Margret Atwoods, die uns in Rückblenden und aus der erzählerischen Gegenwart in den Personenkreis und das Leben ihrer Familie und Freunde einführt. Aus den Beschreibungen und Analysen gewinnen wir ein abgerundetes Bild der Zeit und Lebensumstände von ziemlich ungewöhnlichen Menschen. |
|
| Bewertung vom 14.11.2020 | ||

|
Sehr eindrucksvoll und fast schon exemplarisch werden Politik und Geschichte anhand einer koreanischen Familie dargestellt, die uns von Anfang letzten Jahrhunderts an über mehrere Generationen hinweg durch die Entwicklungen ihres Lebens führt. Ausgerüstet mit Hoffnung und Fleiß und erfüllt von dem Wunsch nach einem Verdienst, der ihr Überleben sichert, versuchen sie der japanischen Fremdherrschaft zu entkommen und in Japan selbst eine neue Heimat zu finden. |
|
| Bewertung vom 12.11.2020 | ||

|
Die Geschichte der Bienen / Klima Quartett Bd.1 Maja Lunde, Die Geschichte der Bienen. btb 2015, 508 Seiten |
|
| Bewertung vom 12.11.2020 | ||
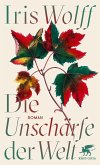
|
Iris Wolff, Die Unschärfe der Welt. Roman. Klett-Cotta, 2020. 213 Seiten |
|
| Bewertung vom 08.07.2015 | ||
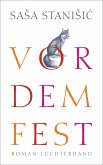
|
Eine Rhapsodie überbordender Erzähllust 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 01.07.2015 | ||

|
Zwei Menschen, Gruber, ein Banker, und Sarah, eine D-Jane. wie sie beide unterschiedlicher nicht sein könnten, begegnen einander unter ungewöhnlichen Umständen, kommen sich näher, entfernen sich wieder voneinander und bleiben sich schließlich näher, als sie ursprünglich gedacht hatten. |
|
