Nicht lieferbar
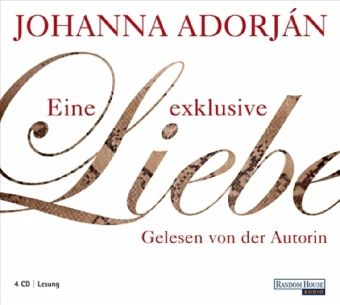
Eine exklusive Liebe
Ungekürzte Autorenlesung. 256 Min.
Nicht lieferbar
FAZ-Journalistin Johanna Adorján schreibt über ihre Großeltern Vera und István, die als ungarische Juden den Holocaust überlebt haben und 1956 während des Aufstandes von Budapest nach Dänemark geflohen sind. 1991 haben sie sich das Leben genommen. Man fand sie Hand in Hand in ihrem Bett. Adorján erzählt die Geschichte dieser ungewöhnlichen Liebe.




