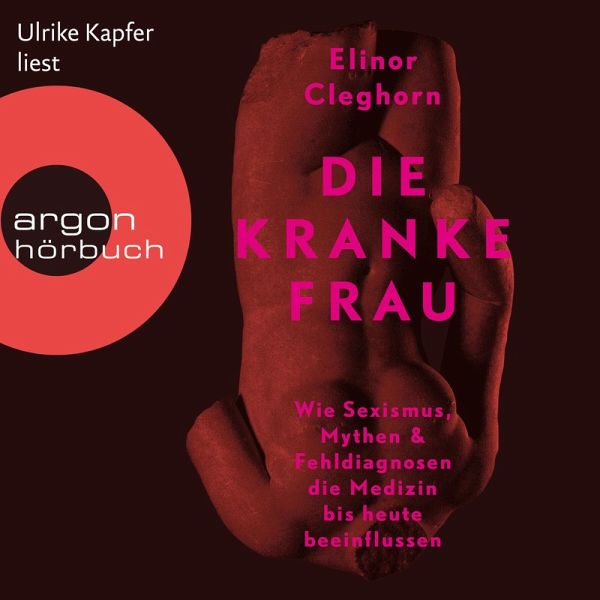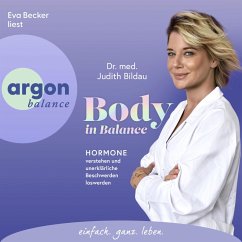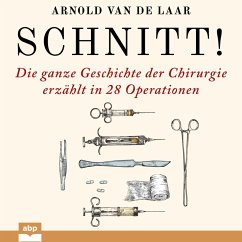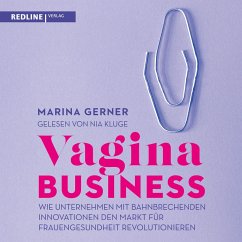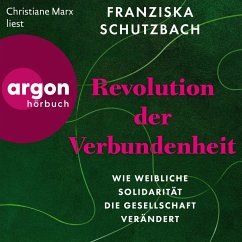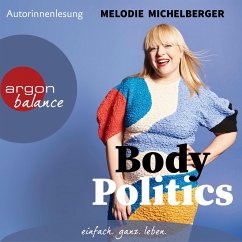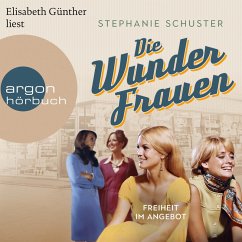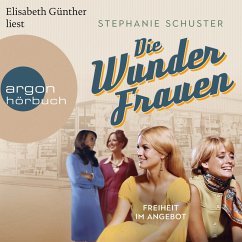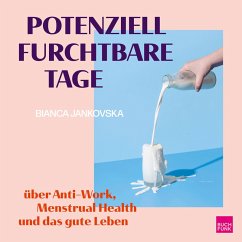Elinor Cleghorn
Hörbuch-Download MP3
Die kranke Frau (MP3-Download)
Wie Sexismus, Mythen und Fehldiagnosen die Medizin bis heute beeinflussen Ungekürzte Lesung. 896 Min.
Sprecher: Kapfer, Ulrike / Übersetzer: Emmert, Anne; Elze, Judith

PAYBACK Punkte
13 °P sammeln!





Von den antiken Anfängen der Medizin bis in die Gegenwart, von der "wandernden Gebärmutter" bis zur Entdeckung von Autoimmunerkrankungen und Endometriose: Die englische Feministin Elinor Cleghorn präsentiert eine bahnbrechende und aufwühlende Kulturgeschichte über das Verhältnis von Frauen, Krankheit und Medizin. Elinor Cleghorn, selbst an der Autoimmunerkrankung Lupus erkrankt, hat sich nach einer nervenaufreibenden Diagnose-Odyssee auf die Suche nach den Wurzeln der patriarchalen Mythen begeben, die unsere westliche Medizin bis heute prägen. Anhand einer Fülle von historischem Materi...
Von den antiken Anfängen der Medizin bis in die Gegenwart, von der "wandernden Gebärmutter" bis zur Entdeckung von Autoimmunerkrankungen und Endometriose: Die englische Feministin Elinor Cleghorn präsentiert eine bahnbrechende und aufwühlende Kulturgeschichte über das Verhältnis von Frauen, Krankheit und Medizin. Elinor Cleghorn, selbst an der Autoimmunerkrankung Lupus erkrankt, hat sich nach einer nervenaufreibenden Diagnose-Odyssee auf die Suche nach den Wurzeln der patriarchalen Mythen begeben, die unsere westliche Medizin bis heute prägen. Anhand einer Fülle von historischem Material rekonstruiert sie, wie stark die Medizin als Wissenschaft und Institution von kulturellen und gesellschaftspolitischen Umständen beeinflusst ist. Denn die Tatsache, dass Frauen als das schwächere Geschlecht galten und auf die soziale Aufgabe der Mutterschaft reduziert wurden, formte auch den medizinischen Blick auf Frauen und Weiblichkeit über die Jahrhunderte. Von der "wandernden Gebärmutter" über die "Hysterie" bis hin zum sich nur äußerst langsam wandelnden Verständnis für Menstruation und Menopause - all diese Diagnosen und Entwicklungen zeugen von einer männlich geprägten, nicht selten sexistischen Medizin. Feminist:innen erheben seit Langem ihre Stimme gegen diesen patriarchalen Zugriff auf ihren Körper und kämpfen für eine bessere Aufklärung über weibliche Gesundheit. Wer verstehen will, warum dieser Kampf wichtig und notwendig ist, findet in Elinor Cleghorns augenöffnendem Buch die Antwort. Sprecherin Ulrike Kapfer hat bereits Hörbüchern von Theresa Hannig und Mareike Fallwickl ihre Stimme geliehen. Klar und lebendig liest sie auch dieses spannende und gleichzeitig hoch-informative Sachbuch.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Elinor Cleghorn ist promovierte Kulturhistorikerin und Feministin. Sie arbeitete an einem medizinisch-geisteswissenschaftlichen Forschungsprojekt der Universität Oxford, ehe sie motiviert durch persönliche Erfahrungen mit der Recherche zu 'Die kranke Frau' begann. Heute lebt und arbeitet sie als Autorin in Sussex.
Produktdetails
- Verlag: argon Sachhörbuch
- Gesamtlaufzeit: 896 Min.
- Erscheinungstermin: 18. August 2022
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783732459476
- Artikelnr.: 64709151
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Kritikerin Felicitas Witte, selbst Medizinerin, ärgert sich, dass Elinor Cleghorn in ihrem Buch über angebliche Frauenfeindlichkeit in der Medizin auf Emotionalisierung setzt und nicht auf eine solide Faktenbasis. So findet sie dann auch viele Falschbehauptungen, die sie ausführlich korrigiert, etwa, dass Gicht keine Lebensstil-, sondern meist eine Erbkrankheit ist. Ein kritischer Blick darauf, ob Frauen in der Medizin heute benachteiligt und nicht ernst genommen werden, hätte die Rezensentin durchaus interessiert, aber Cleghorn kann ihr mit veralteten Quellen oder ohne Nachweis aufgestellten Behauptungen keine zufriedenstellende Antwort geben. Für die Autorin scheint die patriarchal bedingte Unterdrückung der Frau auch im medizinischen Kontext klar zu sein, seufzt die Rezensentin, die sich weniger Gefühl und mehr Wissenschaft gewünscht hätte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.03.2023
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.03.2023Seht nur die Patriarchen!
Wie Bücher über ärztliche Praxis nicht ausfallen sollten: Elinor Cleghorn wettert gegen androzentrische Medizin
Dürfen wir vermuten, dass Elinor Cleghorn nur noch zu Ärztinnen und nicht mehr zu Ärzten geht? Schließlich trägt ihr Buch den Untertitel "Wie Sexismus, Mythen und Fehldiagnosen die Medizin bis heute beeinflussen". Darin beschreibt sie, wie die Medizin seit der Antike Frauen benachteiligt habe, dass Frauen Opfer einer "männerdominierten medizinischen Orthodoxie" gewesen seien und dieses Erbe bis heute eine effektive und rasche Diagnose und Behandlung von Frauen verhindere.
Cleghorn echauffiert sich über eine "androzentrische Medizin" und Ärzte, die die Symptome von
Wie Bücher über ärztliche Praxis nicht ausfallen sollten: Elinor Cleghorn wettert gegen androzentrische Medizin
Dürfen wir vermuten, dass Elinor Cleghorn nur noch zu Ärztinnen und nicht mehr zu Ärzten geht? Schließlich trägt ihr Buch den Untertitel "Wie Sexismus, Mythen und Fehldiagnosen die Medizin bis heute beeinflussen". Darin beschreibt sie, wie die Medizin seit der Antike Frauen benachteiligt habe, dass Frauen Opfer einer "männerdominierten medizinischen Orthodoxie" gewesen seien und dieses Erbe bis heute eine effektive und rasche Diagnose und Behandlung von Frauen verhindere.
Cleghorn echauffiert sich über eine "androzentrische Medizin" und Ärzte, die die Symptome von
Mehr anzeigen
Frauen jahrhundertelang vor allem als körperliche Zeichen psychischer Probleme angesehen hätten. Sie bringt eine Fülle von Informationen aus der Geschichte der Medizin und über den Alltag kranker Frauen heute. Zwar führt sie etliche Quellen an, doch mehr wissenschaftliche Sorgfalt hätte dem Buch gutgetan. Manches, was die Autorin schreibt, ist falsch.
So wird beispielsweise der hippokratische Eid heute nicht mehr "standardmäßig" von angehenden Ärztinnen und Ärzten geleistet. In Deutschland gehört er gar nicht mehr zum Studienabschluss, in den USA und in England wird eine modifizierte Version oder keine aufgesagt. Marie Gillain Boivin war keine Gynäkologin, sondern eine Hebamme. Affektive Störungen sind keine "Diagnosekategorie einander überlappender körperlicher und psychischer Störungen". Vielmehr werden darunter depressive und manische Erkrankungen zusammengefasst. Auch ist es nicht korrekt, dass mit Blick auf Herzkrankheiten, bestimmte Krebsarten und Aids/HIV Studien zu den spezifischen Auswirkungen auf den weiblichen Körper fehlen würden. Es gibt hier eine Vielzahl von Untersuchungen, die explizit Frauen betreffen. Und Gicht ist keine "dieser altmodischen Krankheiten, die durch zu viel Käse und Alkohol entstehen". Einer Gicht liegt in den meisten Fällen eine erblich bedingte Ausscheidungsschwäche für Harnsäure in der Niere zugrunde, seltener sind Ernährungsgewohnheiten oder ein angeborener Enzymdefekt die Ursache. Ein Gichtanfall mit akut entzündetem Gelenk wiederum kann dann durch ein Übermaß an Alkohol und eine Mahlzeit mit zu viel Fisch, Fleisch oder Meeresfrüchten ausgelöst werden.
Die Autorin verliert sich allzu oft in detaillierten emotionsheischenden Erzählungen über die Leiden von Frauen und Mädchen. Da ist etwa die ältere Frau mit der "wandernden Gebärmutter" im antiken Griechenland, die Vierzigjährige im siebzehnten Jahrhundert, die junge Leute verhext haben soll, was angeblich zu Anfällen führte, oder das siebzehnjährige Kindermädchen mit Panikattacken im achtzehnten Jahrhundert, die als "Hysterie mit eindeutig seelischer Ursache" missgedeutet wurden.
Es stimmt zwar, dass Frauen mehr über Schmerzen berichten als Männer. Aber dass Frauen mit ihren Schmerzen allein gelassen werden, wie Cleghorn schreibt, ist nicht belegt. Die Studien, die sie bezüglich der Versorgung mit Schmerzmitteln zitiert, sind Jahrzehnte alt. Es wäre interessant zu erfahren, wie sich die Situation heute darstellt. Was Cleghorn unter "schwachen Beruhigungsmitteln" versteht, erklärt sie nicht. Falls sie damit pflanzliche Mittel wie Baldrian, Melisse oder Hopfen meint, gehören diese in der Tat nicht zur Standardtherapie chronischer Schmerzen. Antidepressiva wirken aber durchaus gegen bestimmte Formen chronischer Schmerzen, etwa diabetisch bedingte Nervenschmerzen, Fibromyalgie oder Rückenschmerzen. Cleghorn bleibt auch den Beweis schuldig, dass, wie sie behauptet, die Schmerzen von Frauen eher auf eine emotionale oder psychische Ursache zurückgeführt werden als auf eine körperliche.
Kritisch scheint Cleghorn auch die hormonelle Verhütung zu sehen. Sie behauptet, bis heute kenne man nicht alle Auswirkungen der Präparate und Pillen-Anwenderinnen seien immer noch Versuchsobjekte. Das gilt allerdings für so gut wie alle Medikamente. Es ist unmöglich, sämtliche Auswirkungen einer Arznei zu kennen.
Es ist richtig, wie Cleghorn darlegt, dass es Jahre dauerte, bis die Nebenwirkungen der Pille im Beipackzettel erwähnt wurden. Jedoch lässt sie unerwähnt, dass die Pille zu den sichersten und beliebtesten Verhütungsmitteln überhaupt gehört; in Deutschland nutzt sie rund jede dritte Frau. Dass sich seit Jahrzehnten Mythen um die Pille ranken, wie Cleghorn schreibt, lässt sich nicht nachvollziehen.
Die Autorin leidet unter Lupus erythematodes, einer seltenen Autoimmunkrankheit. Ihre Symptome seien sieben Jahre lang als harmlos abgetan und mit Fehldiagnosen erklärt worden. Tatsächlich dauert es gerade bei seltenen Krankheiten mitunter länger, bis die Diagnose gestellt wird. Ob das aber daran liegt, dass "patriarchalisch denkende" Ärzte die Klagen der Frauen nicht ernst nehmen, bleibt fraglich. Bekannt ist dagegen, dass die Diagnose einer Depression bei Männern seltener gestellt wird, weil diese offenbar unter anderen Symptomen als Frauen leiden, die im "typisch weiblichen" Kriterienkatalog für eine Depression nicht aufgenommen sind.
Ein wesentliches Manko ist, dass Cleghorn ihre Einschätzungen nicht ausreichend mit validen Zahlen und Studien belegt. Viele der zitierten Studien entsprechen nicht dem Standard, der für Fachzeitschriften üblich ist. Vor allem die medizinischen Untersuchungen sind veraltet - etwa die von ihr "bahnbrechend" genannte Studie zu chronischen Schmerzen von 2001 oder der Bericht zur globalen Gesundheit von 2014. Ein Blick in die aktuelle Fachliteratur hätte genügt, um Dutzende neuerer Studien zu finden, die sich mit Frauen in der Medizin auseinandersetzen und ein anderes Bild der aktuellen Situation vermitteln. Lieber prangert die Autorin immer wieder das "medizinische Establishment" an, das Frauen mit Ablehnung und Zweifel begegne. Mehr Wissenschaft statt polarisierender Worte hätte dem Buch gutgetan. FELICITAS WITTE
Elinor Cleghorn: "Die kranke Frau". Wie Sexismus, Mythen & Fehldiagnosen die Medizin bis heute beeinflussen.
Aus dem Englischen von J. Elze und A. Emmert. Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 2022. 496 S., geb., 25,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
So wird beispielsweise der hippokratische Eid heute nicht mehr "standardmäßig" von angehenden Ärztinnen und Ärzten geleistet. In Deutschland gehört er gar nicht mehr zum Studienabschluss, in den USA und in England wird eine modifizierte Version oder keine aufgesagt. Marie Gillain Boivin war keine Gynäkologin, sondern eine Hebamme. Affektive Störungen sind keine "Diagnosekategorie einander überlappender körperlicher und psychischer Störungen". Vielmehr werden darunter depressive und manische Erkrankungen zusammengefasst. Auch ist es nicht korrekt, dass mit Blick auf Herzkrankheiten, bestimmte Krebsarten und Aids/HIV Studien zu den spezifischen Auswirkungen auf den weiblichen Körper fehlen würden. Es gibt hier eine Vielzahl von Untersuchungen, die explizit Frauen betreffen. Und Gicht ist keine "dieser altmodischen Krankheiten, die durch zu viel Käse und Alkohol entstehen". Einer Gicht liegt in den meisten Fällen eine erblich bedingte Ausscheidungsschwäche für Harnsäure in der Niere zugrunde, seltener sind Ernährungsgewohnheiten oder ein angeborener Enzymdefekt die Ursache. Ein Gichtanfall mit akut entzündetem Gelenk wiederum kann dann durch ein Übermaß an Alkohol und eine Mahlzeit mit zu viel Fisch, Fleisch oder Meeresfrüchten ausgelöst werden.
Die Autorin verliert sich allzu oft in detaillierten emotionsheischenden Erzählungen über die Leiden von Frauen und Mädchen. Da ist etwa die ältere Frau mit der "wandernden Gebärmutter" im antiken Griechenland, die Vierzigjährige im siebzehnten Jahrhundert, die junge Leute verhext haben soll, was angeblich zu Anfällen führte, oder das siebzehnjährige Kindermädchen mit Panikattacken im achtzehnten Jahrhundert, die als "Hysterie mit eindeutig seelischer Ursache" missgedeutet wurden.
Es stimmt zwar, dass Frauen mehr über Schmerzen berichten als Männer. Aber dass Frauen mit ihren Schmerzen allein gelassen werden, wie Cleghorn schreibt, ist nicht belegt. Die Studien, die sie bezüglich der Versorgung mit Schmerzmitteln zitiert, sind Jahrzehnte alt. Es wäre interessant zu erfahren, wie sich die Situation heute darstellt. Was Cleghorn unter "schwachen Beruhigungsmitteln" versteht, erklärt sie nicht. Falls sie damit pflanzliche Mittel wie Baldrian, Melisse oder Hopfen meint, gehören diese in der Tat nicht zur Standardtherapie chronischer Schmerzen. Antidepressiva wirken aber durchaus gegen bestimmte Formen chronischer Schmerzen, etwa diabetisch bedingte Nervenschmerzen, Fibromyalgie oder Rückenschmerzen. Cleghorn bleibt auch den Beweis schuldig, dass, wie sie behauptet, die Schmerzen von Frauen eher auf eine emotionale oder psychische Ursache zurückgeführt werden als auf eine körperliche.
Kritisch scheint Cleghorn auch die hormonelle Verhütung zu sehen. Sie behauptet, bis heute kenne man nicht alle Auswirkungen der Präparate und Pillen-Anwenderinnen seien immer noch Versuchsobjekte. Das gilt allerdings für so gut wie alle Medikamente. Es ist unmöglich, sämtliche Auswirkungen einer Arznei zu kennen.
Es ist richtig, wie Cleghorn darlegt, dass es Jahre dauerte, bis die Nebenwirkungen der Pille im Beipackzettel erwähnt wurden. Jedoch lässt sie unerwähnt, dass die Pille zu den sichersten und beliebtesten Verhütungsmitteln überhaupt gehört; in Deutschland nutzt sie rund jede dritte Frau. Dass sich seit Jahrzehnten Mythen um die Pille ranken, wie Cleghorn schreibt, lässt sich nicht nachvollziehen.
Die Autorin leidet unter Lupus erythematodes, einer seltenen Autoimmunkrankheit. Ihre Symptome seien sieben Jahre lang als harmlos abgetan und mit Fehldiagnosen erklärt worden. Tatsächlich dauert es gerade bei seltenen Krankheiten mitunter länger, bis die Diagnose gestellt wird. Ob das aber daran liegt, dass "patriarchalisch denkende" Ärzte die Klagen der Frauen nicht ernst nehmen, bleibt fraglich. Bekannt ist dagegen, dass die Diagnose einer Depression bei Männern seltener gestellt wird, weil diese offenbar unter anderen Symptomen als Frauen leiden, die im "typisch weiblichen" Kriterienkatalog für eine Depression nicht aufgenommen sind.
Ein wesentliches Manko ist, dass Cleghorn ihre Einschätzungen nicht ausreichend mit validen Zahlen und Studien belegt. Viele der zitierten Studien entsprechen nicht dem Standard, der für Fachzeitschriften üblich ist. Vor allem die medizinischen Untersuchungen sind veraltet - etwa die von ihr "bahnbrechend" genannte Studie zu chronischen Schmerzen von 2001 oder der Bericht zur globalen Gesundheit von 2014. Ein Blick in die aktuelle Fachliteratur hätte genügt, um Dutzende neuerer Studien zu finden, die sich mit Frauen in der Medizin auseinandersetzen und ein anderes Bild der aktuellen Situation vermitteln. Lieber prangert die Autorin immer wieder das "medizinische Establishment" an, das Frauen mit Ablehnung und Zweifel begegne. Mehr Wissenschaft statt polarisierender Worte hätte dem Buch gutgetan. FELICITAS WITTE
Elinor Cleghorn: "Die kranke Frau". Wie Sexismus, Mythen & Fehldiagnosen die Medizin bis heute beeinflussen.
Aus dem Englischen von J. Elze und A. Emmert. Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 2022. 496 S., geb., 25,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
»Dieses Buch macht wütend und ist wichtig, damit sich endlich was ändert.« Christine Ellinghaus myself 20230201
Gebundenes Buch
Elinor Cleghorn ist promovierte Kulturhistorikerin. Außerdem ist sie Feministin und hat eine Autoimmunerkrankung. In Die kranke Frau vereint sie das alles einfach mal und Blick zurück auf Jahrhunderte, in denen Frauen weder ernst genommen, noch wirklich respektiert worden. Was sie …
Mehr
Elinor Cleghorn ist promovierte Kulturhistorikerin. Außerdem ist sie Feministin und hat eine Autoimmunerkrankung. In Die kranke Frau vereint sie das alles einfach mal und Blick zurück auf Jahrhunderte, in denen Frauen weder ernst genommen, noch wirklich respektiert worden. Was sie zusammenträgt ist tragisch und tut weh. Aber es ist passiert und passiert immer noch.
Männer hatten schon immer die absurdesten Ideen, wenn es um den weiblichen Körper geht. Lange hielten sich Theorien über austrocknende Gebärmütter, wenn Frauen (und auch Mädchen) nicht genug Sex hatten. So wurden sich Periodenschmerzen zum Beispiel lange erklärt). Auch die Idee, dass die Eierstöcke sich entzünden, wenn Frauen ihren Kopf zu sehr anstrengen und zum Beispiel zu viel lesen, hielt sich hartnäckig.
Aber all das ist kein Wunder, wenn Betroffenen nicht zugehört wird, sie nicht mit eingeschlossen werden. Im 14 Jahrhundert wurde in ganz Europa Ärztinnen das Praktizieren untersagt, sie hatten über Jahrhunderte kaum Chancen, sich einzubringen. Da es außerdem als Schande galt, über gynäkologische Erkrankungen zu sprechen, haben Frauen stillschweigend gelitten und brav weiter die Care-Arbeit übernommen.
Aber wir müssen gar nicht so weit zurück in die Vergangenheit. Bis in die 1990er Jahre wurden Frauen einfach ganz aus Beobachtungsstudien ausgeschlossen. (Auch in Deutschland zeigt sich in vielen Coronastudien, dass Frauen gern ignoriert werden, mal so nebenbei.)
Im 18 Jahrhundert wurde es sich dann besonders leicht gemacht. Es wird zwar langsam ein bisschen weiter geforscht, viele Dinge werden aber auch einfach direkt auf die Psyche geschoben. Frauen sind einfach zu schwach und neigen zur Hysterie.
Elinor Cleghorn gibt natürlich noch mal viel tiefere Einblicke. Die kranke Frau ist wie ein langer Zeitstrahl, in dem ausführlich erzählt wird, was alles schief gelaufen ist. Aber auch, wie viel sich verbessert hat, wie sehr Menschen (hauptsächlich Frauen) für eine Veränderung gekämpft haben.
Nach dem ersten Teil verliert sich der rote Faden für mich leicht, es ging plötzlich lange ums Wahlrecht. Natürlich spielen politische Themen immer irgendwo eine Rolle, ich fand es nur ziemlich verwirrend und hätte es schön gefunden, wenn andere Themen dafür aufgekommen wären.
Elinor Cleghorn gibt ihr bestes intersektionell zu arbeiten und bezieht auch ein wenig über den Rassismus, der mindestens genauso stark in der Medizin zu finden ist, wie der Sexismus. Das Thema kommt hier ziemlich kurz und hätte in meinen Augen noch ausgeweitet werden können, um ein wirklich realistisches Bild zu zeichnen.
Allgemein liegt der Fokus sehr auf gynäkologischen Erkrankungen. Natürlich trotzdem sehr interessant, aber ich hatte nicht ganz damit gerechnet, vor allem, weil im Klappentext ja auch von der Autoimmunerkrankung der Autorin gesprochen wird.
Elinor Cleghorn lebt mit Lupus. Für die Diagnose musste sie kämpfen, lange wollte sie niemand ernst nehmen. Dass Frauen immer noch als schwaches Geschlecht wahrgenommen werden nach allem, mit dem wir uns unbehandelt rumschlagen müssen, bringt mich fast zum lachen.
Trotz der Erwähnung im Klappentext geht es nur am Ende einmal kurz um Autoimmunerkrankungen. Auch chronische Kranken finden kurz Erwähnung. Sehr interessante Kapitel, die für mich leider fast schon schnell abgearbeitet wirken.
Die Gynäkologie war wohl einfach wichtiger und auch das war zum Glück sehr interessant. Es überrascht mich zum Beispiel gar nicht, dass die Einführung des Spekulums Kontroversen ausgelöst hat. Auch das Geburtsschmerzen als natürlich und wichtig für die Bindung zum Kind angesehen wurden, und Frauen Schmerzmittel verwehrt blieben lässt mich nur noch müde Lächeln.
Besonders interessant fand ich außerdem die Seiten zum Thema Verhütung und Hormone. Auch ihre Worte über Abtreibung treffen bei dem, was in Amerika gerade abgeht, genau ins Schwarze.
Ihr merkt also, hier werden einige Themen behandelt und ich kann hier natürlich nur au
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Körper und Macht
Es gibt Bücher, die sind so gut, dass man sie innerhalb eines Tages weg liest und dann gibt es Bücher, die sind so gut, dass man sich Zeit dafür nehmen muss.
Die kranke Frau ist ein phänomenales und augenöffnendes Buch, das mich an manchen Stellen …
Mehr
Körper und Macht
Es gibt Bücher, die sind so gut, dass man sie innerhalb eines Tages weg liest und dann gibt es Bücher, die sind so gut, dass man sich Zeit dafür nehmen muss.
Die kranke Frau ist ein phänomenales und augenöffnendes Buch, das mich an manchen Stellen sehr aufgewühlt hat. Der Inhalt vom Buch hat mich wütend gemacht, mich frustriert und mir teilweise das Gefühl gegeben, komplett hilflos zu sein. Ich konnte immer nur ein paar Seiten auf einmal lesen, bevor mein Blutdruck wieder zu hoch war.
Denn noch immer werden Frauen und ihre Leiden nicht ernst genug genommen. Bei denselben Symptomen bekommt ein Mann eher Schmerzmittel und eine Frau Beruhigungsmittel. Was sagt das über unsere Stellung in der Gesellschaft aus, wenn der Schmerz leidender Männer eher gestillt wird und leidende Frauen eher ruhiggestellt werden? Oder wenn Krankheitssymptome bei Frauen schneller auf die Psyche geschoben werden?
Unter dieser Doppelmoral leiden noch immer richtig viele und ich kenne selbst einige, die wegen sexistischer Vorurteile beinahe gestorben wären. Auch die Autorin berichtet aus ihrer persönlichen Erfahrung und beschreibt die Entwicklung der weiblichen Gesundheit von der Antike bis in die heutige Zeit.
Mich hat es komplett überrascht, wie intersektional das Thema ist und wie eigentliche Fortschritte in der Medizin wieder für ideologischen Missbrauch herhalten müssen. Es wird sehr gut aufgezeigt, wie verschiedene Vorurteile einander bedingen und aufrechterhalten, sodass eine wissenschaftliche Argumentation kaum mehr möglich ist. Und dann kommt in manchen Fällen noch die Religion dazu.
Manchmal war es wirklich sehr frustrierend, aber das macht das Buch umso wichtiger.
Für mich war es ein absolutes Highlight, mit vielen Quellen um weiter zu recherchieren, über ein Thema das leider noch immer viel zu aktuell ist.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
„Die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse“ – meine Generation wuchs mit diesem Satz aus der Tampon-Werbung auf. Aber, wie das Buch „Die kranke Frau“ von Elinor Cleghorn zeigt, war nicht nur der weibliche Zyklus, sondern der ganze …
Mehr
„Die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse“ – meine Generation wuchs mit diesem Satz aus der Tampon-Werbung auf. Aber, wie das Buch „Die kranke Frau“ von Elinor Cleghorn zeigt, war nicht nur der weibliche Zyklus, sondern der ganze weibliche Körper lange ein Rätsel für die männerdominierte Medizin. War? Kann man dem Buch mit dem Untertitel „Wie Sexismus, Mythen und Fehldiagnosen die Medizin bis heute beeinflussen“ glauben, ist die Frau in der Medizin immer noch unterrepräsentiert. Das mag in vielen Bereichen stimmen, der Maßstab vieler medizinischer Studien ist auch heute noch ein 75kg schwerer Mann. Aber so schwarz-weiß und frauenfeindlich, wie die Autorin es darstellt, ist das ganze Thema vermutlich auch nicht. Die Empörung, die sie an den Tag legt, war so unverblümt, dass sie die vielen interessanten Fakten und den Lesegenuss für mich störte. Statt eines aufrüttelnden Buchs schuf sie für mich eher ein Ärgernis. Schade.
Aber von vorn.
Lange Zeit war die Medizin ausschließlich männlich. Seit der Antike standen Männer im Mittelpunkt, Frauen waren eher „unbekannte Wesen“. Das änderte sich auch in der Neuzeit nicht. Frauen durften nicht körperlich untersucht werden, selbst ihre Obduktion war lange verboten. Bis ins späte 19. Jahrhundert durften Frauen nicht studieren, somit gab es also keine Ärztinnen, Aberglaube war überall präsent. Krankheiten wurden bei Frauen sehr lange (zum Teil auch heute noch) auf psychische Probleme (Stichwort: Hysterie) oder „wahrscheinlich sind es einfach die Hormone.“ reduziert. Wenigstens glauben moderne Mediziner nicht mehr an die „wandernde“ oder „erstickende“ Gebärmutter oder dass Frauen (vor allem während der Menstruation) andere Menschen verhexen könnten. Da spielte die ausschließlich männliche Medizin der (ebenfalls ausschließlich männlichen) Hexenverfolgung hervorragend in die Hände. Allerdings ist manchen Medizinern bis heute nicht bewusst, dass manche Krankheiten bei Männern und Frauen unterschiedliche Symptome aufweisen. Da haben sicher viele noch einiges zu lernen.
Für mich scheint sich die Autorin manchmal in ihrem Feldzug zu verrennen, einiges von dem, was sie sagt, ist nicht ganz korrekt. Weder ihre Aussagen zum Hippokratischen Eid noch die zu Gicht („Gicht ist eine dieser altmodischen Krankheiten, die durch zu viel Käse und Alkohol entstehen“) stimmen und auch in anderen Bereichen scheint ihr der Effekt wichtiger zu sein als die faktische Belegbarkeit. Ihre Schreibe ist emotional, das Buch flüssig zu lesen. Sie kämpft für die Sichtbarkeit der Frauen in der Medizin und das ehrt sie. Ihre eigene Betroffenheit und die Arzt-Odyssee, die sie auf dem Weg zu ihrer Lupus-Diagnose (Lupus erythematodes ist eine seltene Autoimmunkrankheit) durchmachen musste, spiegelt sich aber in jedem Abschnitt des Buchs, das dadurch für mich nichts Halbes und nichts Ganzes wurde. Es ist kein medizinhistorisches Werk, keine Autobiografie und kein Fachbuch. Es ist eine Mischung aus allem und verliert durch die fehlende Konstanz für mich eine Menge Kraft, die im Thema gesteckt hätte.
Ja, das Buch macht die Leserschaft stellenweise fassungslos und vielleicht hat man beim nächsten Arztbesuch (vor allem als Frau) ein unguteres Gefühl als sonst, aus Angst, man könnte eventuell nicht ernstgenommen werden. Und vor allem heute kämpfen viele mit LongCovid-Symptomatik gegen die sprichwörtlichen Windmühlen, allerdings sowohl weiblich als auch männlich gelesene Menschen. Aber das „nicht Ernstgenommen werden“ – und das weiß ich aus erster Hand – trifft nicht nur Frauen. Es trifft ebenso Homosexuelle, trans Menschen, Menschen südländischer Herkunft (Stichwort: Morbus mediterraneus) und alles in allem liegt es nicht an DER Medizin (dem „medizinischen Establishment“) oder an DEN männlichen Ärzten, sondern am jeweiligen Charakter. Da ist in der medizinischen Ausbildung noch einiges zu tun, das Buch hätte ein guter Wegweiser sein können, ist es für mich aber nicht geworden. Von mir drei Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Die Frau in der Medizin
Die Autorin Elinor Cleghorn nimmt uns mit auf eine Reise durch die Geschichte der Medizin. Doch nicht der allgemeinen, sondern der der Frau. Und wie sie eigentlich nie sonderlich beachtet wurde.
Wie auch bei ihr, werden viele Krankheiten zufällig gefunden oder weil …
Mehr
Die Frau in der Medizin
Die Autorin Elinor Cleghorn nimmt uns mit auf eine Reise durch die Geschichte der Medizin. Doch nicht der allgemeinen, sondern der der Frau. Und wie sie eigentlich nie sonderlich beachtet wurde.
Wie auch bei ihr, werden viele Krankheiten zufällig gefunden oder weil man als Frau immer und immer wieder darauf aufmerksam macht. Regelschmerzen? Sind doch normal! Endometriose? Ach was, das kommt doch nicht so oft vor. Das bilden sie sich sicher nur ein. Nein! Machen wir nicht. Und dennoch werden wir kaum Ernst genommen.
Schon die Einleitung lässt einen mit offenem Mund und Kopfschütteln zurück. Wie die Frau schon immer eigentlich nur als Gebärmaschine angesehen wird und man mit den absurdesten Mitteln versucht, Dinge zu erfinden. Eine Frau sollte immer Sex haben, damit sie bei ebster Laune bleibt udn die Gebärmutter “gefüttert” wird? Schön für den Ehemann würde ich sagen.
Und natürlich wurde Frauen, die vielleicht früher schon ein bisschen mehr von ihrem Körper verstanden haben als der Mann, das Arbeiten in der Medizin verboten. Sie wurden nicht behandelt und durften nicht helfen. Ein Teufelskreis.
Es werden viele Fakten und geschichtlicher Hintergrund zusammengetragen, die wirklich lesenswert sind und mich doch immer wieder verwundert haben. Ab und an habe ich mich mit der ausholenden Art schwer getan und brauchte auch etwas Zeit für das Buch. Doch möchte ich es dennoch empfehlen. Der Inhalt ist lesenswert und wirklich informativ. Vielleicht hilft er auch, sich seiner eigenen Beschwerden bewusst zu werden und dafür zu kämpfen, dass genauer hingesehen wird.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für