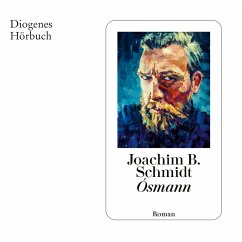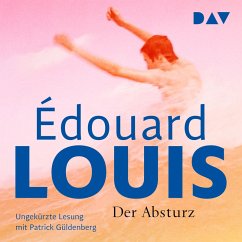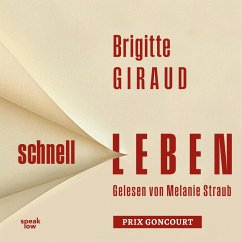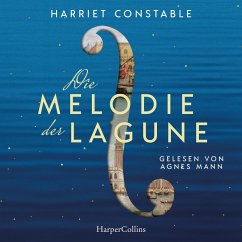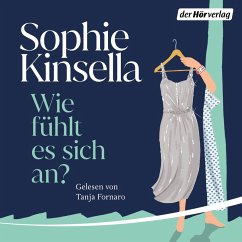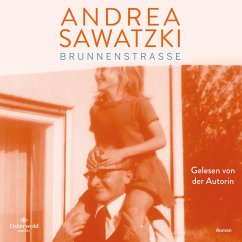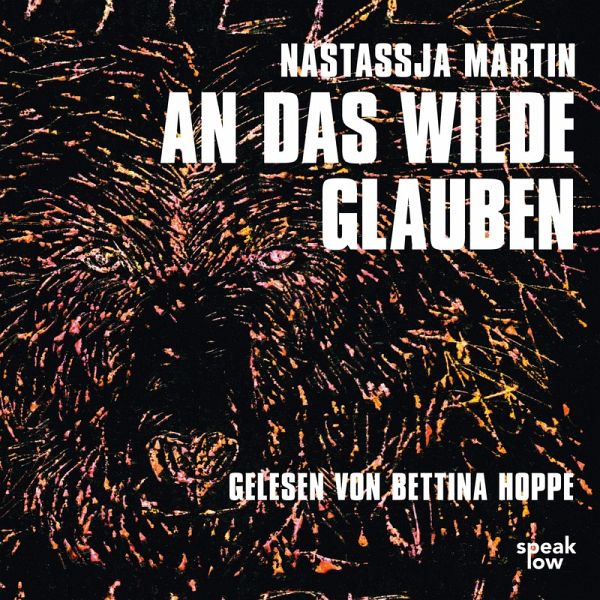
An das Wilde glauben (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 213 Min.
Sprecher: Hoppe, Bettina
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
14,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
7 °P sammeln!
Die Anthropologin Nastassja Martin teilt in dieser autobiografischen Erzählung die Geschichte einer tiefen Verletzung und deren Heilung. Eine ihrer Forschungsreisen führt sie auf die vulkanreiche russische Halbinsel Kamtschatka, wo sie die Bräuche der Ewenen studiert und dabei tief in deren Kultur eintaucht. Auf einer Bergtour begegnet sie einem Bären: Es kommt zum Kampf, den beide schwer verletzt überleben. Den Animismus, den Nastassja Martin als Wissenschaftlerin beschrieben hat, erfährt sie nun am eigenen Leib: Die Grenzen zwischen ihr selbst und dem Bären verschwimmen. Nach einer qu...
Die Anthropologin Nastassja Martin teilt in dieser autobiografischen Erzählung die Geschichte einer tiefen Verletzung und deren Heilung. Eine ihrer Forschungsreisen führt sie auf die vulkanreiche russische Halbinsel Kamtschatka, wo sie die Bräuche der Ewenen studiert und dabei tief in deren Kultur eintaucht. Auf einer Bergtour begegnet sie einem Bären: Es kommt zum Kampf, den beide schwer verletzt überleben. Den Animismus, den Nastassja Martin als Wissenschaftlerin beschrieben hat, erfährt sie nun am eigenen Leib: Die Grenzen zwischen ihr selbst und dem Bären verschwimmen. Nach einer qualvollen Genesungsgeschichte in russischen und französischen Krankenhäusern kehrt Nastassja Martin in die Wildnis zurück, wo sie durch die Nähe zur Natur und intensive Träume schließlich umfassende Heilung erfährt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.