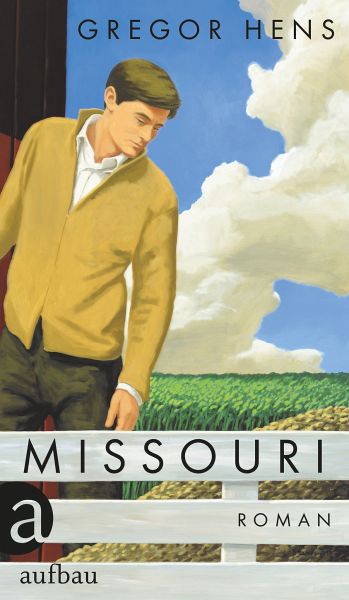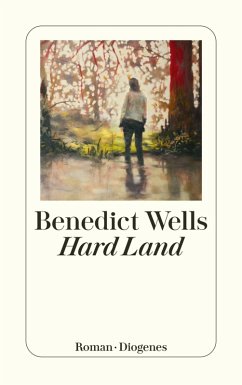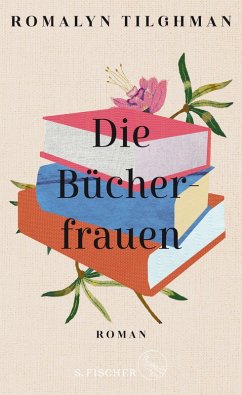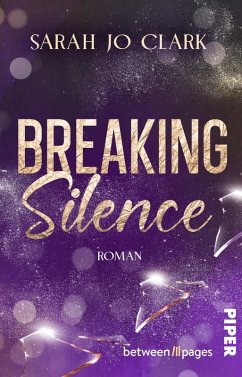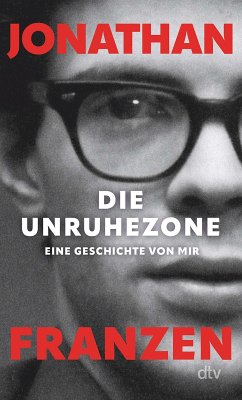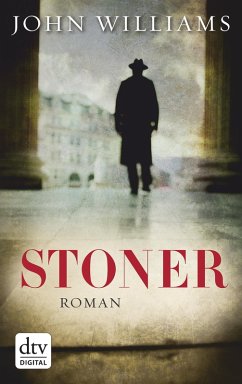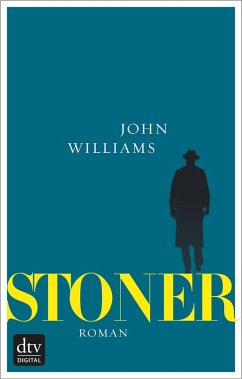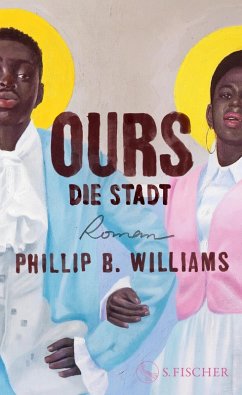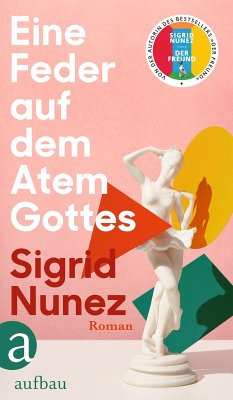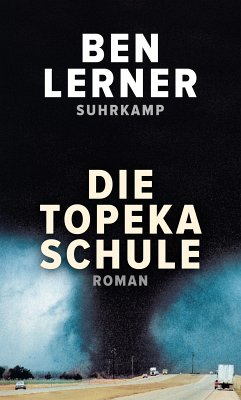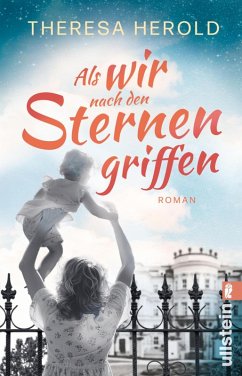Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!






Missouri (eBook, ePUB)
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 4.02MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
Gregor Hens, geb. 1965 in Köln, lehrte über zwei Jahrzehnte lang an verschiedenen amerikanischen Universitäten Sprach- und Literaturwissenschaften, zuletzt an der Ohio State University. Seit 2013 lebt er als freier Autor und Literaturübersetzer in Berlin. Er hat unter anderem Leonard Cohen, Jonatham Lethem und Kurt Vonnegut übersetzt. Für seine Übersetzung von Will Selfs Shark war er für den Übersetzerpreis der Leipziger Buchmesse nominiert. Zuletzt erschien von ihm Nikotin, das in sechs Sprachen übersetzt wurde.
Produktdetails
- Verlag: Aufbau Verlage GmbH
- Seitenzahl: 288
- Erscheinungstermin: 15. Februar 2019
- Deutsch
- ISBN-13: 9783841217196
- Artikelnr.: 54583077
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Christoph Schröder erkennt die literarische Leistung von Gregor Hens an den schwebenden Sätzen in dessen neuem Roman. Das Thema der Entfremdung kann ihm der Autor in seinem Buch als generationstypisches Symptom erklären, indem er einen jungen Westdeutschen zur Zeit des Mauerfalls erst in ein Flugzeug in die USA setzt und dann einen Trip in die noch existente DDR unternehmen lässt. Liebesgeschichte und Generationenporträt in einem erzählt der Text laut Schröder von Ambivalenz und Indifferenz.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.05.2019
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.05.2019Und als Soundtrack Lieder von Tom Waits
Nach Hause in den Mittleren Westen: Gregor Hens erzählt in seinem Roman "Missouri" die Geschichte einer Einwanderung
Der Name Stella ist in der Literatur nahezu gleichbedeutend mit der Idee von überirdischer Liebe. In Goethes gleichnamigem Schauspiel etwa wird die weibliche Hauptfigur als ein "Engel des Himmels" beschrieben, die allein durch ihre Anwesenheit den Geliebten von aller Sorge erlöst: "Wie vor ihrer Gegenwart alles heiter wird, alles frei!" Der Berliner Schriftsteller Gregor Hens geht in seinem Roman sogar noch einen Schritt weiter als Goethe, indem er Stella, die Geliebte seines Protagonisten Karl, in der Luft schweben lässt, und zwar ganz buchstäblich: Im
Nach Hause in den Mittleren Westen: Gregor Hens erzählt in seinem Roman "Missouri" die Geschichte einer Einwanderung
Der Name Stella ist in der Literatur nahezu gleichbedeutend mit der Idee von überirdischer Liebe. In Goethes gleichnamigem Schauspiel etwa wird die weibliche Hauptfigur als ein "Engel des Himmels" beschrieben, die allein durch ihre Anwesenheit den Geliebten von aller Sorge erlöst: "Wie vor ihrer Gegenwart alles heiter wird, alles frei!" Der Berliner Schriftsteller Gregor Hens geht in seinem Roman sogar noch einen Schritt weiter als Goethe, indem er Stella, die Geliebte seines Protagonisten Karl, in der Luft schweben lässt, und zwar ganz buchstäblich: Im
Mehr anzeigen
Zustand des reinen Glücks hat sie die Fähigkeit zur Levitation, das heißt, sie vermag sich jener Sphäre anzunähern, der sie als Sternenwesen ohnehin angehört. "Es passiert mir einfach", so stellt sie gegenüber dem verstörten Karl fest, nachdem dieser sie das erste Mal in schwerelosem Zustand beobachtet hat.
Das Motiv der schwebenden Geliebten ist so augenscheinlich over the top, dass es sich nicht kurzerhand als Kitsch abtun lässt. Eher liegt es nahe, nicht nur den Namen Stella, sondern auch den Namen Karl aus der Literaturgeschichte heraus zu verstehen. Hens erzählt in "Missouri", dessen Handlung in den späten achtziger Jahren angesiedelt ist, von der Neuerfindung eines jungen Einwanderers in den Vereinigten Staaten. Der literarische Bezug liegt auf der Hand: In dem Namen "Karl" klingt der Name "Karl Roßmann" aus Kafkas Amerika-Roman "Der Verschollene" mit, dessen ungläubiges, überwältigtes Staunen in einer beständigen Verschiebung vom Realistischen zum Phantastischen zum Ausdruck kommt. Genau darin treffen sich Karl und Karl also: Die Wahrnehmung Amerikas als "Zauberland der unbeschränkten Möglichkeiten" (so eine doppelsinnige Formulierung Kafkas) artikuliert sich in der Überschreitung all jener vermeintlich unumstößlichen Regeln und Vorstellungen, die für die zwei Einwanderer bisher verbindliche Geltung hatten.
Schweben, Amerika und Leichtigkeit sind in Hens' Roman Synonyme. Die Herkunft Karls wird in scharfem Kontrast dazu geschildert. Die deutsche Sprache fühlt sich für den Dreiundzwanzigjährigen an "wie schweres, überflüssiges Gepäck", alles an Deutschland ist für ihn von "unheimlicher, ungeheurer Sachlichkeit". Diese Wahrnehmung ist zurückzuführen auf seine bisherige Lebensgeschichte, vor allem auf eine tief deprimierende Kindheit und Jugend in einem katholischen Internat im Rheinland. Karls Entschluss, als Assistant Teacher in den Mittleren Westen überzusiedeln, entspringt dem Wunsch, einem Leben, das "dunkel" gewesen war, "dunkel und ohne Zauber", zu entkommen.
Und tatsächlich braucht es nur wenige Monate, um jenes frühere Dasein gegen "ein anderes, helleres Leben" einzutauschen. Ein Leben, das bestimmt wird durch einen emotionalen Dreiklang, den Karl in den Vereinigten Staaten zum ersten Mal vernimmt, nämlich "Freundlichkeit, Wohlwollen, Güte". Hinzu kommt eine ländliche Umgebung, die geprägt ist von der wärmenden Einfachheit des "American Primitive", für dessen Beschreibung der ansonsten eher nüchterne, prätentionsfreie Erzähler einen bemerkenswert hohen Ton wählt: Das bescheidene, in einem "Ozean von frischer Krume, Präriegras und Blüten" gelegene Farmhaus, in dem Stella aufgewachsen ist, erscheint Karl geradezu unwirklich, ja "wie im Traum". Die in die Erzählung eingeflochtenen ausführlichen Erinnerungen an frühere Beziehungen und Erfahrungen in Deutschland, aber auch die Wahrnehmung der Wiedervereinigung sind demgegenüber allesamt in ein kaltes, kontrastloses Graublau eingefärbt. Der junge Mann aus Deutschland findet im Mittleren Westen kein neues, sondern erstmals ein Zuhause, und zwar im vollen, also romantischen Sinne dieses Wortes. Den Soundtrack dazu liefern die Songs von Tom Waits.
Damit ist die erzählerische Fallhöhe des Romans angezeigt, und so kommt es denn auch unweigerlich zum Sturz. Karl verrät Stella und die von ihr verkörperte transzendente Liebe (die Levitation wird in der christlichen Tradition oft den Heiligen zugesprochen), indem er sich auf die erotischen Annäherungsversuche ihrer Mutter Janet einlässt. Unfähig, sich Janets "Gewalt" zu entziehen, sieht Karl irgendwann nur noch die Möglichkeit, der hochkomplexen Situation - und damit der Beziehung zu Stella - zu entfliehen. Eine neue Stelle in Berkeley bietet ihm, dem emotional heillos Überforderten, dafür eine geeignete Möglichkeit. Damit, mit dem Scheitern des amerikanischen Liebestraums, endet der Roman.
"Missouri" bietet weniger eine handlungsstarke Geschichte des Erwachsenwerdens als eine erzählerische Reflexion über ein Amerika abseits der touristischen Metropolen, über die fremde Heimat Deutschland, schließlich über die Wahrnehmung Amerikas aus europäischer Sicht - einer Sicht, die immer schon vorstrukturiert ist durch ein unübersehbares Konglomerat an Projektionen, Fiktionen und Illusionen. Aber diesem Konstruktcharakter entkommt der Roman auch selbst nicht, im Gegenteil, er stellt ihn offensiv aus: In ihm begegnet der Leser keineswegs einem wahren Amerika, sondern dem Ergebnis eines intertextuellen Spiels, in dem, um nur die Hauptreferenzen zu nennen, Franz Kafka (eben mit dem "Verschollenen") und Laura Ingalls Wilder (mit ihren "Little House"-Büchern), Vladimir Nabokov (mit "Lolita") und Mike Nichols (mit dem Komödienklassiker "The Graduate") aufeinandertreffen. Das postmoderne Schlagwort von der "Fiktion Amerikas" (Jean Baudrillard) gewinnt bei Hens konkrete, nämlich literarische Kontur.
Dass hinter den Introspektionen dieses Romans ein jahrelanges Nachdenken über Fragen der transatlantischen Selbst- und Fremdwahrnehmung steht, ist unzweifelhaft, und es wird auch durch das Leben des Autors beglaubigt, der selbst über zwei Jahrzehnte an verschiedenen amerikanischen Universitäten gelehrt hat und als literarischer Übersetzer von Autoren wie Leonard Cohen, Kurt Vonnegut und Jonathan Lethem arbeitet. Gegen die heute in Europa und Deutschland verbreitete Reduktion der Vereinigten Staaten auf den Namen ihres 45. Präsidenten bildet "Missouri" einen blickfelderweiternden und darin hochwillkommenen Kontrapunkt.
KAI SINA
Gregor Hens: "Missouri". Roman.
Aufbau Verlag, Berlin 2019. 284 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Das Motiv der schwebenden Geliebten ist so augenscheinlich over the top, dass es sich nicht kurzerhand als Kitsch abtun lässt. Eher liegt es nahe, nicht nur den Namen Stella, sondern auch den Namen Karl aus der Literaturgeschichte heraus zu verstehen. Hens erzählt in "Missouri", dessen Handlung in den späten achtziger Jahren angesiedelt ist, von der Neuerfindung eines jungen Einwanderers in den Vereinigten Staaten. Der literarische Bezug liegt auf der Hand: In dem Namen "Karl" klingt der Name "Karl Roßmann" aus Kafkas Amerika-Roman "Der Verschollene" mit, dessen ungläubiges, überwältigtes Staunen in einer beständigen Verschiebung vom Realistischen zum Phantastischen zum Ausdruck kommt. Genau darin treffen sich Karl und Karl also: Die Wahrnehmung Amerikas als "Zauberland der unbeschränkten Möglichkeiten" (so eine doppelsinnige Formulierung Kafkas) artikuliert sich in der Überschreitung all jener vermeintlich unumstößlichen Regeln und Vorstellungen, die für die zwei Einwanderer bisher verbindliche Geltung hatten.
Schweben, Amerika und Leichtigkeit sind in Hens' Roman Synonyme. Die Herkunft Karls wird in scharfem Kontrast dazu geschildert. Die deutsche Sprache fühlt sich für den Dreiundzwanzigjährigen an "wie schweres, überflüssiges Gepäck", alles an Deutschland ist für ihn von "unheimlicher, ungeheurer Sachlichkeit". Diese Wahrnehmung ist zurückzuführen auf seine bisherige Lebensgeschichte, vor allem auf eine tief deprimierende Kindheit und Jugend in einem katholischen Internat im Rheinland. Karls Entschluss, als Assistant Teacher in den Mittleren Westen überzusiedeln, entspringt dem Wunsch, einem Leben, das "dunkel" gewesen war, "dunkel und ohne Zauber", zu entkommen.
Und tatsächlich braucht es nur wenige Monate, um jenes frühere Dasein gegen "ein anderes, helleres Leben" einzutauschen. Ein Leben, das bestimmt wird durch einen emotionalen Dreiklang, den Karl in den Vereinigten Staaten zum ersten Mal vernimmt, nämlich "Freundlichkeit, Wohlwollen, Güte". Hinzu kommt eine ländliche Umgebung, die geprägt ist von der wärmenden Einfachheit des "American Primitive", für dessen Beschreibung der ansonsten eher nüchterne, prätentionsfreie Erzähler einen bemerkenswert hohen Ton wählt: Das bescheidene, in einem "Ozean von frischer Krume, Präriegras und Blüten" gelegene Farmhaus, in dem Stella aufgewachsen ist, erscheint Karl geradezu unwirklich, ja "wie im Traum". Die in die Erzählung eingeflochtenen ausführlichen Erinnerungen an frühere Beziehungen und Erfahrungen in Deutschland, aber auch die Wahrnehmung der Wiedervereinigung sind demgegenüber allesamt in ein kaltes, kontrastloses Graublau eingefärbt. Der junge Mann aus Deutschland findet im Mittleren Westen kein neues, sondern erstmals ein Zuhause, und zwar im vollen, also romantischen Sinne dieses Wortes. Den Soundtrack dazu liefern die Songs von Tom Waits.
Damit ist die erzählerische Fallhöhe des Romans angezeigt, und so kommt es denn auch unweigerlich zum Sturz. Karl verrät Stella und die von ihr verkörperte transzendente Liebe (die Levitation wird in der christlichen Tradition oft den Heiligen zugesprochen), indem er sich auf die erotischen Annäherungsversuche ihrer Mutter Janet einlässt. Unfähig, sich Janets "Gewalt" zu entziehen, sieht Karl irgendwann nur noch die Möglichkeit, der hochkomplexen Situation - und damit der Beziehung zu Stella - zu entfliehen. Eine neue Stelle in Berkeley bietet ihm, dem emotional heillos Überforderten, dafür eine geeignete Möglichkeit. Damit, mit dem Scheitern des amerikanischen Liebestraums, endet der Roman.
"Missouri" bietet weniger eine handlungsstarke Geschichte des Erwachsenwerdens als eine erzählerische Reflexion über ein Amerika abseits der touristischen Metropolen, über die fremde Heimat Deutschland, schließlich über die Wahrnehmung Amerikas aus europäischer Sicht - einer Sicht, die immer schon vorstrukturiert ist durch ein unübersehbares Konglomerat an Projektionen, Fiktionen und Illusionen. Aber diesem Konstruktcharakter entkommt der Roman auch selbst nicht, im Gegenteil, er stellt ihn offensiv aus: In ihm begegnet der Leser keineswegs einem wahren Amerika, sondern dem Ergebnis eines intertextuellen Spiels, in dem, um nur die Hauptreferenzen zu nennen, Franz Kafka (eben mit dem "Verschollenen") und Laura Ingalls Wilder (mit ihren "Little House"-Büchern), Vladimir Nabokov (mit "Lolita") und Mike Nichols (mit dem Komödienklassiker "The Graduate") aufeinandertreffen. Das postmoderne Schlagwort von der "Fiktion Amerikas" (Jean Baudrillard) gewinnt bei Hens konkrete, nämlich literarische Kontur.
Dass hinter den Introspektionen dieses Romans ein jahrelanges Nachdenken über Fragen der transatlantischen Selbst- und Fremdwahrnehmung steht, ist unzweifelhaft, und es wird auch durch das Leben des Autors beglaubigt, der selbst über zwei Jahrzehnte an verschiedenen amerikanischen Universitäten gelehrt hat und als literarischer Übersetzer von Autoren wie Leonard Cohen, Kurt Vonnegut und Jonathan Lethem arbeitet. Gegen die heute in Europa und Deutschland verbreitete Reduktion der Vereinigten Staaten auf den Namen ihres 45. Präsidenten bildet "Missouri" einen blickfelderweiternden und darin hochwillkommenen Kontrapunkt.
KAI SINA
Gregor Hens: "Missouri". Roman.
Aufbau Verlag, Berlin 2019. 284 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
»Der Roman wird von Sätzen getragen, die ihn schweben lassen.« Süddeutsche Zeitung 20190705
Gebundenes Buch
Als sich endlich die Chance bietet, greift Karl beherzt zu. Ein Job als Assistant Teacher in Columbia, Missouri, ermöglicht ihm die Flucht aus Deutschland. Die germanistische Abteilung ist überschaubar und zudem bildet sie mit dem französischen und dem russischen Institut eine …
Mehr
Als sich endlich die Chance bietet, greift Karl beherzt zu. Ein Job als Assistant Teacher in Columbia, Missouri, ermöglicht ihm die Flucht aus Deutschland. Die germanistische Abteilung ist überschaubar und zudem bildet sie mit dem französischen und dem russischen Institut eine Einheit. Schnell findet er Freunde und ebenso schnell verliebt er sich – ausgerechnet in eine seiner Studentinnen. Stella fasziniert ihn vom ersten Tag an und tatsächlich verfügt die junge Frau über ungeahnte Fähigkeiten. Sie und ihre Familie nennen es Calder Zirkus – die Fähigkeit die Schwerkraft zu überwinden und zu schweben. Im übertragenen Sinne tun sie das beide, denn die Frischverliebten schweben und lassen sich von zutiefst irdischen Gedanken nicht herabziehen. Und während Karl in den USA den Boden unter den Füßen verliert, erlebt seine Heimat die größten Umwälzungen seit dem 2. Weltkrieg.
Gregor Hens‘ Roman macht zunächst den Eindruck einer etwas verspäteten coming-of-age Erzählung, denn erst mit Anfang zwanzig emanzipiert und befreit sich der Protagonist von der Last seiner Familie und der Jugend im katholischen Internat. Der Umzug vom pulsierenden Köln in die US-amerikanische Provinz lässt für ihn die weltpolitischen Ereignisse in weite Ferne schweifen – und das, wo gerade seine Heimat der „place to be“ wäre. Dazu eine Liebesgeschichte, die nicht sein darf und sich noch unerwartet verkompliziert. Geschickt nutzt der Autor diese Rahmenbedingungen jedoch für ganz andere Themen und hier zeigt er sein wahres Können und der Roman seine ganz große Stärke.
Neben diesen oberflächlichen Begebenheiten ist die Geschichte voller Reflexion und ein Galopp durch die Linguistik und Literatur. Erst in der Ferne trifft ihn die Konfrontation mit der eigenen Sprache und ihren Fallstricken so richtig, erst die neue Situation führt ihm auch vor Augen, dass die Abenteuer der Literatur auch seine sind – hat er nicht eine verbotene Beziehung zu einer Studentin und reist mit ihr durch die USA bis zur Westküste? Stella jedoch ist glücklicherweise kein Kind mehr wie „Lolita“, aber dennoch nur ein Teenager. Aber auch eine Mrs Robinson gibt es – Karl steckt in der Falle.
Daneben die aufkommende Computertechnik, erste E-Mails – Zukunftsgespinste, die von der Zeit inzwischen längst überholt sind, Ende der 1980er aber wie Science-Fiction anmuteten. Der Roman ist voller Anspielungen, Referenzen, Intertextualität und kommt doch leichtfüßig daher. Bei der wissenschaftlich-geschichtlichen Last hätte er erdrückt werden können, aber das Gegenteil geschieht: all dies lässt ihn nur höher steigen. Dies verdankt er vor allem der unprätentiösen Sprache des Ich-Erzählers, die erfrischend jugendlich und unbedarft daherkommt und einen passenden Kontrast zu dem bietet, was mit ihr transportiert wird.
Eine Reise in die Ferne zurück zum Ich und zur Identität des Protagonisten, aber auch seiner Nationalität, fern der großen Debatten und Kriegsschauplätze. Und erfreulicherweise eine andere Seite Amerikas als die, mit der wir und momentan tagtäglich herumschlagen. Ganz eindeutig einer dieser leisen, unaufgeregten Romane, die jedoch echte Perlen darstellen.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für