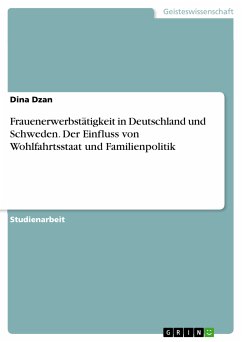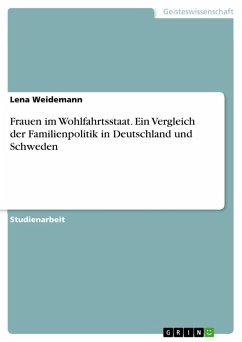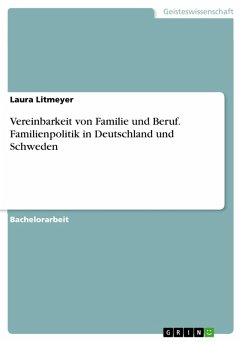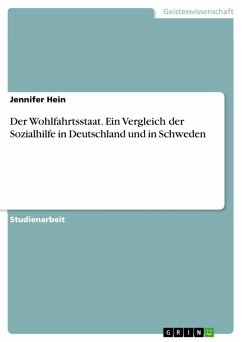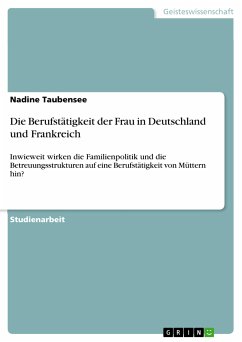Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Soziologie - Familie, Frauen, Männer, Sexualität, Geschlechter, Note: 1,7, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Gesellschaftswissenschaften), Veranstaltung: Familie und Wohlfahrtsstaat im internationalen Vergleich, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Hausarbeit sollen verschiedene theoretische Erklärungsansätze betrachtet werden, die näher auf den Aspekt Wohlfahrtsaat und Familienpolitik im Zusammenhang auf die Frauenerwerbstätigkeit eingehen. Neben der Untersuchung der Art und Weise der Partizipation, soll auch die persönliche Einschätzung der Frauen, also inwiefern sich Kinderbetreuung und Beruf ihrerseits vereinbaren bzw. nicht vereinbaren lassen beleuchtet werden. Ich möchte mich hierbei auf die Länder Deutschland und Schweden fokussieren und deren jeweilige Familienpolitik kurz beleuchten. Da Schweden allgemein als sehr frauenfreundliches Regime bekannt ist, möchte ich dieses mit dem eher 'famialistisch' geprägten Deutschland gegenüberstellen. Die Erwerbsbeteiligung von Frauen steigt seit Jahren kontinuierlich, dennoch scheint die Gründung einer Familie für viele Frauen auch einen Einschnitt in ihrer beruflichen Laufbahn zu bedeuten und stellt Frauen nicht selten vor die Herausforderung Familie und Erwerbstätigkeit zu vereinbaren. Obwohl bekannt ist, dass die Möglichkeit der Elternzeit und der Garantie der Jobsicherheit, zu einer höheren Erwerbstätigkeit von Müttern führt und zu einer stärkeren Arbeitsmarktbindung führt, führt die Geburt eines Kindes oft zur einer starken Erwerbsreduzierung seitens der Mütter, was verglichen mit Väter nicht in diesem Maße nachzuweisen ist. Eine ausschlaggebende Rolle spielen institutionellen Rahmenbedingungen, die maßgeblich Einfluss auf die Entscheidung der Mütter ausüben bezüglich ihrer weiteren Erwerbstätigkeit oder ihrer Erwerbsunterbrechung zu Gunsten der Kindererziehung. Allgemein bekannt ist, dass es erhebliche Länderunterschiede gibt, wenn es um die Erwerbstätigkeit von Müttern geht. Mich interessiert hierbei, inwiefern wohlfahrtsstaatliche Regime und Familienpolitik die Erwerbspartizipation von Frauen beeinflussen, und wie sich dies auf die Arbeitsmarktpartizipation von Müttern auswirkt. Die politische und gesellschaftliche Relevanz meines Forschungsproblems ergibt sich durch den Aspekt, dass Politiken maßgeblich Einfluss auf die Erwerbstätigkeit von Müttern zu haben scheinen und durch gegebene institutionelle Rahmenbedingungen und Maßnahmen die Vereinbarkeit maßgeblich mit beeinflussen und politische steuern können.