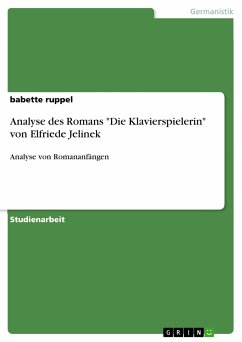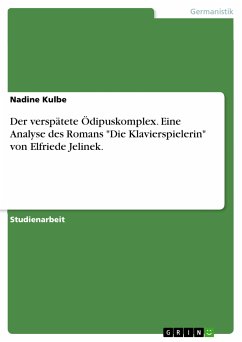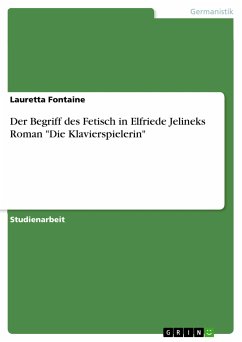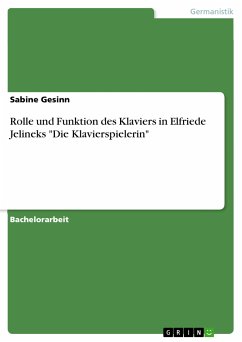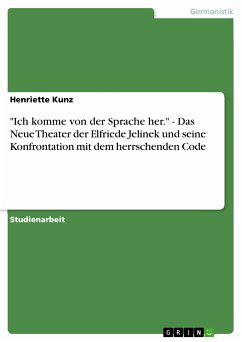Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 2,0, Freie Universität Berlin (Germanistische Linguistik), Veranstaltung: HS 16761, Sprache: Deutsch, Abstract: Gliederung: 1 Einleitung 1.1 Vorstellung der Autorin Elfriede Jelinek 1.2 Inhaltsangabe 2 Formanalyse 2.1 Erzähler (Stimme) 2.2 Modus: Distanz vs. Fokalisierung (Perspektive) 2.3 Erzählzeit und erzählte Zeit 2.4 Wortspiele und Rhetorik, Musikalität in der Erzählung 3 Sprache, Macht, Gewalt 3.1 Fazit Und um ein Gefühl für den Schreibstil der Arbeit zu bekommen hier eine kurze Sequenz: "„Erikas Eitelkeit macht der Mutter zu schaffen und bohrt ihr Dornen ins Auge. Diese Eitelkeit ist das einzige…was Erika noch aufgeben muss, ist die Eitelkeit.“ Handelt es sich hierbei um interne Fokalisierung, die im inneren Monolog restlos verwirklicht ist, oder um wortgetreue Redewiedergabe durch die Erzählinstanz? Beim Inneren Monolog verschwindet die außenstehende Erzählinstanz. Die Figur, deren „Selbstgespräch“ wir lesen, wird zur einzigen Figur, die wir noch wahrnehmen. Dafür spricht vor allem die verwendete Alltagssprache in der fraglichen Sequenz, der deutliche Perspektivwechsel in dem Einschub, der suggeriert, es handle sich um einen aufgeteilten Gedankengang und die Tatsache, dass der Text im Präsens geschrieben ist. Aber bei genauerem Hinsehen fallen zwei Aspekte auf, die einen Inneren Monolog unwahrscheinlicher werden lassen: das unpersönliche Pronomen „man“ gleich am Anfang, und das Fehlen einer inquit-Formel in Gestalt eines verbum credendi. Dass wir der Sprachverwendung Jelineks und ihrer Erzählinstanzen nicht blind vertrauen dürfen, lernen wir bereits in den ersten Absätzen. Ihre Sprache strotzt nur so vor Überraschungsmomenten.