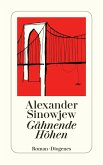Barbara Honigmann über Literatur, das Leben und jüdische Identität
Barbara Honigmann ist eine Klasse für sich: Ob sie von einer lebhaften Begegnung mit einem jüdischen Geschäftsmann im Flugzeug nach New York erzählt, die in der Frage gipfelt: Worüber reden eigentlich Gojim? Oder ob sie davon berichtet, wie sie als Vierzehnjährige in Ost-Berlin den Existentialismus für sich entdeckte. Immer tut sie es mit ihrem feinen Sinn für Komik, und wenn nötig, offen und direkt. Ihr Lebensweg führte sie aus der DDR in den Westen, von Deutschland nach Frankreich, aus der Assimilation in das Tora-Judentum. Im ganz wörtlichen Sinn ist sie 'unverschämt jüdisch' und schreibt darüber so persönlich, humorvoll und lebensklug, wie nur sie es kann.
Barbara Honigmann ist eine Klasse für sich: Ob sie von einer lebhaften Begegnung mit einem jüdischen Geschäftsmann im Flugzeug nach New York erzählt, die in der Frage gipfelt: Worüber reden eigentlich Gojim? Oder ob sie davon berichtet, wie sie als Vierzehnjährige in Ost-Berlin den Existentialismus für sich entdeckte. Immer tut sie es mit ihrem feinen Sinn für Komik, und wenn nötig, offen und direkt. Ihr Lebensweg führte sie aus der DDR in den Westen, von Deutschland nach Frankreich, aus der Assimilation in das Tora-Judentum. Im ganz wörtlichen Sinn ist sie 'unverschämt jüdisch' und schreibt darüber so persönlich, humorvoll und lebensklug, wie nur sie es kann.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Fabian Wolff hält die hier versammelten Texte von Barbara Honigmann über das Jüdischsein für meisterhaft und wertvoll. Wie die Autorin, immer nüchtern, immer auf Inklusion bedacht, in Reden und Essays sich mit dem (eigenen) jüdischen Leben in der DDR befasst, das liest der Rezensent auch als Fußnotenwerk zu Honigmanns autobiografischem Schreiben. Es geht um antisemitische Stasi-Protokolle über Honigmanns Vater ebenso wie um Anpassung und die nur behauptete "deutsch-jüdische Symbiose". Und manchmal schreibt die Autorin auch ganz wunderbar über weibliche Kopfbedeckungen im Judentum, schwärmt Wolff.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Da ist sie also, und mit was für wunderbaren Texten: Aus Barbara Honigmanns Preisreden ist ein meinungsstarkes und sehr persönliches Buch geworden.
In ihrer Dankesrede für den Zürcher Max-Frisch-Preis 2011 zitiert Barbara Honigmann das Tagebuch, in dem Frisch den Berliner Schwarzmarkt der Nachkriegsjahre erwähnt und "drei Täßlein aus Meißner Porzellan", die man dort erwerben konnte. "Das klingt erst einmal nicht so aufregend", fährt sie fort, "wenn nicht genau diese 'Täßlein' im obersten Regal meines Küchenschranks stünden."
Honigmanns Mutter hatte sie damals gekauft. Ihre Eltern waren aus dem Londoner Exil in die DDR gekommen, um ein besseres Deutschland aufzubauen, und lange hat dieser traurig gescheiterte Traum das Leben der Tochter überschattet, die 1949 in Ostberlin zur Welt kam.
Honigmann ist eine Meisterin des autobiographischen Erzählens, das zeigen auch ihre Reden bei der Entgegennahme von Literaturpreisen und Auszeichnungen. Den Band, in dem diese jetzt zu lesen sind, nennt die Autorin "Unverschämt jüdisch". Deutsche Juden - Heinrich Heine, Jakob Wassermann oder Hilde Domin, Walter Benjamin oder Gershom Scholem - schrieben oft über ihr Leben, weil es das Chaos der Moderne spiegelte. Während sie in den letzten beiden Jahrhunderten zu Deutschen mutierten, ohne wirklich akzeptiert zu werden, gaben sie sich Rechenschaft über das, was ihnen geschah, und auch bei Honigmann ist das so.
Ihrer Mutter, einer Kommunistin aus Wien, war der Vater, ein bekannter Journalist, in die DDR gefolgt, in der er sich nicht wohlfühlte, und das spürte auch seine Tochter. Doch ihr gelang es, sich zu befreien: 1984 verließ sie die DDR und bekannte sich - nicht mehr verschämt wie frühere Generationen deutscher Juden - offen zu ihren Wurzeln und lebt seither in einer modern-orthodoxen Gemeinde in Straßburg.
Ihre Dankesrede für den Max-Frisch-Preis zeigt die Spuren dieser frühen Jahre. Sie sind "eine Vorzeit meines Lebens, die ich nicht erlebt habe, die aber an mir haftet wie eine Haut, durch Überlieferung und Erzählung". Im Theaterclub "Möwe" hatten die Westemigranten, unter ihnen Bertolt Brecht, ihre Künstlerkolonie, zu der auch Honigmanns Eltern gehörten. "Äußerlich versucht H. den Fortschrittlichen und aktiven Genossen zu spielen", zitiert die Tochter aus der Stasi-Akte ihres Vaters: "Honigmann und Frau verhalten sich völlig reserviert gegenüber den Genossen, sind sehr eingebildete und angeberische Menschen und tragen auffällig westliche Kleidung."
Die Entfremdung, die dazu führte, dass Barbara Honigmann später nicht nur die DDR, sondern auch den deutschen Sprachraum verließ, reicht weit zurück. Sie erhält den Elisabeth-Langgässer-Preis 2012, und das ist eine heikle Geschichte. Der Name, so sagte sie in ihrer Dankesrede dafür, war ihr unbekannt, bevor "ich ihm in Cordelia Edvardsons Buch 'Gebranntes Kind sucht das Feuer' begegnete": im Überlebensbericht der unehelichen Tochter, die nach Auschwitz kam, weil sie Jüdin war, während ihre Mutter christlich-mystische Texte über Gott und den Teufel schrieb. Auch Langgässer entstammte dem Judentum, sie war aber katholisch aufgewachsen und antisemitisch eingestellt. In die sogenannte Innere Emigration ging sie erst, nachdem sie sich erfolglos bei den Nazis anzubiedern versucht hatte.
Über all das spricht Honigmann in ihrer Rede, und man kann sie dafür nur bewundern. Den Preis hätte sie ablehnen können, aber sie sucht keine leichten Auswege. Es ist ein dunkles Kapitel der deutsch-jüdischen Tragödie, und sie erzählt von der jüdischen Philosophin Edith Stein, die konvertierte und eine katholische Nonne geworden war. Vor Hitler floh sie nach Holland, aber die Nazis spürten sie auf, und als sie deportiert wurde, sagte sie zu ihrer Schwester, die mit ihr in den Tod fuhr: "Komm, wir gehen für unser Volk."
Mit der Mystik Elisabeth Langgässers kann Honigmann nichts anfangen, und in der Rede sprach sie es aus: "Vielleicht bin ich noch ein letztes Kind der Aufklärung, jedenfalls verspüre ich keine Neigung zum Mystischen, und am Judentum zieht mich seine helle, die Tagesseite, an und nicht die mystische, kabbalistische." In der Geschichte ihrer Familie tritt die Dialektik dieser Aufklärung deutlich hervor. Von Generation zu Generation kämpften ihre Vorfahren für die prekäre Freiheit des Geistes, und in einer zersplitternden Welt findet Honigmann Halt in der Religion. Ihre Rede beschließt sie mit dem Satz: "Ich bleibe also Jude."
Freiheit ist ein Schlüsselwort für Honigmann, die in eine Diktatur hineingeboren wurde, ohne sich ihr zu unterwerfen. Als sie 2015 den Ricarda-Huch-Preis erhält, spricht sie nicht über das Werk, sondern über das Leben der Dichterin, "einer Frau, der ihre Freiheit das Wichtigste war". Im März 1933 verfasste Gottfried Benn eine Ergebenheitserklärung an die Nazis, Huch aber weigerte sich zu unterschreiben und verließ die Preußische Akademie. "Hiermit erkläre ich meinen Austritt", zitiert Honigmann Huchs berühmtesten Satz und gestaltet sie zum Gegenbild Elisabeth Langgässers, über das zu sprechen ihr sehr viel leichter fiel.
Als Jüdin würde sie nach Palästina gehen, schreibt Huch an den emigrierten Alfred Döblin und fügt hinzu: "Vielleicht sogar, wenn ich nur jung wäre, auch ohne Jude zu sein." In diesem Satz liegt für Honigmann "ein großer Teil der Ausstrahlung, die für mich der Name Ricarda Huch hat" - und das, obwohl sie keine Zionistin ist, sondern immer noch, selbst im französischen Straßburg, eine deutsche Jüdin.
Daran ließ sie keinen Zweifel, als sie 2008 in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gewählt wurde. "Andenken an Anna Weil" nannte sie ihre Antrittsrede und ehrte damit ihre Urgroßmutter, die nahe der Akademie auf Darmstadts jüdischem Friedhof begraben liegt: sie und viele andere Vorfahren, von denen es heißt, dass sie "schon mit den Römern hierhergekommen" seien. Im Zeitraffer erzählt Honigmann da die Geschichte ihrer Familie, bis hin zum Schicksal ihrer Eltern und ihrem eigenen Weg als Künstlerin. Zuletzt zitiert sie den Propheten Sacharia: "Sie sollen mit ihren Kindern leben und wiederkommen", und sie beendete ihre Rede mit dem Satz: "Da bin ich also."
Das ist ein schöner Schluss, und den Mitgliedern der Akademie wird er gefallen haben, weil hier auch eine kleine Wiedergutmachung stattfand. Für jüdische Ohren aber hat dieser Satz noch einen anderen Klang. Der Stammvater Abraham folgt dem göttlichen Befehl, er kommt zum Berg Moria, um seinen Sohn zu opfern, und spricht zum Herrn: "Hinéni - hier bin ich." Es ist eine der schrecklichsten Szenen der Bibel, aber nur auf den ersten Blick. Denn Isaak wird ja gar nicht geopfert, und so beginnt die Geschichte des jüdischen Volkes.
Die Schriftstellerin Barbara Honigmann sollte noch viele Preise und Ehrungen erhalten. Schon ihre Dankesreden sind es wert. JAKOB HESSING
Barbara Honigmann: "Unverschämt jüdisch".
Hanser Verlag, München 2021. 159 S., geb., 20,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Barbara Honigmanns Eltern sind nach der Shoah ins sozialistische Deutschland zurückgekehrt. Immer wieder hat sie von dem Leben
zwischen Partei und Judentum berichtet. Jetzt sind ihre meisterhaften Texte in einer Sammlung erschienen
VON FABIAN WOLFF
Im Rundfunkarchiv lagert, neben vielen anderen Schätzen, eine Diskussion zum Thema „Was war jüdisch – was ist jüdisch?“ aus den frühen Neunzigern. Die Sendung diente als Fortsetzung oder Korrektiv zu einer ähnlichen über das Deutschsein, mit Henryk M. Broder als Gast in beiden. Walter Boehlich bezeichnete den Patriotismus des erzürnten Michael Wolffsohn als „Quatsch“, und auch ansonsten schien es den Diskutanten leichter zu fallen – bitte nicht Mephistopheles zitieren – zu benennen, was Jüdischsein denn alles eben nicht ist.
Die Sendung wurde vor fast genau 30 Jahren ausgestrahlt, die Frage nach Wesen und Inhalt des Jüdischseins bleibt offen, auch wenn die angebotenen Erklärungen zahlreicher und lauter geworden sind. In der aktuellen deutschsprachigen Literatur kommt vielleicht nur die Summe der Texte aus Barbara Honigmanns Sammlung „Unverschämt jüdisch“ einer Art von Antwort nah – einer Antwort von vielen, aber nicht als talmudische Responsa, sondern als Aggada, als Sammlung von Erzählungen. Die Texte sind dabei zufällig entstanden, häufig als Preis- und Dankesreden, in denen Honigmann sich mit den Namensgebern, wie Elisabeth Langgässer, oder dem Ort der Verleihung auseinandersetzt.
Was sie vereint, ist die Beschäftigung mit zwei Kernaspekten ihres eigenen Lebens, dem Schreiben und dem Jüdischsein. Im Gegensatz zu anderen verwischt Honigmann die Grenzen zwischen beiden nie zu sehr und nimmt beides für sich ernst. Oberflächlich gelesen fällt der Titel des Bandes dahinter zurück und erinnert stark an eins der „mein jüdisches Leben wieder so crazy“-Lifestyletaschenbücher der letzten Jahre. Doch er weist, wie so oft in diesen Texten, in Honigmanns Vergangenheit, und in ihr Bücherregal.
Sartres „juif inauthentique“ aus den „Betrachtungen zur Judenfrage“ ist im Ullstein-Taschenbuch von 1963 als „verschämter Jude“ übersetzt, die Lektüre des aus Westberlin geschmuggelten Bandes hatte Honigmann als 14-Jährige in der DDR auf ihren Weg zur unverschämten Jüdin gebracht. Ihre Eltern hatten sich im englischen Exil kennengelernt und waren wie selbstverständlich in die SBZ übergesiedelt. Ihre Mutter Litzi war in England mit dem Doppelspion Kim Philby verheiratet gewesen, dessen Gespenst seither durch die Popkultur geistert, und auch selbst als Agentin tätig. Ihr Vater hatte vor 1933 als liberaler Journalist gearbeitet und sich immer weiter nach links bewegt.
Als klassische jüdische Bürgerkinder hatten sie eine Reihe von anderen Ideologien anprobiert, bis sie beim Kommunismus gelandet waren. Der Schritt in die Partei war auch ein Schritt hinaus aus dem Judentum, „um einfach Mensch, Genosse, Kamerad zu sein“, wie Honigmann schreibt. Viel Tradition war eh nicht mehr vorhanden. Das lässt sich schon an der Tatsache ablesen, dass sowohl Vater als auch Großvater mit Vornamen Georg hießen. In der aschkenasischen Namenstradition werden Kinder eigentlich nur nach bereits verstorbenen Verwandten benannt.
Außenstehende finden für solche gar nicht so seltenen Biografien häufig Worte wie „interessant“ und „spannend“; wer mit ihnen im Rücken aufgewachsen ist, fühlt auch das bleierne Gewicht der Verirrungen, falschen und richtigen politischen Entscheidungen, Verrat, Lügen und sprichwörtlicher Wurzellosigkeit, aus denen sie sich zusammensetzen zu scheinen. Honigmann hat mehrere Bücher über dieses Gefühl geschrieben, ohne falsche Tränen, auch ohne die Wut von Kafkas „Brief an den Vater“, sondern mit großer Zärtlichkeit.
Die Texte aus „Unverschämt jüdisch“ lesen sich wie lohnende Fußnoten zu dem großen autobiografischen Projekt ihres Gesamtwerks zwischen Erinnerung, Aufzeichnung und mündlicher Überlieferung. Die verschiedenen Sprechanlässe erlauben Honigmann, durch die vielen Stationen und Welten ihres Lebens zu schreiten, wie als nicht unrebellische Kadertochter in Ostberlin und als junge Theaterautorin in der DDR.
Dieses unjüdisch-jüdische Leben ihrer DDR-Generation hallt bis heute nach, vor allem weil die Vertreter der nächsten, der dritten Generation gerade so laut versuchen, sich auf ihm als Grundlage zu positionieren und zu definieren. Honigmann, als Mitglied der zweiten Generation, beschönigt den Glauben ihrer Eltern an die Partei nicht und kann genau deswegen die antisemitischen Konnotationen der Stasi-Protokolle über ihren Vater herausarbeiten, ohne ihn wiederum aus seiner eigenen Verantwortung zu entlassen.
„Zu Hause Mensch und auf der Straße Jude“, zitiert sie ihren Vater. Mit ihren Schilderungen von ganz anderem Reden in der Familie und mündlich vererbtem Wissen zeigt die Tochter, dass die Umkehrung auch stimmt: nach außen Genosse, nach innen jüdisch. Es bleibt für sie ein Rätsel, warum die Eltern ausgerechnet zu den Deutschen zurückgekehrt sind. Auch in diesem vermeintlich anderen Deutschland durfte es keine Trauer über Juden als Juden im öffentlichen Raum geben.
Auch die jüdischen Remigranten „trugen diese Entstellungen der Geschichte mit; was sie in ihrem Herzen trugen, weiß ich nicht. Mit ihrer Entscheidung, in der DDR zu leben, hatten sie sich zur Anpassung an die machtpolitischen Tendenzen der herrschenden Ideologie entschieden“, schreibt Honigmann nüchtern und klar, ohne Entrüstung. Sie beschreibt diese Anpassung jüdischer und nichtjüdischer Künstler und Schriftsteller immer wieder, mal mit ambivalentem Urteil, mal mit deutlichem, wenn ein Schriftsteller mal wieder „in der Sorge, sich die Gunst der Herrschenden zu erhalten, seine dichterische Energie verschwendet hat“.
Sie selbst hat sich mit einem oft zitierten „dreifachen Todessprung ohne Netz“ dieser Anpassung entzogen und ist in den Achtzigern aus der DDR nach Frankreich, also vom Osten in den Westen, übergesiedelt, und hat mit ihrem Ehemann ein praktizierendes Leben begonnen, „von der Assimilation in das Thora-Judentum“. Aus diesem Schritt, familienbiografisch gesehen gleichzeitig zurück und vorwärts, entstand ihre leise, gar nicht großspurige Selbstgewissheit. Sie erlaubt ihr, in den oft tragischen Vertretern einer behaupteten deutsch-jüdischen Symbiose wie Jakob Wassermann beide Elemente wertzuschätzen und nicht gegeneinander auszuspielen. Bei den von Isaac Deutscher beschriebenen „non-Jewish Jews“ wie Heine (oder ihren eigenen Eltern) muss sie das Nichtjüdische an ihnen nicht als in Wahrheit auch jüdisch auslegen, sondern kann die dialektische Spannung aushalten.
Vor allem hat sie nicht zu fragen aufgehört. Wenn sie einer Strömung angehört, dann wohl der modern-orthodoxen „Schomer Mitzwot“, das heißt, „uns ohne übertriebenen Eifer darum bemühen, die Gebote und Verbote zu beachten“, wie sie in einem schönen Text über die Frage weiblicher Kopfbedeckungen im Judentum schreibt. Auch wenn Kulturjudentum und Zionismus (in der Praxis laut Honigmann eh nur eine Spielart von ersterem) als valide Entwürfe jüdischer Identität verhandelt werden, so ist es eben die Religion, die die Antwort auf die Frage gibt, was jüdisch sei. Auf die anschließende, in den letzten Monaten häufig mit großer Perfidie vorgetragene und beantwortete Frage, wer eigentlich jüdisch ist, würde Honigmann wohl oder mit Sicherheit antworten, dass es Kinder jüdischer Mütter oder orthodox anerkannte Konvertiten sind. Mit Sicherheit würde diese Antwort aber nicht auf Ausschluss, sondern auf Einladung abzielen.
Honigmann selbst stellt, wie in einer Erinnerung an ein spontanes Gespräch mit einem jüdischen Sitznachbarn im Flugzeug, die viel profundere Frage, wie Juden sich zueinander in Beziehung setzen sollen. Ihre eigene Antwort wäre wohl, abermals ohne übertriebenen Eifer, mit ernsthafter Toleranz und ohne Missgunst. Auch das ist ein Ergebnis ihrer Selbstgewissheit als Jüdin. Barbara Honigmann, das macht ihre meisterhaften Texte hier so wertvoll, muss niemandem etwas beweisen, vor allem nicht sich selbst.
Ihre Eltern hatten eine Reihe
anderer Ideologien anprobiert, bis
sie beim Kommunismus landeten
Honigmann stellt die profunde
Frage, wie Juden sich zueinander
in Beziehung setzen sollen
Barbara Honigmann: Unverschämt jüdisch. Hanser, München 2021. 155 Seiten, 20 Euro.
Barbara Honigmann ist 1949 in Ost-Berlin geboren. Zuletzt erzählte sie in ihrem Roman „Georg“ die Lebensgeschichte ihres Vaters.
Foto: Peter-Andreas Hassiepen/Hanser
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
"Die Texte aus 'Unverschämt jüdisch' lesen sich wie lohnende Fußnoten zu dem großen autobiografischen Projekt ihres Gesamtwerks zwischen Erinnerung, Aufzeichnung und mündlicher Überlieferung. [...] Barbara Honigmann, das macht ihre meisterhaften Texte hier so wertvoll, muss niemandem etwas beweisen, vor allem nicht sich selbst." Fabian Wolff, Süddeutsche Zeitung, 27.10.21
"Man lernt Barbara Honigmann mit jedem Text ein bisschen besser kennen und fühlt sich zugleich aufgefordert, an anderer Stelle weiterzulesen." Bettina Baltschev, MDR Kultur, 13.10.21
"Da ist sie also, und mit was für wunderbaren Texten: Aus Barbara Honigmanns Preisreden ist ein meinungsstarkes und sehr persönliches Buch geworden [...] Honigmann ist eine Meisterin des autobiographischen Erzählens" Jakob Hessing, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.09.21
"Man lernt Barbara Honigmann mit jedem Text ein bisschen besser kennen und fühlt sich zugleich aufgefordert, an anderer Stelle weiterzulesen." Bettina Baltschev, MDR Kultur, 13.10.21
"Da ist sie also, und mit was für wunderbaren Texten: Aus Barbara Honigmanns Preisreden ist ein meinungsstarkes und sehr persönliches Buch geworden [...] Honigmann ist eine Meisterin des autobiographischen Erzählens" Jakob Hessing, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.09.21