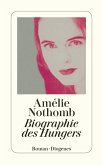EIN ROMAN ÜBER MACHTMISSBRAUCH, MANIPULATION UND DIE UNTIEFEN MENSCHLICHER ABGRÜNDE
Seit fast zwanzig Jahren arbeitet Grün als Pfleger auf der geschlossenen Station einer Psychiatrie. Manche Patienten kommen immer wieder, andere verschwinden, bevorer ihre Namen kennt. Aber sie fällt ihm auf. Wer ist diese Frau? Annika Domainko erzählt die aufwühlende Geschichte zweier haltloser Menschen, sie erzählt von der Angst vor dem Zusammenbruch, von Kontrollverlust und Macht. «Ungefähre Tage» ist ein Roman, der auf der Suche nach Gewissheit jede Sicherheit infrage stellt.
Sie ist Patientin auf der geschlossenen Station einer Psychiatrie, leidet an Wahnvorstellungen, hört Stimmen, doch dann gibt es wieder diese Momente völliger Klarheit. Grün, der als Pfleger auf Station arbeitet, ist wie gebannt von dieser Frau. Durch sie scheint er seinen stumpfen Routinen zu entkommen und wagt es sogar, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen. Endlich kann er sprechen, von sich, von dem, wofür er zuvor keine Worte hatte. Und auch wenn der Halt, nach dem er greift, lose ist, könnte diese Frau doch seine Rettung bedeuten. Wäre es denn so fatal, sich näherzukommen? Und wie groß ist die Gefahr, in einem fremden Leben zu verschwinden? «Ungefähre Tage» ist das Psychogramm zweier Menschen im Ausnahmezustand. Wie unter einem Brennglas leuchtet diese Geschichte Machtmissbrauch, Manipulation und menschliche Abgründe aus.
Klug, fesselnd, verstörend - die Psychiatrie als Brennglas der Gesellschaft Für die Leser:innen von Annie Ernaux, Angelika Klüssendorf, Antje Rávik Strubel oder Clemens J. Setz Annika Domainko betreibt ein gekonntes Spiel mit der Wahrheit und lässt Grenzen auf raffinierte Weise verschwimmen
Seit fast zwanzig Jahren arbeitet Grün als Pfleger auf der geschlossenen Station einer Psychiatrie. Manche Patienten kommen immer wieder, andere verschwinden, bevorer ihre Namen kennt. Aber sie fällt ihm auf. Wer ist diese Frau? Annika Domainko erzählt die aufwühlende Geschichte zweier haltloser Menschen, sie erzählt von der Angst vor dem Zusammenbruch, von Kontrollverlust und Macht. «Ungefähre Tage» ist ein Roman, der auf der Suche nach Gewissheit jede Sicherheit infrage stellt.
Sie ist Patientin auf der geschlossenen Station einer Psychiatrie, leidet an Wahnvorstellungen, hört Stimmen, doch dann gibt es wieder diese Momente völliger Klarheit. Grün, der als Pfleger auf Station arbeitet, ist wie gebannt von dieser Frau. Durch sie scheint er seinen stumpfen Routinen zu entkommen und wagt es sogar, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen. Endlich kann er sprechen, von sich, von dem, wofür er zuvor keine Worte hatte. Und auch wenn der Halt, nach dem er greift, lose ist, könnte diese Frau doch seine Rettung bedeuten. Wäre es denn so fatal, sich näherzukommen? Und wie groß ist die Gefahr, in einem fremden Leben zu verschwinden? «Ungefähre Tage» ist das Psychogramm zweier Menschen im Ausnahmezustand. Wie unter einem Brennglas leuchtet diese Geschichte Machtmissbrauch, Manipulation und menschliche Abgründe aus.
Klug, fesselnd, verstörend - die Psychiatrie als Brennglas der Gesellschaft Für die Leser:innen von Annie Ernaux, Angelika Klüssendorf, Antje Rávik Strubel oder Clemens J. Setz Annika Domainko betreibt ein gekonntes Spiel mit der Wahrheit und lässt Grenzen auf raffinierte Weise verschwimmen

Isolation, Klaustrophobie, Ausbruch und böse Träume: In den Debüts des Frühjahrs sind Echos der Pandemie zu hören. So einfach ist es aber dann doch nicht.
Ein Haus im Wald, aus dem keine Türen nach draußen führen, aber irgendwie müssen die Menschen, die hier wohnen, doch hineingekommen sein. Ein Dorf, aus dem junge Menschen verschwinden, aber wohin gehen sie, und was hat eine sprechende Eule in Lackschuhen damit zu tun? Eine Psychiatrie am Rande der Stadt als Transit-Ort zwischen innerer und äußerer Welt, aber mit so porösen Grenzen, dass ein Pfleger sie übertritt. Und eine religiöse Minderheit in einer westfälischen Kleinstadt, deren Familien aus der Abschottung immer schon Kraft und Identität ziehen, nur was geschieht mit denen, die sich der Tradition nicht mehr beugen wollen?
Isolation, Klaustrophobie, Stillstand, Ausbruch: In den Debüts dieses Frühjahrs von Elina Penner, Annika Domainko, Tatjana von der Beek und Sven Pfizenmaier ist kein einziges Mal von Pandemie die Rede. Und doch spielen sie alle mit Leitmotiven, die man auch aus dem Lockdown kennt. Erzählen von einsamer Verzweiflung und Dissoziation, unheimlichen Träumen und Begegnungen mit Tieren, von Vorratshaltung, Drogen und Geheimverstecken, vom ewigen Drinnensein und der Sehnsucht nach dem Draußen, vom Fremdeln mit diesem Draußen, das auch gefährlich werden kann, von Regeln als Selbstzweck und Kontrolle durch Verfahren. Sie erzählen von Familien unter Druck, Zusammenbruch, Überlastung und immer wieder dann vom Ausbruch: Weg hier, raus hier, Ende, aus, es kann nicht so weitergehen, es muss anderswo weitergehen.
Diese Motive und Erfahrungen hat es natürlich auch jenseits der Pandemie schon gegeben. In der Literatur sind sie oft durchgespielt worden, "das einsame Haus" ist ein Genre für sich, geschlossene Räume und Gesellschaften und was sie Menschen antun ebenso. Der unheimliche Effekt der letzten vierundzwanzig Monate scheint aber zu sein, wie Isolation und Dissoziation unter dem Eindruck von Quarantäne, Homeschooling und Homeoffice zu etwas geworden sind, das man nicht mehr nur aus Büchern kennt, sondern aus dem eigenen Alltag.
Man liest diese vier neuen und sehr unterschiedlichen Romane mit einem anderen Bedürfnis nach erzählerischer Spiegelung einer Gegenwart, aus der man ja selbst rauswill. Und fühlt sich seltsam angezogen von der Klaustrophobie und der körperlichen und seelischen Beanspruchung, die alle vier auf ihre Weise beschreiben. Keinen einzigen Leitartikel zur Corona-Gesellschaft will man ja eigentlich noch lesen, in diesem dritten Corona-Frühjahr. Und erst recht keine programmatischen "Corona-Romane". Aber die Suche nach Antworten auf die seltsamen Erfahrungen der letzten Zeit (und auf die Tics, die man selbst entwickelt hat) hört damit ja nicht auf.
Diese Antworten findet man also in der neuen Literatur, selbst wenn sie sich diese Fragen so gar nicht gestellt hat: in einer komischen Dystopie wie Sven Pfizenmaiers "Draußen feiern die Leute". Oder in einem lähmenden Kammerspiel wie Tatjana von der Beeks "Die Welt vor den Fenstern". In einer Zerfallsstudie wie Annika Domainkos "Ungefähre Tage". Oder einer Emanzipationschronik wie Elina Penners "Nachtbeeren". Alle vier Debüts erzählen, mal mehr, wie bei Sven Pfizenmaier, mal weniger, wie bei Elina Penner, aus einer verschobenen Realität: Der herkömmliche Ablauf der Dinge ist unterbrochen, oder die Dinge laufen nicht herkömmlich ab, oder unerhörte Dinge passieren wie sonst nur in Novellen, ein Riss tut sich auf in der Wirklichkeit. Und falls Leonard Cohens berühmte Songzeilen wirklich stimmen sollten, there is a crack in everything / that's how the light gets in, dann fällt durch diesen Riss in den Dingen zwar vielleicht das Licht ins Leben, aber manchmal kriecht eben auch ganz was anderes hinein. Durch die wabernden Wände.
"Ich war es gewohnt, durch die Türen von einem Zimmer in das nächste zu treten, doch einen Weg in die Welt vor den Fenstern gab es nicht. Unser Haus lag mitten auf einer großen Wiese, an dessen Rändern der Wald stand wie eine Wand." Maia, die Erzählerin aus Tatjana von der Beeks "Die Welt vor den Fenstern", lebt mit Mutter, Cousine, Tante, Onkel und Großmutter in einem Vakuum aus abgezählten Dingen (sechs Teller, sechs Tassen), verteilten Aufgaben (Feuer machen, Milch einschenken) und ritueller Beschäftigung mit Tierkreiszeichen, Astronomie, Mythologie und Torten. Alle im Haus dürfen nur einen Gegenstand besitzen, Fehler werden hart bestraft, nicht mal in den Träumen des Mädchens gibt es eine Alternative zu dieser Enge. Und niemand darf raus.
Die Tante ist schwanger, aber offenbar nicht vom alten Onkel, der nach Schwefel aus dem Mund riecht. Maia hadert mit der Kälte der Mutter, die ihre Tochter eifersüchtig beobachtet, es gibt Zonen im Haus, die nur für Erwachsene sind, und während man Maia immer nervöser dabei zuschaut, wie wiederum sie selbst den anderen im Haus zuschaut, merkt man irgendwann, dass sich dieser Roman, der minutiös von Abläufen und Ritualen erzählt, selbst an minutiösen Ablaufbeschreibungen festhält. Was den seltsamen Effekt hat, dass man als Leser mit jeder Seite nur noch mehr nach draußen will, die Autorin aber ihren Roman immer nur tiefer nach innen treibt, ins Innere des Hauses und der Hirnwindungen des Mädchens.
Fast ist es, als sei Tatjana von der Beek, Absolventin des Hildesheimer Literaturinstituts, dieser unheimliche Plot selbst zu unheimlich, um ihm freien Lauf zu lassen: Das Haus wirkt wie ein Folterkeller, den man auf Etsy bestellen kann, mit Leinen und feinen Bleistiften und alten Schüsseln. Der Überschuss an Affekten, die sich in diesem Roman stauen, kann sich nicht entladen - vielleicht, weil die Autorin an diesem Horror eines ewigen Drinnens eher der verstörende Aspekt interessiert, dass auch das eine Heimat werden kann. Und sie den Leser, sicher gewollt, mit der Frage allein lässt, ob das hier eine Sekte ist, ein gemeingefährlicher Kult, ein Albtraum.
Ganz anders geht Annika Domainko mit dem Affektstau in ihrem Psychiatrieroman "Ungefähre Tage" um - dem man einen weniger schreibschulartigen Titel gewünscht hätte, weil am Pfleger Grün, dem man in dieser Geschichte in den Meltdown folgt, gar nichts ungefähr ist.
Grün, ein Mann in den Vierzigern mit junger Frau und neugeborener Tochter, schmeißt Pillen, die er aus dem Arzneischrank klaut. Er hat offenbar höhere akademische Ambitionen gehabt, aber projiziert seine Minderwertigkeitsgefühle jetzt lieber auf seine Schwiegereltern, die ihn angeblich für seinen "Frauenberuf" verachten. Grün hört noch immer die alten Platten von damals, trägt Doc Martens, raucht Selbstgedrehte - und manipuliert eine junge Patientin mit roten Haaren, die eines Tages "auf Station" eingewiesen wird und die er eigentlich betreuen soll. Stattdessen zieht er sie in seine eigene Krise hinein.
Die Station, auf der sich beide begegnen, verklärt Grün, ganz Bildungsbürger, zum "Temenos", eine altsprachlich aufgebauschte Ausrede für seine Manipulation, eigentlich hat er das vom Temenos aber auch nur gerade in einem Podcast gehört: "Ein abgegrenzter, aus der Umwelt herausgeschnittener Bereich, eine sakrale Insel im Profanen, die durch diese Abtrennung einer Gottheit geweiht wurde, Raum für das Nicht-Alltägliche, in sich geschlossen mit klaren Regeln und Ritualen für das Drinnen und Draußen."
Die klaren Regeln aber bricht Grün, wir haben hier "auf Station" doch alle nur Funktionen, erklärt er der Frau irgendwann, als gäbe es keinen Unterschied zwischen ihm und ihr, und dann rutscht er nach und nach in seine eigene Psychose hinein - was Domainko, promovierte Althistorikerin, in größtmöglicher Kälte inszeniert: Kurz vor dem Ende ihres Romans wechselt sie die Perspektive, lässt Grün nicht mehr selbst sprechen, als Ich, sondern lässt ihn sich selbst von außen beschreiben, längst sind da die Perspektiven aufgefaltet - und der Mann, "auf Station", gefangen in den Varianten seiner eigenen seelischen Showdowns.
Das Drama einer suspendierten Zeit und eines Ortes, außerhalb der Koordinaten, in denen eigene Regeln wirken - Sven Pfizenmaier gibt in "Draußen feiern die Leute" ziemlich genau an, wo sein Roman spielt: zwei Regionalbahnstationen von Hannover entfernt, in einer Gegenwart, die unserer ähnelt. Nur dass da eine Oma in diesem Dorf lebt, die fast hundertsiebzig Jahre alt ist. Und ein Mädchen, Valerie, das 45 Tage am Stück schläft. Und Richard, ein Freund von ihr, der alle in Trance versetzt, die nur in seine Nähe geraten, "du bist und bleibst mein Sohn", sagt seine Mutter, "aber was soll ich machen, mir fallen die Augen zu, wenn ich dich sehe".
Irgendetwas wabert in den Wänden. Häuser tun Dinge. Ein Schatten vertickt Drogen. Und der Boss dieses Schattens ist eine Eule, Rasputin, und diese Eule bietet all jenen, die verschwinden wollen, eine "ewige Fahrt" an. Wer weiß, wohin die geht. Jedenfalls kommen die, die gehen, nicht wieder, und die, die sie suchen, verschwinden auch - und wie eigensinnig im Ton Pfizenmaier diese Geschichte erzählt, wie er einfach eine kleine Welt in die größere Welt hineinstellt, die unserer ähnelt, und dort Dinge geschehen lässt, über die sich niemand mehr wundert, ist lustig und furchteinflößend und hinreißend. Eine täuschend echte, andere Gegenwart der Seltsamkeit. Die Moral der Geschichte ist: Auch wenn noch so viele ausbrechen, nicht mehr weitermachen wollen und verschwinden, auch wenn Tiere sprechen und man Bier durch die Wand einer geschlossenen Dose trinken kann: Am Ende ist doch wieder Weihnachtsmarkt, wie jedes Jahr, und der Provinzterror wütet weiter.
Nur ein paar Regionalbahnstationen von Hannover entfernt spielt auch die Geschichte, die Elina Penner in "Nachtbeeren" erzählt. Die Autorin stammt aus einer Familie der freikirchlichen Mennoniten, wurde 1987 in der Sowjetunion geboren, 1991 wanderte ihre Familie nach Ostwestfalen aus, dort wurde Elina Penner groß, dort lebt sie heute auch wieder, dort, in Minden, spielt ihr Roman über eine Gemeinschaft, die nach klar umrissenen Regeln lebt: "Was wir machen, machen wir zusammen. Wenn wir ein Land verlassen, machen wir das zusammen."
Sie sind aus der Sowjetunion, wo plattdeutsch sprechende Mennoniten seit dem 18. Jahrhundert gelebt haben, wo sie zwangsumgesiedelt und drangsaliert wurden, am Ende des 20. Jahrhunderts nach Deutschland gekommen. Sie sind also in die Heimat ausgewandert - aber wer sollte das verstehen, der nicht dazugehört? Nach außen, für die "Hiesigen", die "Kartoffeln", die deutschen Nachbarn um sie herum, bleiben die mennonitischen Familien nur die "Russlanddeutschen", deren Namen bei der Einreise eingedeutscht wurden, die in Sozialbauten leben, bis sie sich leisten können zu bauen, und dann bauen sie alle, weil keiner mehr auf zwölf Quadratmetern leben will wie anfangs, im Auffanglager.
Nelli ist eine von ihnen. Der Mann geht arbeiten, ihre Aufgabe ist das Haus, staubfrei, streifenfrei, kein Krümel: "Ich bin eine 35-jährige gläubige, fromme und bekehrte Mennonitin, und mein Mann ist weg. Vielleicht, um bei der Frau zu sein, die er liebt. Ich frage mich, ob einer meiner Brüder ihn töten würde, wenn ich nur den Mund aufkriegen und fragen würde." Der Mann, Kornelius, liegt eines Tages wirklich zerstückelt im Tiefkühlfach neben Toastbrot und Blini, dort findet ihn Jakob, sein Sohn. Nelli aber ist verschwunden, und jetzt ruft der Sohn seine Onkel, Nellis Brüder also, und was auch immer passiert ist: Untereinander klären sie, was als Nächstes passieren muss.
Und was da geschehen ist und dann passiert, erzählt Elina Penner mit Gespür für Dialoge und Verknappungen in Tagebucheinträgen der Beteiligten: ein paar Tage im Mai 2020, ein paar Tage im Mai zehn Jahre zuvor. Nelli bricht auseinander, als ihre Öma stirbt, und mit ihr der Beweis, dass Eigensinn auch in der engsten Welt möglich ist. Am Ende des Romans hat sie diesen Beweis selbst noch einmal erbracht. Aber auf dem Weg dahin musste sie die enge Welt sprengen. TOBIAS RÜTHER
Tatjana von der Beek, "Die Welt vor den Fenstern". Ecco, 256 Seiten, 20 Euro.
Annika Domainko, "Ungefähre Tage". C.H. Beck, 222 Seiten, 23 Euro.
Sven Pfizenmaier, "Draußen feiern die Leute". Kein & Aber, 336 Seiten, 24 Euro.
Elina Penner, "Nachtbeeren". Aufbau, 248 Seiten, 22 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

also ich
Liebe im Ausnahmezustand: Drei Romane machen
die Klinik zum Ort literarischer Freiheit
VON MARIE SCHMIDT
Ein Hauch von Ewigkeit liegt über diesen Geschichten. In der ersten gibt es ein Schwesternwohnheim am Stadtrand und ein Krankenhaus, in dem eine Frau morgendlich den Dienst antritt. Die anderen Schwestern raten, „komm hierher, erledige deine Aufgaben, und dein Kopf wird dir treu bleiben. Du wirst mit jeder Wiederholung besser werden, bis die Arbeit in dir drin ist.“ Die Routine wirkt: „Ich konnte mir keine andere Welt für mich denken“, sagt die Erzählerin.
Ihre Arbeit besteht darin, „neuartige Eingriffe“ zu unterstützen, bei denen Patientinnen ihre psychischen Störungen chirurgisch aus dem Gehirn entfernt werden sollen. Es gab diese Methoden der Lobotomie zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Psychiatrie. Aber so wie Yael Inokai in dem Roman „Ein simpler Eingriff“ davon erzählt, auch von altmodischen Schwesternuniformen, selbstsicheren Patriarchen, Ärzten und Vätern der Patientinnen, entsteht der ambivalente Eindruck einer futuristischen Vergangenheit. Da ist ein Zug von „Handmaid’s Tale“, der im Unklaren lässt, ob hier von einer historischen oder dystopischen Zeit die Rede ist.
Das ist die subtile Kunst der Abstraktion, Zeit und Raum so aus der Erzählung zu filtern, dass der Roman selbst nachahmt, wovon er handelt, „die vollkommen anderen Räume“, wie Michel Foucault die Bereiche genannt hat, die zu ordentlich organisierten Gesellschaften dazugehören, aber eben als Ressorts dessen, was sich in ihre Normalität nicht einordnen lässt. In Psychiatrien, Heimen, Gefängnissen und Ferienkolonien herrsche eine entrückte Zeitform, diese Orte seien gut abgegrenzt, aber in ihrem Inneren gälten gewöhnliche Unterschiede nichts mehr, war seine Beschreibung, die enorm prägend wurde für eine bestimmte Form der Gesellschaftsbeobachtung. Und seitdem leider auch zur idée reçue, zum Kritikschlager, paranoid gesteigert in der These vom Ausnahmezustand, der selbst zur Normalität geworden sei, mit der der italienische Philosoph Giorgio Agamben in den Nullerjahren die Geisteswissenschaften verstörte.
Literarisch haben solche Schauplätze oft eine andere Funktion: Es sind Umgebungen, in denen Ambivalenzen erhalten bleiben können, in denen soziale Regeln in ihrer ganzen Härte und zugleich von außen sichtbar sind, in denen das moralische Urteilen einen schwebenden Moment lang aussetzt. Daraus kann ein geradezu romantisches Umfeld werden.
Wie eben im dritten Roman der 1989 in Basel geborenen Yael Inokai. In der entrückten, geisterhaften Szenerie dieses Buches schafft sie sich die erzählerische Freiheit für eine feine, naive Sensibilität. Die Hauptfigur Meret arbeitet als Krankenschwester und ihre Methode ist das Mitgefühl. Sie sieht den Patientinnen in die Augen, die während der Gehirnoperation wach bleiben sollen, damit der Chirurg die „richtige“ Stelle trifft: „Ich achtete auf jedes Wort und jeden Blick. Ich nahm den Menschen ihre Angst“. Die Grenze zwischen Ich und Du löst sich in klinischer Empathie auf.
In der Abgeschiedenheit der Klinik verliebt sich diese extrem durchlässige Frau in eine andere Krankenschwester, mit der sie das Zimmer im Wohnheim teilt. Die Erzählstimme stört die Heimlichkeit durch kein Urteil, keinen Konventionalitäts-Trigger: die Liebesgeschichte ist reines Gefühl, vibrierende Wahrnehmung der Körper und nach einer sterbensschönen Sexszene ein Moment der Scham, Fremdheit und Erkenntnis: „Das war also ich. So sah ich aus.“ Dem Ausnahmeort sei Dank eine Liebe, die ganz aus dem Genderspektrum fällt, könnte man meinen, eine zwischen Menschenkindern. Bis eben doch eine Frage durch die Handlungsebenen schneidet: „Würden sie das nicht über uns beide sagen? Dass das eine psychische Störung ist?“
Damit verliert die verkapselte Welt ihre Sicherheit und die Frage ist, ob die Frauen die abgeschottete Welt der Klinik auch verlassen können, ob sie entkommen. Auf ihrer Instagram-Seite empfiehlt Yael Inokai häufig Bücher: welche, die mit der Zeitschrift „Politisch Schreiben“ zu tun haben, zu deren Redaktion sie gehört, und immer wieder auch welche über lesbische Frauen. In diesen Kanon fügt sich ihr Roman in seiner Zeitlosigkeit als besonders kostbares Beispiel. Man könnte ihn aber eben auch zu den Psychiatrieromanen zählen, die so verstreut erscheinen, dass nie ein fixes Genre daraus wird. Aber es gehen die charismatischsten Bücher daraus hervor, zuletzt Clemens J. Setz’ monumentaler Roman „Die Stunde zwischen Frau und Gitarre“ von 2015.
Von der Klinik als schützendem Raum für eine nach den Maßstäben „draußen“ ungehörige Liebe, erzählt auch Annika Domainko in „Ungefähre Tage“: Ein Psychiatriepfleger entwickelt eine fatale Bindung zu einer Patientin. Domainko treibt einen enormen sprachlichen Aufwand, um die Grenze aufzubauen, die dieser Mann täglich überschreitet, zwischen der gewöhnlichen Welt und dem Klinikleben, Desinfektionsmittelgeruch, Diagnoseschlüssel ICD-10, aus der Fasson geratene Körper. Die sogenannte Normalität bleibt daneben betont trivial: Es gibt eine Partnerin des Erzählers, ihr gemeinsames Kind, bourgeoise Schwiegereltern, die auf den Pfleger herabschauen.
In seiner Patientin erkennt er schließlich etwas von sich selbst wieder, das er in seinem Familienalltag zu verbergen versucht hatte. Eine Drogenvergangenheit wird angedeutet und die auch seelisch befestigten Grenzen zwischen der Welt der Psychiatrie und der draußen werden weich. An der Liebesgeschichte prägen sich ein paar der bekannten Probleme der Heterosexualität aus, Machtspielchen zwischen einem älteren Mann und einer jüngeren Frau. Von außen, von Dritten beobachtet klar zu erkennen als Missbrauch einer Schutzbefohlenen.
Der Roman leidet etwas darunter, wie viel Annika Domainko von sich und ihrem Thema erwartet. Sie malt wortreiche Fußnoten in die Erzählung: Es gibt eine Journalistin, die „über den Psychiatriealltag“ schreiben will, überall herumschnüffelt und ihren Foucault gelesen hat. Der Erzähler hat Archäologie studiert wie die Autorin, die heute Sachbuch-Lektorin des Hanser Verlags ist. Er hört einen Podcast, in dem antike griechische Tempel vorkommen: „Das Temenos, dachte ich, bevor sie das Wort aussprachen“, doziert der Mann an sich selber hin: „Ein abgegrenzter, aus der Umwelt herausgeschnittener Bereich, eine sakrale Insel im Profanen…“ Dermaßen umzingelt, verliert das Motiv der Heterotopie sein Charisma vollkommen.
Unbeschwert von Kunstwillen liest sich ein drittes Buch: Es handelt zwar von einer anderen Art Klinik, aber auch die steht für eine Form von Freiheit, eine Souveränität gegenüber dem sozialen Urteil. Henriette Valets „Madame 60a“ ist eine Wiederentdeckung von Anfang des 20. Jahrhunderts. Auf den ersten Seiten saugt eine Frau noch einmal die Lichter, Brücken, Passanten von Paris in sich auf, bevor sie sich der Parallelwelt eines Geburtshauses ausliefert. Dort können arme Frauen einigermaßen versorgt ihre Kinder bekommen: „Ich suche, so langsam wie möglich, Zuflucht im Hôtel-Dieu.“
Von Valet, die im Jahr 1900 in Paris geboren wurde, sind wenige literarische Zeugnisse überliefert. Man weiß, dass sie einige Jahrzehnte mit dem Soziologen und Materialisten Henri Lefebvre verheiratet war, der den Namen seiner Frau allerdings in keinem seiner autobiografischen Texte nannte. Schon in den Vierzigern verstummte Valet, lebte aber noch ein halbes Jahrhundert. „Madame 60a“ ist ein vergessenes Erfolgsbuch.
Die Übersetzerin und Autorin des Nachwortes Henriette Valet vermutet, dass es erlebtes Leben beschreibt, erkennt „Spuren einer literarischen Reportage“. Die schwangere Erzählerin ekelt sich zuerst vor den Körpern, Gerüchen und vulgären Reden der dicht an dicht auf dem Dachboden des Hôtel-Dieu lagernden Frauen. Aber dann nimmt sie sie wahr, erzählt ihre Geschichten, versucht ihren Widerstand gegen ihre erbärmlichen Verhältnisse zu wecken und geht ganz auf in der „Welt von Frauen, in der alle ihre Gemeinsamkeiten zu Tage treten, wo zum Vorschein kommt, was woanders verborgen bleibt – eine Welt ohne Schamhaftigkeit, ohne Schleier, naiv, töricht und beklagenswert.“
Dort erfüllt sie sich den in ihrer Zeit ungehörigen Wunsch „für mich allein“ ihr Kind zu bekommen, „trotz der Gesetze und der Leute“. In die vielstimmigen Schreie des Kreissaals hinein wird das Baby schließlich geboren. Eine solche Ich-Erzählung einer Gebärenden gibt es sicher nicht oft in der Geschichte der Literatur. In allem Schmerz und der Härte des Sozialrealismus dieses Buches wird aus dem Dachboden, auf den man die gefallenen Mädchen, Prostituierten, Hoffnungslosen verbannt ein utopischer Ort. Und wäre das nicht das Buch einer sehr sachlichen Frau, könnte darin stehen: Man kann dort den Kern einer offeneren Gesellschaftsordnung erahnen.
Eine „Welt von Frauen,
in der alle
ihre Gemeinsamkeiten
zu Tage treten,
wo zum
Vorschein kommt,
was woanders
verborgen bleibt“
Yael Inokai:
Ein simpler Eingriff.
Roman. Hanser Berlin, München 2022.
185 Seiten, 20 Euro.
Annika Domainko:
Ungefähre Tage.
Roman. C. H. Beck,
München 2022.
221 Seiten, 23 Euro.
Henriette Valet:
Madame 60a.
Aus dem Französischen
und mit einem Nachwort
von Norma Cassau.
Verlag Das kulturelle
Gedächtnis, Berlin 2022.
232 Seiten, 24 Euro.
Lina Ehrentraut, geboren 1993, ist eine der meistbeachteten Comic-Künstlerinnen ihrer Generation.
Hier posiert sie mit einem selbst entworfenen Overall im Innenhof ihres Wohnhauses im Kolonnadenviertel.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensentin Marie Schmidt stellt drei Romane vor, die sich mit der Klinik als "Ort literarischer Freiheit" beschäftigen. Einer davon ist Annika Domainikos Erzählung eines Psychiatriepflegers, der eine schwerwiegende Beziehung zu einer Patientin eingeht, wie die Rezensentin resümiert. Einen "enormen sprachlichen Aufwand" betreibe die Autorin, um die Grenzen zu beschreiben, die der Pfleger täglich übertritt: die Welt der Psychiatrie und der äußeren; die zu wahrende Distanz zwischen Pfleger und Patientin und auch das heteronormative Machtverhältnis zwischen älterem Mann und jüngerer Frau, bemerkt Schmidt. Allerdings stelle die Autorin zu hohe Erwartungen an sich und ihr Thema und überfrachtet die Erzählung mit Randbemerkungen und immer neuen Motiven, wodurch der Roman sein "Charisma" vollkommen verliere, bedauert die Rezensentin.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Bayerischer Kunstförderpreis 2022
"Dem kunstvoll und mitunter gelehrt erzählten Roman gelingt es, durch seine sensible Sprache eine komplexe Täterperspektive sichtbar zu machen. Bemerkenswert ist insbesondere die behutsame Darstellungsweise der Erzählung, die vieles absichtsvoll im Ungefähren lässt."
Aus der Jurybegründung
"So reflektierter wie formbewusster Roman."
Süddeutsche Zeitung, Antje Weber
"Beeindruckend reflektiert widmet sich Annika Domainko ... dem Thema Psychiatrie."
Süddeutsche Zeitung, Antje Weber
"Von der Klinik als schützendem Raum für eine nach den Maßstäben 'draußen' ungehörige Liebe, erzählt Annika Domainko in Ungefähre Tage: Ein Psychiatriepfleger entwickelt eine fatale Bindung zu einer Patientin. Domainko treibt einen enormen sprachlichen Aufwand, um die Grenze aufzubauen, die dieser Mann täglich überschreitet, zwischen der gewöhnlichen Welt und dem Klinikleben."
Süddeutsche Zeitung, Marie Schmidt
"In 'Ungefähre Tage' erzählt Annika Domainko von unbewältigter Vergangenheit, verbotenen Begierden und den Folgen von einer Grenzüberschreitung an einem Ort, wo sie in dieser Form nicht stattfinden dürfte: in der Psychiatrie."
Welt am Sonntag, Barbara Weitzel
"Eine Psychiatrie am Rande der Stadt als Transit-Ort zwischen innerer und äußerer Welt, aber mit so porösen Grenzen, dass ein Pfleger sie übertritt ... gefangen in den Varianten seiner eigenen seelischen Showdowns. ... eine Zerfallsstudie"
FAS, Tobias Rüther
"Dieses 'Ungefähre' in der Schwebe zu halten, zwischen außerordentlich präzisen Alltagsbeschreibungen, Drogenträumen, Fantasien und unwirklich-verwehenden Gesprächen macht diesen Roman eindringlich und stark, vor allem dort, wo sich die Figuren ineinander auflösen, wo sich Risse zwischen Realität und Wahn auftun."
Der Tagesspiegel, Ulrike Baureithel
"Annika Domainko hat mit ihrem Debüt ein Paradebeispiel für unzuverlässiges Erzählen vorgelegt. Am Ende ihres sorgfältig konzipierten Romans muss der Leser selbst entscheiden, was von der Sache zu halten ist."
WDR, Mareike Ilsemann
"ein eindrückliches Leseerlebnis, das durch die Täterperspektive ein interessantes Licht auf den Missbrauch in der Psychiatrie wirft und auch noch im Anschluss viel Stoff zum Nachdenken bietet.
Radio mephisto
"Wir wollen verstehen, wir wollen wissen, und wenn die Frage: 'Wie wird jemand zum Täter?' auch nicht so einfach beantwortet werden kann, so sollte man sie doch stellen."
Die Presse, Bettina Steiner
"eine intensive, bereichernde Erfahrung"
Missy Magazine, Julia Köhler
"Eindrückliches Debüt über einen Psychiatriemitarbeiter, dem das Leben entgleitet."
Buchkultur, Johannes Lau
"Ungewissheit und Mehrdeutigkeit ... machen den soghaften Reiz des Buches aus. Geschickt zwischen präziser Klarheit und verschwommener Unbestimmtheit lavierend, geht dieser Debütroman weit über die Geschichte eines Missbrauchs und über das Fachgebiet der Psychiatrie hinaus."
literaturkritik.de, Rainer Rönsch
"Dem kunstvoll und mitunter gelehrt erzählten Roman gelingt es, durch seine sensible Sprache eine komplexe Täterperspektive sichtbar zu machen. Bemerkenswert ist insbesondere die behutsame Darstellungsweise der Erzählung, die vieles absichtsvoll im Ungefähren lässt."
Aus der Jurybegründung
"So reflektierter wie formbewusster Roman."
Süddeutsche Zeitung, Antje Weber
"Beeindruckend reflektiert widmet sich Annika Domainko ... dem Thema Psychiatrie."
Süddeutsche Zeitung, Antje Weber
"Von der Klinik als schützendem Raum für eine nach den Maßstäben 'draußen' ungehörige Liebe, erzählt Annika Domainko in Ungefähre Tage: Ein Psychiatriepfleger entwickelt eine fatale Bindung zu einer Patientin. Domainko treibt einen enormen sprachlichen Aufwand, um die Grenze aufzubauen, die dieser Mann täglich überschreitet, zwischen der gewöhnlichen Welt und dem Klinikleben."
Süddeutsche Zeitung, Marie Schmidt
"In 'Ungefähre Tage' erzählt Annika Domainko von unbewältigter Vergangenheit, verbotenen Begierden und den Folgen von einer Grenzüberschreitung an einem Ort, wo sie in dieser Form nicht stattfinden dürfte: in der Psychiatrie."
Welt am Sonntag, Barbara Weitzel
"Eine Psychiatrie am Rande der Stadt als Transit-Ort zwischen innerer und äußerer Welt, aber mit so porösen Grenzen, dass ein Pfleger sie übertritt ... gefangen in den Varianten seiner eigenen seelischen Showdowns. ... eine Zerfallsstudie"
FAS, Tobias Rüther
"Dieses 'Ungefähre' in der Schwebe zu halten, zwischen außerordentlich präzisen Alltagsbeschreibungen, Drogenträumen, Fantasien und unwirklich-verwehenden Gesprächen macht diesen Roman eindringlich und stark, vor allem dort, wo sich die Figuren ineinander auflösen, wo sich Risse zwischen Realität und Wahn auftun."
Der Tagesspiegel, Ulrike Baureithel
"Annika Domainko hat mit ihrem Debüt ein Paradebeispiel für unzuverlässiges Erzählen vorgelegt. Am Ende ihres sorgfältig konzipierten Romans muss der Leser selbst entscheiden, was von der Sache zu halten ist."
WDR, Mareike Ilsemann
"ein eindrückliches Leseerlebnis, das durch die Täterperspektive ein interessantes Licht auf den Missbrauch in der Psychiatrie wirft und auch noch im Anschluss viel Stoff zum Nachdenken bietet.
Radio mephisto
"Wir wollen verstehen, wir wollen wissen, und wenn die Frage: 'Wie wird jemand zum Täter?' auch nicht so einfach beantwortet werden kann, so sollte man sie doch stellen."
Die Presse, Bettina Steiner
"eine intensive, bereichernde Erfahrung"
Missy Magazine, Julia Köhler
"Eindrückliches Debüt über einen Psychiatriemitarbeiter, dem das Leben entgleitet."
Buchkultur, Johannes Lau
"Ungewissheit und Mehrdeutigkeit ... machen den soghaften Reiz des Buches aus. Geschickt zwischen präziser Klarheit und verschwommener Unbestimmtheit lavierend, geht dieser Debütroman weit über die Geschichte eines Missbrauchs und über das Fachgebiet der Psychiatrie hinaus."
literaturkritik.de, Rainer Rönsch
Das bin
also ich
Liebe im Ausnahmezustand: Drei Romane machen
die Klinik zum Ort literarischer Freiheit
VON MARIE SCHMIDT
Ein Hauch von Ewigkeit liegt über diesen Geschichten. In der ersten gibt es ein Schwesternwohnheim am Stadtrand und ein Krankenhaus, in dem eine Frau morgendlich den Dienst antritt. Die anderen Schwestern raten, „komm hierher, erledige deine Aufgaben, und dein Kopf wird dir treu bleiben. Du wirst mit jeder Wiederholung besser werden, bis die Arbeit in dir drin ist.“ Die Routine wirkt: „Ich konnte mir keine andere Welt für mich denken“, sagt die Erzählerin.
Ihre Arbeit besteht darin, „neuartige Eingriffe“ zu unterstützen, bei denen Patientinnen ihre psychischen Störungen chirurgisch aus dem Gehirn entfernt werden sollen. Es gab diese Methoden der Lobotomie zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Psychiatrie. Aber so wie Yael Inokai in dem Roman „Ein simpler Eingriff“ davon erzählt, auch von altmodischen Schwesternuniformen, selbstsicheren Patriarchen, Ärzten und Vätern der Patientinnen, entsteht der ambivalente Eindruck einer futuristischen Vergangenheit. Da ist ein Zug von „Handmaid’s Tale“, der im Unklaren lässt, ob hier von einer historischen oder dystopischen Zeit die Rede ist.
Das ist die subtile Kunst der Abstraktion, Zeit und Raum so aus der Erzählung zu filtern, dass der Roman selbst nachahmt, wovon er handelt, „die vollkommen anderen Räume“, wie Michel Foucault die Bereiche genannt hat, die zu ordentlich organisierten Gesellschaften dazugehören, aber eben als Ressorts dessen, was sich in ihre Normalität nicht einordnen lässt. In Psychiatrien, Heimen, Gefängnissen und Ferienkolonien herrsche eine entrückte Zeitform, diese Orte seien gut abgegrenzt, aber in ihrem Inneren gälten gewöhnliche Unterschiede nichts mehr, war seine Beschreibung, die enorm prägend wurde für eine bestimmte Form der Gesellschaftsbeobachtung. Und seitdem leider auch zur idée reçue, zum Kritikschlager, paranoid gesteigert in der These vom Ausnahmezustand, der selbst zur Normalität geworden sei, mit der der italienische Philosoph Giorgio Agamben in den Nullerjahren die Geisteswissenschaften verstörte.
Literarisch haben solche Schauplätze oft eine andere Funktion: Es sind Umgebungen, in denen Ambivalenzen erhalten bleiben können, in denen soziale Regeln in ihrer ganzen Härte und zugleich von außen sichtbar sind, in denen das moralische Urteilen einen schwebenden Moment lang aussetzt. Daraus kann ein geradezu romantisches Umfeld werden.
Wie eben im dritten Roman der 1989 in Basel geborenen Yael Inokai. In der entrückten, geisterhaften Szenerie dieses Buches schafft sie sich die erzählerische Freiheit für eine feine, naive Sensibilität. Die Hauptfigur Meret arbeitet als Krankenschwester und ihre Methode ist das Mitgefühl. Sie sieht den Patientinnen in die Augen, die während der Gehirnoperation wach bleiben sollen, damit der Chirurg die „richtige“ Stelle trifft: „Ich achtete auf jedes Wort und jeden Blick. Ich nahm den Menschen ihre Angst“. Die Grenze zwischen Ich und Du löst sich in klinischer Empathie auf.
In der Abgeschiedenheit der Klinik verliebt sich diese extrem durchlässige Frau in eine andere Krankenschwester, mit der sie das Zimmer im Wohnheim teilt. Die Erzählstimme stört die Heimlichkeit durch kein Urteil, keinen Konventionalitäts-Trigger: die Liebesgeschichte ist reines Gefühl, vibrierende Wahrnehmung der Körper und nach einer sterbensschönen Sexszene ein Moment der Scham, Fremdheit und Erkenntnis: „Das war also ich. So sah ich aus.“ Dem Ausnahmeort sei Dank eine Liebe, die ganz aus dem Genderspektrum fällt, könnte man meinen, eine zwischen Menschenkindern. Bis eben doch eine Frage durch die Handlungsebenen schneidet: „Würden sie das nicht über uns beide sagen? Dass das eine psychische Störung ist?“
Damit verliert die verkapselte Welt ihre Sicherheit und die Frage ist, ob die Frauen die abgeschottete Welt der Klinik auch verlassen können, ob sie entkommen. Auf ihrer Instagram-Seite empfiehlt Yael Inokai häufig Bücher: welche, die mit der Zeitschrift „Politisch Schreiben“ zu tun haben, zu deren Redaktion sie gehört, und immer wieder auch welche über lesbische Frauen. In diesen Kanon fügt sich ihr Roman in seiner Zeitlosigkeit als besonders kostbares Beispiel. Man könnte ihn aber eben auch zu den Psychiatrieromanen zählen, die so verstreut erscheinen, dass nie ein fixes Genre daraus wird. Aber es gehen die charismatischsten Bücher daraus hervor, zuletzt Clemens J. Setz’ monumentaler Roman „Die Stunde zwischen Frau und Gitarre“ von 2015.
Von der Klinik als schützendem Raum für eine nach den Maßstäben „draußen“ ungehörige Liebe, erzählt auch Annika Domainko in „Ungefähre Tage“: Ein Psychiatriepfleger entwickelt eine fatale Bindung zu einer Patientin. Domainko treibt einen enormen sprachlichen Aufwand, um die Grenze aufzubauen, die dieser Mann täglich überschreitet, zwischen der gewöhnlichen Welt und dem Klinikleben, Desinfektionsmittelgeruch, Diagnoseschlüssel ICD-10, aus der Fasson geratene Körper. Die sogenannte Normalität bleibt daneben betont trivial: Es gibt eine Partnerin des Erzählers, ihr gemeinsames Kind, bourgeoise Schwiegereltern, die auf den Pfleger herabschauen.
In seiner Patientin erkennt er schließlich etwas von sich selbst wieder, das er in seinem Familienalltag zu verbergen versucht hatte. Eine Drogenvergangenheit wird angedeutet und die auch seelisch befestigten Grenzen zwischen der Welt der Psychiatrie und der draußen werden weich. An der Liebesgeschichte prägen sich ein paar der bekannten Probleme der Heterosexualität aus, Machtspielchen zwischen einem älteren Mann und einer jüngeren Frau. Von außen, von Dritten beobachtet klar zu erkennen als Missbrauch einer Schutzbefohlenen.
Der Roman leidet etwas darunter, wie viel Annika Domainko von sich und ihrem Thema erwartet. Sie malt wortreiche Fußnoten in die Erzählung: Es gibt eine Journalistin, die „über den Psychiatriealltag“ schreiben will, überall herumschnüffelt und ihren Foucault gelesen hat. Der Erzähler hat Archäologie studiert wie die Autorin, die heute Sachbuch-Lektorin des Hanser Verlags ist. Er hört einen Podcast, in dem antike griechische Tempel vorkommen: „Das Temenos, dachte ich, bevor sie das Wort aussprachen“, doziert der Mann an sich selber hin: „Ein abgegrenzter, aus der Umwelt herausgeschnittener Bereich, eine sakrale Insel im Profanen…“ Dermaßen umzingelt, verliert das Motiv der Heterotopie sein Charisma vollkommen.
Unbeschwert von Kunstwillen liest sich ein drittes Buch: Es handelt zwar von einer anderen Art Klinik, aber auch die steht für eine Form von Freiheit, eine Souveränität gegenüber dem sozialen Urteil. Henriette Valets „Madame 60a“ ist eine Wiederentdeckung von Anfang des 20. Jahrhunderts. Auf den ersten Seiten saugt eine Frau noch einmal die Lichter, Brücken, Passanten von Paris in sich auf, bevor sie sich der Parallelwelt eines Geburtshauses ausliefert. Dort können arme Frauen einigermaßen versorgt ihre Kinder bekommen: „Ich suche, so langsam wie möglich, Zuflucht im Hôtel-Dieu.“
Von Valet, die im Jahr 1900 in Paris geboren wurde, sind wenige literarische Zeugnisse überliefert. Man weiß, dass sie einige Jahrzehnte mit dem Soziologen und Materialisten Henri Lefebvre verheiratet war, der den Namen seiner Frau allerdings in keinem seiner autobiografischen Texte nannte. Schon in den Vierzigern verstummte Valet, lebte aber noch ein halbes Jahrhundert. „Madame 60a“ ist ein vergessenes Erfolgsbuch.
Die Übersetzerin und Autorin des Nachwortes Henriette Valet vermutet, dass es erlebtes Leben beschreibt, erkennt „Spuren einer literarischen Reportage“. Die schwangere Erzählerin ekelt sich zuerst vor den Körpern, Gerüchen und vulgären Reden der dicht an dicht auf dem Dachboden des Hôtel-Dieu lagernden Frauen. Aber dann nimmt sie sie wahr, erzählt ihre Geschichten, versucht ihren Widerstand gegen ihre erbärmlichen Verhältnisse zu wecken und geht ganz auf in der „Welt von Frauen, in der alle ihre Gemeinsamkeiten zu Tage treten, wo zum Vorschein kommt, was woanders verborgen bleibt – eine Welt ohne Schamhaftigkeit, ohne Schleier, naiv, töricht und beklagenswert.“
Dort erfüllt sie sich den in ihrer Zeit ungehörigen Wunsch „für mich allein“ ihr Kind zu bekommen, „trotz der Gesetze und der Leute“. In die vielstimmigen Schreie des Kreissaals hinein wird das Baby schließlich geboren. Eine solche Ich-Erzählung einer Gebärenden gibt es sicher nicht oft in der Geschichte der Literatur. In allem Schmerz und der Härte des Sozialrealismus dieses Buches wird aus dem Dachboden, auf den man die gefallenen Mädchen, Prostituierten, Hoffnungslosen verbannt ein utopischer Ort. Und wäre das nicht das Buch einer sehr sachlichen Frau, könnte darin stehen: Man kann dort den Kern einer offeneren Gesellschaftsordnung erahnen.
Eine „Welt von Frauen,
in der alle
ihre Gemeinsamkeiten
zu Tage treten,
wo zum
Vorschein kommt,
was woanders
verborgen bleibt“
Yael Inokai:
Ein simpler Eingriff.
Roman. Hanser Berlin, München 2022.
185 Seiten, 20 Euro.
Annika Domainko:
Ungefähre Tage.
Roman. C. H. Beck,
München 2022.
221 Seiten, 23 Euro.
Henriette Valet:
Madame 60a.
Aus dem Französischen
und mit einem Nachwort
von Norma Cassau.
Verlag Das kulturelle
Gedächtnis, Berlin 2022.
232 Seiten, 24 Euro.
Lina Ehrentraut, geboren 1993, ist eine der meistbeachteten Comic-Künstlerinnen ihrer Generation.
Hier posiert sie mit einem selbst entworfenen Overall im Innenhof ihres Wohnhauses im Kolonnadenviertel.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
also ich
Liebe im Ausnahmezustand: Drei Romane machen
die Klinik zum Ort literarischer Freiheit
VON MARIE SCHMIDT
Ein Hauch von Ewigkeit liegt über diesen Geschichten. In der ersten gibt es ein Schwesternwohnheim am Stadtrand und ein Krankenhaus, in dem eine Frau morgendlich den Dienst antritt. Die anderen Schwestern raten, „komm hierher, erledige deine Aufgaben, und dein Kopf wird dir treu bleiben. Du wirst mit jeder Wiederholung besser werden, bis die Arbeit in dir drin ist.“ Die Routine wirkt: „Ich konnte mir keine andere Welt für mich denken“, sagt die Erzählerin.
Ihre Arbeit besteht darin, „neuartige Eingriffe“ zu unterstützen, bei denen Patientinnen ihre psychischen Störungen chirurgisch aus dem Gehirn entfernt werden sollen. Es gab diese Methoden der Lobotomie zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Psychiatrie. Aber so wie Yael Inokai in dem Roman „Ein simpler Eingriff“ davon erzählt, auch von altmodischen Schwesternuniformen, selbstsicheren Patriarchen, Ärzten und Vätern der Patientinnen, entsteht der ambivalente Eindruck einer futuristischen Vergangenheit. Da ist ein Zug von „Handmaid’s Tale“, der im Unklaren lässt, ob hier von einer historischen oder dystopischen Zeit die Rede ist.
Das ist die subtile Kunst der Abstraktion, Zeit und Raum so aus der Erzählung zu filtern, dass der Roman selbst nachahmt, wovon er handelt, „die vollkommen anderen Räume“, wie Michel Foucault die Bereiche genannt hat, die zu ordentlich organisierten Gesellschaften dazugehören, aber eben als Ressorts dessen, was sich in ihre Normalität nicht einordnen lässt. In Psychiatrien, Heimen, Gefängnissen und Ferienkolonien herrsche eine entrückte Zeitform, diese Orte seien gut abgegrenzt, aber in ihrem Inneren gälten gewöhnliche Unterschiede nichts mehr, war seine Beschreibung, die enorm prägend wurde für eine bestimmte Form der Gesellschaftsbeobachtung. Und seitdem leider auch zur idée reçue, zum Kritikschlager, paranoid gesteigert in der These vom Ausnahmezustand, der selbst zur Normalität geworden sei, mit der der italienische Philosoph Giorgio Agamben in den Nullerjahren die Geisteswissenschaften verstörte.
Literarisch haben solche Schauplätze oft eine andere Funktion: Es sind Umgebungen, in denen Ambivalenzen erhalten bleiben können, in denen soziale Regeln in ihrer ganzen Härte und zugleich von außen sichtbar sind, in denen das moralische Urteilen einen schwebenden Moment lang aussetzt. Daraus kann ein geradezu romantisches Umfeld werden.
Wie eben im dritten Roman der 1989 in Basel geborenen Yael Inokai. In der entrückten, geisterhaften Szenerie dieses Buches schafft sie sich die erzählerische Freiheit für eine feine, naive Sensibilität. Die Hauptfigur Meret arbeitet als Krankenschwester und ihre Methode ist das Mitgefühl. Sie sieht den Patientinnen in die Augen, die während der Gehirnoperation wach bleiben sollen, damit der Chirurg die „richtige“ Stelle trifft: „Ich achtete auf jedes Wort und jeden Blick. Ich nahm den Menschen ihre Angst“. Die Grenze zwischen Ich und Du löst sich in klinischer Empathie auf.
In der Abgeschiedenheit der Klinik verliebt sich diese extrem durchlässige Frau in eine andere Krankenschwester, mit der sie das Zimmer im Wohnheim teilt. Die Erzählstimme stört die Heimlichkeit durch kein Urteil, keinen Konventionalitäts-Trigger: die Liebesgeschichte ist reines Gefühl, vibrierende Wahrnehmung der Körper und nach einer sterbensschönen Sexszene ein Moment der Scham, Fremdheit und Erkenntnis: „Das war also ich. So sah ich aus.“ Dem Ausnahmeort sei Dank eine Liebe, die ganz aus dem Genderspektrum fällt, könnte man meinen, eine zwischen Menschenkindern. Bis eben doch eine Frage durch die Handlungsebenen schneidet: „Würden sie das nicht über uns beide sagen? Dass das eine psychische Störung ist?“
Damit verliert die verkapselte Welt ihre Sicherheit und die Frage ist, ob die Frauen die abgeschottete Welt der Klinik auch verlassen können, ob sie entkommen. Auf ihrer Instagram-Seite empfiehlt Yael Inokai häufig Bücher: welche, die mit der Zeitschrift „Politisch Schreiben“ zu tun haben, zu deren Redaktion sie gehört, und immer wieder auch welche über lesbische Frauen. In diesen Kanon fügt sich ihr Roman in seiner Zeitlosigkeit als besonders kostbares Beispiel. Man könnte ihn aber eben auch zu den Psychiatrieromanen zählen, die so verstreut erscheinen, dass nie ein fixes Genre daraus wird. Aber es gehen die charismatischsten Bücher daraus hervor, zuletzt Clemens J. Setz’ monumentaler Roman „Die Stunde zwischen Frau und Gitarre“ von 2015.
Von der Klinik als schützendem Raum für eine nach den Maßstäben „draußen“ ungehörige Liebe, erzählt auch Annika Domainko in „Ungefähre Tage“: Ein Psychiatriepfleger entwickelt eine fatale Bindung zu einer Patientin. Domainko treibt einen enormen sprachlichen Aufwand, um die Grenze aufzubauen, die dieser Mann täglich überschreitet, zwischen der gewöhnlichen Welt und dem Klinikleben, Desinfektionsmittelgeruch, Diagnoseschlüssel ICD-10, aus der Fasson geratene Körper. Die sogenannte Normalität bleibt daneben betont trivial: Es gibt eine Partnerin des Erzählers, ihr gemeinsames Kind, bourgeoise Schwiegereltern, die auf den Pfleger herabschauen.
In seiner Patientin erkennt er schließlich etwas von sich selbst wieder, das er in seinem Familienalltag zu verbergen versucht hatte. Eine Drogenvergangenheit wird angedeutet und die auch seelisch befestigten Grenzen zwischen der Welt der Psychiatrie und der draußen werden weich. An der Liebesgeschichte prägen sich ein paar der bekannten Probleme der Heterosexualität aus, Machtspielchen zwischen einem älteren Mann und einer jüngeren Frau. Von außen, von Dritten beobachtet klar zu erkennen als Missbrauch einer Schutzbefohlenen.
Der Roman leidet etwas darunter, wie viel Annika Domainko von sich und ihrem Thema erwartet. Sie malt wortreiche Fußnoten in die Erzählung: Es gibt eine Journalistin, die „über den Psychiatriealltag“ schreiben will, überall herumschnüffelt und ihren Foucault gelesen hat. Der Erzähler hat Archäologie studiert wie die Autorin, die heute Sachbuch-Lektorin des Hanser Verlags ist. Er hört einen Podcast, in dem antike griechische Tempel vorkommen: „Das Temenos, dachte ich, bevor sie das Wort aussprachen“, doziert der Mann an sich selber hin: „Ein abgegrenzter, aus der Umwelt herausgeschnittener Bereich, eine sakrale Insel im Profanen…“ Dermaßen umzingelt, verliert das Motiv der Heterotopie sein Charisma vollkommen.
Unbeschwert von Kunstwillen liest sich ein drittes Buch: Es handelt zwar von einer anderen Art Klinik, aber auch die steht für eine Form von Freiheit, eine Souveränität gegenüber dem sozialen Urteil. Henriette Valets „Madame 60a“ ist eine Wiederentdeckung von Anfang des 20. Jahrhunderts. Auf den ersten Seiten saugt eine Frau noch einmal die Lichter, Brücken, Passanten von Paris in sich auf, bevor sie sich der Parallelwelt eines Geburtshauses ausliefert. Dort können arme Frauen einigermaßen versorgt ihre Kinder bekommen: „Ich suche, so langsam wie möglich, Zuflucht im Hôtel-Dieu.“
Von Valet, die im Jahr 1900 in Paris geboren wurde, sind wenige literarische Zeugnisse überliefert. Man weiß, dass sie einige Jahrzehnte mit dem Soziologen und Materialisten Henri Lefebvre verheiratet war, der den Namen seiner Frau allerdings in keinem seiner autobiografischen Texte nannte. Schon in den Vierzigern verstummte Valet, lebte aber noch ein halbes Jahrhundert. „Madame 60a“ ist ein vergessenes Erfolgsbuch.
Die Übersetzerin und Autorin des Nachwortes Henriette Valet vermutet, dass es erlebtes Leben beschreibt, erkennt „Spuren einer literarischen Reportage“. Die schwangere Erzählerin ekelt sich zuerst vor den Körpern, Gerüchen und vulgären Reden der dicht an dicht auf dem Dachboden des Hôtel-Dieu lagernden Frauen. Aber dann nimmt sie sie wahr, erzählt ihre Geschichten, versucht ihren Widerstand gegen ihre erbärmlichen Verhältnisse zu wecken und geht ganz auf in der „Welt von Frauen, in der alle ihre Gemeinsamkeiten zu Tage treten, wo zum Vorschein kommt, was woanders verborgen bleibt – eine Welt ohne Schamhaftigkeit, ohne Schleier, naiv, töricht und beklagenswert.“
Dort erfüllt sie sich den in ihrer Zeit ungehörigen Wunsch „für mich allein“ ihr Kind zu bekommen, „trotz der Gesetze und der Leute“. In die vielstimmigen Schreie des Kreissaals hinein wird das Baby schließlich geboren. Eine solche Ich-Erzählung einer Gebärenden gibt es sicher nicht oft in der Geschichte der Literatur. In allem Schmerz und der Härte des Sozialrealismus dieses Buches wird aus dem Dachboden, auf den man die gefallenen Mädchen, Prostituierten, Hoffnungslosen verbannt ein utopischer Ort. Und wäre das nicht das Buch einer sehr sachlichen Frau, könnte darin stehen: Man kann dort den Kern einer offeneren Gesellschaftsordnung erahnen.
Eine „Welt von Frauen,
in der alle
ihre Gemeinsamkeiten
zu Tage treten,
wo zum
Vorschein kommt,
was woanders
verborgen bleibt“
Yael Inokai:
Ein simpler Eingriff.
Roman. Hanser Berlin, München 2022.
185 Seiten, 20 Euro.
Annika Domainko:
Ungefähre Tage.
Roman. C. H. Beck,
München 2022.
221 Seiten, 23 Euro.
Henriette Valet:
Madame 60a.
Aus dem Französischen
und mit einem Nachwort
von Norma Cassau.
Verlag Das kulturelle
Gedächtnis, Berlin 2022.
232 Seiten, 24 Euro.
Lina Ehrentraut, geboren 1993, ist eine der meistbeachteten Comic-Künstlerinnen ihrer Generation.
Hier posiert sie mit einem selbst entworfenen Overall im Innenhof ihres Wohnhauses im Kolonnadenviertel.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de