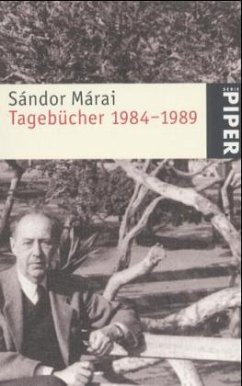Die Tagebücher Sandor Marais von 1984 bis zu seinem Freitod 1989 sind ein überaus bewegendes Zeugnis. Ohne zu beschönigen, beschreibt der Schriftsteller Krankheit und Tod seiner geliebten Frau, mit der er sechzig Jahre seines Lebens verbracht hatte. Er hält den Prozeß des eigenen Alterns fest, berichtet von der zunehmenden Einsamkeit, auch wenn er nach wie vor an den gesellschaftlichen und literarischen Ereignissen seiner Zeit Anteil nimmt.

Das letzte Tagebuch des ungarischen Autors Sándor Márai, der heute 100 Jahre alt geworden wäre
In einem Interview während der Frankfurter Buchmesse 1999 empfahl Imre Kertész nachdrücklich die Lektüre des letzten Tagebuchs von Sándor Márai. Dieses Tagebuch erzählt die letzte Geschichte des Autors: die seines Todes.
Ein alter Mann bringt sich um, er erschießt sich nach dem Tod seiner Frau, mit der er 62 Jahre verheiratet war. Das ist als Dokument erschütternd und als Buch eine kleine Sensation. Márais meisterlicher Kurzroman Die Glut – ein nächtliches Kammerspiel über Dekadenz und moralischen Adel der K.u.K.-Monarchie – war die literarische Wiederentdeckung des Herbstes 1999. Das letzte Tagebuch liest sich wie die Fortschreibung des Romans aus der Perspektive eines Menschen, der alle überlebt hat, seine Freunde, seine Frau, seine Söhne, der seine Heimat verloren und seine literarischen Erfolge hinter sich gelassen hat. Und der in dieser einsamen, schmalen Zone vor dem eigenen biologischen échec alle Grundfragen des Lebens noch einmal mit überwältigender Aufrichtigkeit überdenkt. 1. Januar 1985: „Es ist fast schon eine Überraschung, daß ich, daß wir diesen Neujahrstag erleben. Von meinen schriftstellernden Zeitgenossen lebt sozusagen keiner mehr. Auch die Literatur, deren Zeitgenosse ich war, siecht dahin. Ich bin Vogelscheuche und Kramzeug fürs Museumsregal in einem, ein Insekt im Bernstein. ”
Geboren wurde Sándor Márai am 11. April 1900 in Kaschau (ungarisch Kassa), das seit 1921 slowakisch ist und Košice heißt. Aufgewachsen im geistigen Niemandsland der wurzellosen deutsch-ungarischen Bourgeoisie, orientierte sich der unruhige Freigeist früh an den zeitgenössischen Autoren des fortgeschrittenen Auslands, an Lasker-Schüler, Trakl, Kafka. Er studierte in Leipzig, lebte in Frankfurt, Berlin und, von 1923 an als Korrespondent der renommierten Frankfurter Zeitung, in Paris. Ende der zwanziger Jahre kehrte er nach Ungarn zurück, um seine kulturelle Identität zu überprüfen.
Angewidert von den neuen gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen emigrierte er 1948. Neapel, New York, Salerno, Kanada, schließlich San Diego in Kalifornien waren seine Stationen. Im eigenen Land zur persona non grata erklärt, vom offiziellen Literaturbetrieb über Jahrzehnte ignoriert, verbot er im politischen Tauwetter die Veröffentlichung seiner Werke in Ungarn.
Wie „Insekten im Bernstein”, eingeschlossen in ihrer Wohnung: So leben der alte Mann und seine kranke Frau L. Vom Leben haben sie nichts mehr zu erwarten. Er umsorgt sie hingebungsvoll, zunächst zu Hause, später, als er sie nicht mehr allein pflegen kann, in einer Klinik. „Ich sitze anderthalb Stunden am Bett, halte ihre Hand, wortlos. Unerwartet sagt sie: ,Wie langsam ich sterbe. ’ Während ich diesem ,langsamen Sterben’ zusehe, muß ich daran denken, was ich tue, wenn sie stirbt. Alles ordnen und gehen, aber wie aufrichtig ist das?” Márai protokolliert den Tod seiner Frau. Und das tut er knapp, unsentimental, luzide.
Dazwischen, hungrig nach Sinn, Lektürenotizen: Aristoteles, Sophokles, Tolstoi. „Sterben ist das Größte. Alles danach ist uninteressant. Was dazwischen ist, unverständlich und grauenvoll. ” 4. Januar 1986: „L. ist gestorben. ” Nach der Einäscherung verstreut er ihre sterblichen Überreste im Pazifischen Ozean. 11. März 1986: „Erst wurde sie blind und taub, dann wurde sie in die Matratzengruft gebracht, weil ihr schwindlig wurde und sie nicht gehen konnte, dann warf man sie ins Feuer, dann ins Wasser, dann ins Nichts. Dieses Psalmodieren über ,Gnade‘. Es gibt keine ,Gnade‘. Es gibt nur dunkle, gnadenlose Gleichgültigkeit. ”
Márai beginnt jetzt, seinen eigenen Tod methodisch vorzubereiten. Der Gang zum Waffenhändler, die Unterschrift unter den Waffenschein, Übungen mit dem Revolver auf dem Schießplatz. Der Weg in den Alltag wird allmählich zur riskanten Expedition. Er stürzt auf offener Straße, Passanten helfen ihm auf. Das amerikanische Exil ist völlige Fremde, die eigene Wohnung Lebensfalle für ein beinahe extraterrestrisches Menschsein. Trauerarbeit, nächtliche Séancen mit der verstorbenen, geliebten L. , die Lektüre ihrer hinterlassenen Tagebücher, das Leben verlagert sich auf die Seite des Todes.
Sich aufrichten und den Tod wählen, sterben, um die Würde der Existenz vor den Beschämungen des Alters und der Ohnmacht des Verfalls zu retten. Selbst nach der Gnade zu greifen, die kein Gott zugesteht. Das ist die zentrale Botschaft aus der „Matratzengruft” und zugleich die letzte Option des Dichters im Exil, der zeitlebens um seine geistige Souveränität kämpfte: „Es gibt keine institutionelle Freiheit. Jeden Tag ist jeder allein frei, frei sein kann er nur – so oder so – aus eigener Kraft. ”
Der Schritt ins Jenseits
Viele Tagebücher großer Autoren wurden im Laufe der Zeit als Keimzelle, als geistiges Labor für das eigentliche Werk entdeckt. Mit dem letzten Tagebuch Márais verhält es sich anders. Es ist die Einlösung eines ethischen Programms, dessen Entwurf der Autor in seinem Roman Die Glut dem alten General angedichtet hat: „Am Ende, am Ende von allem, beantwortet man mit den Tatsachen seines Lebens die Fragen, die einem die Welt so hartnäckig gestellt hat. Solche Fragen lauten: Wer bist du?. . . Was wolltest du wirklich?. . . Was konntest du wirklich?. . . Wo warst du treu, wo untreu?. . . Wo warst du tapfer und wo feige?. . . So lauten diese Fragen. Und man antwortet, wie man kann, ehrlich oder verlogen. ”
Mit den Tagebuchnotizen und den Tatsachen seines Todes nimmt Márai seine poetischen Fragen beim Wort. Erst der Schritt über die Schwelle des Todes bedeutet vollkommene Freiheit. Drei Jahre nach dem Tod seiner Frau, am 15. Januar 1989, der letzte Eintrag: „Ich erwarte die Abberufung, ich dränge nicht, aber ich zögere auch nicht. Es ist soweit. ” Sieben Wochen später, am 22. Februar 1989 hat Sándor Márai sich erschossen.
MARIETTA PIEKENBROCK
SÁNDOR MÁRAI: Tagebuch 1985-89. Herausgegeben. von Roswitha Haring. Aus dem Ungarischen von Hans Skirecki. Verlag der Buchhandlung Klaus Bittner, Köln 1999. 48 Seiten, 22 Mark.
Sándor Márai
Foto: Verlag
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de
"Ein großer Autor. Im Angesicht des Todes aber gibt es keine Größe, nur Haltung und Ergebenheit. Man liest die kargen, verstandesklaren Notate mit wachsender Beklemmung, voller Trauer und Respekt." (Ulrich Greiner in der "Zeit")