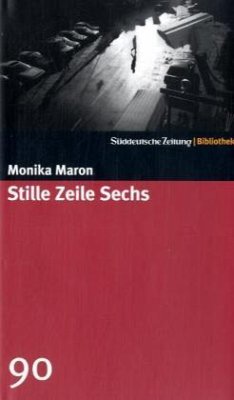Monika Maron: „Stille Zeile Sechs”
Eine Frau, Anfang vierzig, kündigt ihre Stelle. Sie will nicht mehr denken für Geld. Sie will sich mit Opern beschäftigen, vielleicht will sie Klavier spielen lernen, vielleicht auch nicht. Es soll ihr nur keiner mehr sagen, was sie tun soll. Da trifft sie im Café einen Mann, Ende siebzig, Rentner, er will seine Lebenserinnerungen aufschreiben und kann es allein nicht mehr. Er fragt, ob sie ihm helfen wolle, für Geld, aufschreiben, sonst nichts. Da sagt sie zu. Sie glaubt, es sei eine Arbeit, die nur die Hand erfordert, nicht ihren Kopf.
Es ist eine offene Anordnung, in der Monika Maron ihre beiden Figuren aufstellt. Es ist nur kein offenes Land. „Stille Zeile Sechs” ist eine Adresse. Sie liegt in der DDR, wo Monika Maron den Roman begonnen hat, bevor sie in den Westen ging. Sie liegt in Pankow, wo die Mitglieder der Regierung lebten, von denen Monika Marons Stiefvater eines war. Es ist die Adresse, zu der sie Rosalind Polkowski schickt, damit sie das Leben von Herbert Beerenbaum aufschreibt. Beerenbaum ist einer der Männer, die sich mit der DDR das bessere Deutschland aufbauen wollten. Arbeiterkind aus dem Ruhrgebiet, Kommunist geworden, vor dem Krieg nach Moskau emigriert, heimgekehrt, angepackt, Funktionär geworden, der Sache gedient. Was immer er erlebt hat, er erzählt es, als habe alles einer späteren Bestimmung gedient. Er erzählt sein Leben nicht, er begründet es, und die Wirklichkeit soll ihm Recht geben, die Wirklichkeit dieses Staats.
Rosalind Polkowski schreibt, aber ihr Versuch, nur das zu tun, misslingt. Sie kann nicht schreiben, ohne zu denken.
Rosalind Polkowski ist eines der Kinder, für die dieser Staat gebaut sein sollte. Aber sie fühlt sich nicht wohl darin, deshalb will sie nicht mehr denken für Geld. Sie zieht sich zurück aus der Wirklichkeit, die jene alten Männer gezimmert haben, die sie bewachen und jede Kritik daran als Feindschaft verstehen. Sie will der Auseinandersetzung aus dem Weg gehen, weil ihr jene Männer so stark scheinen, dass sie glaubte, erst, wenn sie tot seien, würde sie herausfinden, was sie im Leben gern getan hätte. Und nun sitzt sie einem davon gegenüber.
„Muss der Handelnde schuldig werden, immer und immer wieder? Oder, wenn er nicht schuldig werden will, untergehen?” Das ist die Frage, die Rosalind Polkowski sich stellt, während sie schreibt. Es ist die Frage nach der Alternative. Hätte Beerenbaums Leben anders verlaufen können und damit auch ihres? Wäre Nichthandeln die Alternative gewesen? Ist sie es jetzt? Macht sich der, mit dessen Hilfe Falsches in die Welt kommt, nicht ebenso schuldig, auch wenn es nicht das eigene Falsche ist? Kann sie Beerenbaums Leben also einfach aufschreiben?
Am Ende wird Rosalind Polkowski gegen diesen Herbert Beerenbaum kämpfen, obwohl sie weiß, dass sie nicht gewinnen kann, bis er gestorben ist, und vielleicht nicht einmal dann, kämpft sie doch.MARCUS JAUER
Monika Maron Foto: Teutopress/SZ Photo
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH