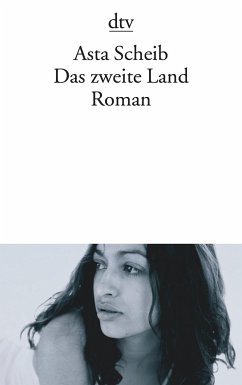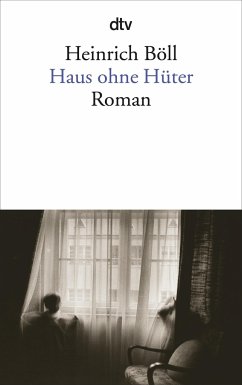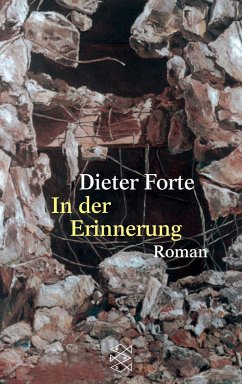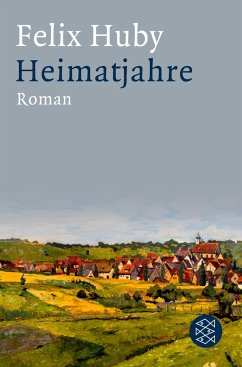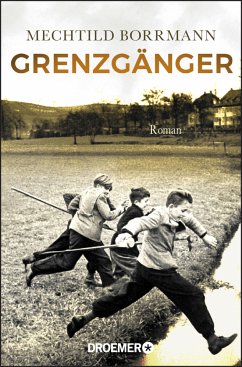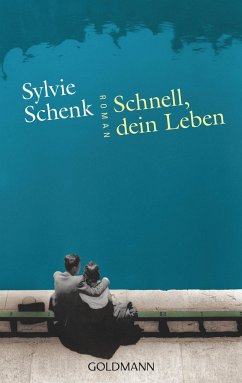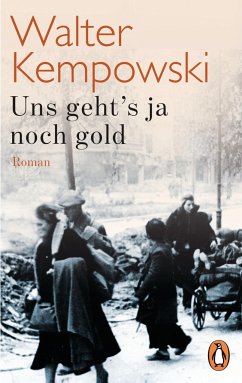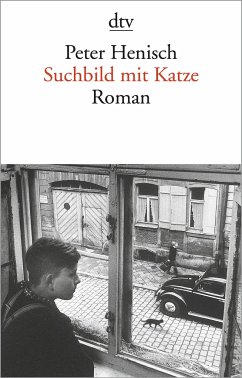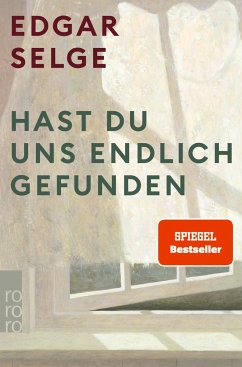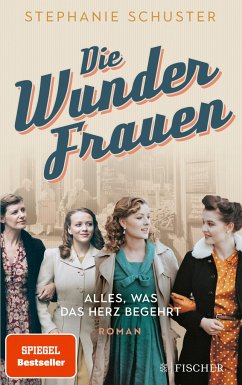finden?
Und ob. Denn Asta Scheib langweilt uns nicht mit der Wiederholung abgegriffener Botschaften. Vielmehr verknüpft sie auf gleichermaßen ernste wie heitere Weise ein Bündel Menschenleben mit den historischen Konditionen und erreicht, daß ihre Geschichte sowohl belehrt wie amüsiert. Dies dadurch, daß sie die Berichterstattung einer kindlichen Zeitzeugin anvertraut; genauer gesagt: einer Frau mit äußerst gutem Gedächtnis, die sich ihrer Kinderzeit exakt erinnert und bei der Wiedergabe alter Erlebnisse auf kluge Erwachsenendistanz verzichtet. Solch ein Kunstgriff ist nicht ungefährlich, denn wenn alles Geschehen durch ein unreifes Hirn gefiltert wird, kann eine fatale Mischung von Verkehrtem und Banalem dabei herauskommen. Asta Scheib vermeidet diese Falle. Sie läßt ihre kleine Agnes munter schwatzen, dabei jedoch die Erwachsene, die Agnes heute sein müßte, die Auswahl der Themen kontrollieren.
Den Erzählstoff hat die Autorin offenkundig ihrer eigenen Vita entnommen. Ihr Geburtsort ist Bergneustadt im Bergischen Land, für die Herkunft ihrer Agnes erfand sie ein bergisches Städtchen namens Attenberg. Sie entstammt, wie ihre kleine Heldin, dem Jahrgang 1939, teilt also mit Agnes die historischen Daten der Kindheit. Ob Asta und Agnes auch familiäre und private Erlebnisse gemeinsam haben, können wir dem Buch nicht entnehmen. Es ist auch nicht wichtig. Wichtig allein ist, daß das, was die Autorin Agnes erzählen läßt, sich genau so abgespielt haben kann, in wessen Leben auch immer.
Agnes ist also ein Kind erst der Angstjahre, dann der Hungerjahre. Sie macht uns deutlich genug, wie stark solche Nöte auf einen werdenden Menschen einwirken. Dennoch beschäftigt dies nicht vorrangig ihren kleinen Kopf. Mindestens ebenso wichtig ist das Tun und Lassen der Leute um sie herum. Etwa das der Mutter, im Grunde eine liebe Frau, die fürsorgende Glucke ist für ihre drei Küken, zuweilen aber auch hart durch blinde Kirchenfrömmigkeit sein kann. Am meisten verstört die Tochter, daß die Mama den Papa nicht zurückhaben will, der lange in russischer Gefangenschaft darbt und den Agnes innigst herbeisehnt. Statt dessen läßt Mama sich mit Friedrich ein, einem großschnauzigen Mitläufer der Nationalsozialisten, der die alten Sprüche klopft und die Kinder seiner Geliebten kujoniert. Er ist ein schlimmes, doch nicht das einzige Überbleibsel der Vergangenheit. Attenberg ist voll von Leuten, die Hitler zwar nicht zurückwünschen, in ihrem Denken und Handeln ihm aber noch lange nicht entkommen sind. Sowohl in der Not der vierziger wie im langsamen Aufstieg der fünfziger Jahre verdeutlicht manch kleinstädtisches Minidrama, warum die braven Bürger überhaupt einmal den braunen Verbrechern anheimfallen konnten.
Natürlich durchschaut die kleine Agnes das alles nicht. Aber so, wie sie es erzählt, hilft sie uns, alles zu verstehen, und zwar dadurch, daß sie mit den Verkörperungen des Unerhörten alltäglichen Umgang pflegt, sowohl mit Tätern wie mit Opfern. Wichtigster Gegenpol Friedrichs ist die von Agnes bewunderte Ines, gebürtige Portugiesin, Witwe und Erbin eines Attenberger jüdischen Industriellen, sehr schön und sehr reich und voller Verachtung für die Gefolgsleute der einstigen Mörder. Durch solche menschlichen Medien ersteht Geschichte, die uns längst zur Bücherweisheit geronnen war, in eindringlicher Lebendigkeit ganz neu, und dank der Unbefangenheit der Erzählerin können wir das sattsam Bekannte noch immer spannend finden.
Aber Agnes ist beileibe keine Geschichtslehrerin. Oder sie ist es nur so weit, wie im Zusammenhang mit ihren Mitteilungen unvermeidlich. Im Vordergrund steht immer sie selbst, stehen tausend kleine Begebenheiten auf ihrem Weg ins Leben, viele erheiternd, manche rührend, manche auch bedenklich stimmend. Weder dieses Kind noch ein anderes ist von engelsgleicher Reinheit. Die Brut kann ihren Erziehern ganz schön störrisch kommen, oder sie verletzt beispielsweise alle Kirchenregeln, wenn es um die Entdeckung geht, daß man ein geschlechtliches Wesen ist. Agnes lebt, soweit Mutter, Friedrich und die Großeltern es zulassen, ihre Nücken und Tücken aus, versucht, Wünsche durchzusetzen und Niederlagen durch neue Streiche zu kompensieren. Eine Art provinzdeutsche Pippi Langstrumpf, wenn auch ohne Pippis märchenhafte Erfolgsgarantien.
Man kann sich dem Charme des kleinen Fratzes schlecht entziehen. Ihre Backfischzeit dagegen, zugleich die Aufstiegsphase der jungen Bundesrepublik, mutet nicht ganz so attraktiv an. Schwer zu sagen, woran das liegt. Entweder daran, daß die veränderte Agnes anderes im Kopf hat, als wirkungsvoll die Sprech- und Denkblasen der Alten zum Platzen zu bringen. Oder daran, daß die Sicht- und Ausdrucksweise einer Göre sich nicht so gut eignet, auch die Probleme einer fast Erwachsenen überzeugend darzustellen. Ein Glück, daß es die kleine Agnes ist, die die meisten Seiten des Buches beherrscht.
SABINE BRANDT
Asta Scheib: "Sei froh, daß du lebst!" Roman. Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2001. 318 S., geb., 44,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.10.2001
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.10.2001