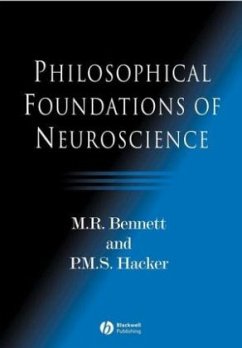In this provocative work, a distinguished philosopher and a leading neuroscientist outline the conceptual problems at the heart of cognitive neuroscience.
Writing from a scientifically and philosophically informed perspective, the authors provide a critical overview of the conceptual difficulties encountered in many current neuroscientific and psychological theories, including those of Blakemore, Crick, Damasio, Edelman, Gazzaniga, Kandel, Kosslyn, LeDoux, Penrose and Weiskrantz. They propose that conceptual confusions about how the brain relates to the mind affect the intelligibility of research carried out by neuroscientists, in terms of the questions they choose to address, the description and interpretation of results and the conclusions they draw.
The book forms both a critique of the practice of cognitive neuroscience and a conceptual handbook for students and researchers.
Writing from a scientifically and philosophically informed perspective, the authors provide a critical overview of the conceptual difficulties encountered in many current neuroscientific and psychological theories, including those of Blakemore, Crick, Damasio, Edelman, Gazzaniga, Kandel, Kosslyn, LeDoux, Penrose and Weiskrantz. They propose that conceptual confusions about how the brain relates to the mind affect the intelligibility of research carried out by neuroscientists, in terms of the questions they choose to address, the description and interpretation of results and the conclusions they draw.
The book forms both a critique of the practice of cognitive neuroscience and a conceptual handbook for students and researchers.

Ist das, was wir Bewusstsein nennen, überhaupt theoriefähig? Ist Bewusstsein - das Haben von Gedanken und Gefühlen - nicht ein derart subjektives Phänomen, dass es sich auf keine Weise objektivieren lässt? John Searle ist ein prominenter Philosoph, der diese Ansicht vertritt. Er fordert nicht weniger als ein neues Verständnis von naturwissenschaftlicher Erklärung. Nur so bestünde eine Chance, erklären zu können, wie die Neuronen unseres Gehirns den subjektiven, qualitativen Charakter unseres bewussten Erlebens hervorbringen. Schließlich bestehe genau darin das Rätsel des Bewusstseins.
Wo Searle sich angesichts des "harten" Problems der Erklärung von Bewusstsein nur noch mit einer "anderen" Wissenschaft zu behelfen weiß, da sieht Daniel Dennett absolut kein abgründiges Problem, das andere als normalwissenschaftliche Methoden erfordern würde. Bewusstsein ist für ihn kein zutiefst rätselhaftes Phänomen, es wird bloß recht schnell zu einem, wenn man ein paar Schritte in die falsche Richtung tut. In diesem Sinne argumentiert Dennett in seinem neuen Buch ("Süße Träume". Die Erforschung des Bewusstseins und der Schlaf der Philosophie. Aus dem Amerikanischen von Gerson Reuter. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007. 216 S., geb., 24,80 [Euro]).
Am Beginn dessen, was Dennett einen Irrweg nennt, stehe die Intuition, dass Bewusstsein etwas Subjektives und Inneres ist, das von außen und für andere höchstens indirekt oder gar nicht zugänglich ist. Nur mir selbst ist demnach bekannt, wie es sich anfühlt. So wie auch nur ich selbst diese meine bewusste Rotempfindung haben kann, die eben nicht einfach in die auch von Dritten feststellbare Reizung meiner Retina und die Verarbeitungsprozeduren dahintergeschalteter Neuronenverbände konvertiert werden kann. Denn - so beispielsweise die Frage Searles - lässt sich ein größerer Unterschied denken als der zwischen Erregungssequenzen von Neuronen und meiner Empfindung von Rot? Wie also diese "Erklärungslücke" überwinden? Und schon sieht man sich vor das Dilemma gestellt, das laut Dennett nur beschworen wird, in Wirklichkeit aber gar keins ist. Dieses Dilemma lautet: Bewusstsein sei entweder gar nicht oder nur mit verzweifelt anmutenden theoretischen Einsätzen zu erklären.
Gegen solche Vorstellungen tritt Dennett mit der gewohnten Verve an. Und weil er weiß, dass tiefsitzende Intuitionen kaum direkt angegangen werden können, tut er es im spielerischen Variieren von Gedankenexperimenten, die diesen Intuitionen eher merkwürdige Folgerungen abgewinnen. Solche therapeutischen Lockerungsübungen sollen den verführerischen Schein der Evidenz zerstreuen, auf die Philosophen wie Searle bauen.
Searle und Dennett vertreten entgegengesetzte Positionen. Trotzdem sind sie vor einiger Zeit beide unter Beschuss gekommen, in einem viel beachteten Buch, das der Philosoph Peter Hacker gemeinsam mit dem Neurowissenschaftler Max Bennett verfasst hat ("Philosophical Foundations of Neuroscience". Blackwell, Oxford 2003. 461 S., br., 36,- [Euro]). Man findet darin eine detailreiche, im Wittgensteinschen Geiste verfahrende Kritik an Explikationsansprüchen der Neurowissenschaften. Deren Ansprüche auf Erklärung unseres gewohnten psychologischen Vokabulars - wie etwa "denken", "glauben", "wissen", "fühlen", "bewusst sein" - könnten nur dann triftig sein, wenn die Worte in ihrer üblichen Bedeutung expliziert und also auch verwendet werden.
Sieht man sich den Gebrauch dieser Wörter unbefangen an, wird hinreichend klar, dass sie nur auf Menschen als Ganzes - allgemeiner auf Tiere einer gewissen Entwicklungsstufe -, nicht auf deren Teile angewendet werden können: Es ist nicht etwa empirisch falsch, vom denkenden, fühlenden, bewussten Gehirn zu sprechen: Es ist vielmehr eine begriffliche Verwirrung. Und dieser Verwirrung erliegen in den Augen Bennetts und Hackers nicht nur eine Reihe von Neurowissenschaftlern, sondern auch ansonsten so gegensätzliche Philosophen wie Searle und Dennett, die in separaten Anhängen gnadenlos gezaust werden.
Nun kann man nachlesen, wie sich die beiden gegen ihre Kritiker zur Wehr setzen (Max Bennett, Daniel C. Dennett, Peter Hacker, John R. Searle: "Neuroscience & Philosophy". Brain, Mind & Language. Columbia University Press, New York 2007. 215 S., geb., 25,95 [Euro]). Searle gibt sich in der Form konziliant und in der Sache unbeeindruckt. Dennett holt dagegen zu einem breit angelegten Gegenangriff aus, der die Berufung auf eine eingespielte und durch keine Empirie veränderbare angebliche Ursprungsbedeutung unseres psychologischen Vokabulars aushebeln soll: Selbstverständlich dürfe man die Bedeutung von Wörtern wie "denken", "glauben", "fühlen" auch auf andere als die eingespielte Weise begreifen. In den Kognitions- und Neurowissenschaften werde es auf legitime Weise vorgemacht.
Wer daraufhin schon die Waage zu Dennetts Gunsten sich senken sieht, den muss die geschliffene Replik von Hacker und Bennett erst recht beeindrucken. Sie wissen ihr Projekt begrifflicher Klärungsarbeit an den Fundamenten der kognitiven Neurowissenschaften mit einer Verve zu verteidigen, die jener Dennetts um nichts nachsteht. Kurzweiliger und auf anregendere Weise als mit diesem Band kann man sich zentrale Fragen der Debatte um Neurowissenschaft und Philosophie kaum vor Augen führen.
HELMUT MAYER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"This remarkable book, the product of a collaboration between a philosopher and neuroscientist, shows that the claims made on behalf of cognitive science are ill-founded. The book will certainly arouse opposition... but if it causes controversy, it is controversy that is long overdue." Sir Anthony Kenny, President of the British Academy, 1989-93
"This book was simply waiting to be written." Denis Noble, Oxford University
"Contemporary scientists and philosophers may not like Bennett and Hacker's conclusions, but they will hardly be able to ignore them. The work is a formidable achievement." John Cottingham, Professor of Philosophy, Reading University
"Neuroscientists, psychologists and philosophers will be challenged - and educated - by this sustained and well-informed critique." Paul Harris, Professor, Human Development and Psychology, Graduate School of Education, Harvard University
"This book is a joy to read. It is the fruit of collaboration across disciplines and continents between a neurophysiologist and a philosopher. They have written a polemical work that is a model of clarity and directness. Distiniguished neurophysiologist M.R. Bennett of the University of Sydney, and eminent Oxford philosopher P.M.S. Hacker have produced that rarity of scholarship, a genuinely interdisciplinary work that succeeds. ... This is a wonderful book that will illuminate, provoke and delight professional scientists, philosophers and general readers alike." Australian Book Review
"Bennett and Hacker have identified [conceptual confusions] with clinical precision and relentless good sense.... rich with philosophical insights ... thoughtful and wonderfully useful treatise ..." Philosophy
"careful application in a host of cases ...is precisely what Bennett and Hacker provide in devastating critiques of psychologists and neuroscientists such as Blakemore, Crick, Damasio, Edelman, Gazzaniga, Kandel, Kosslyn, LeDoux, Penrose and Weiskrantz; and they also raise equally disturbing questions for philosophers such as Dennett, the Churchlands, Chalmers, Nagel and Searle. Whether this book leads to a reconfiguring of contemporary neuroscience and the philosophy associated with it will tell us much about the dynamics of contemporary intellectual life." Philosophy
"The vast spectrum of material in philosophy and neuroscience that Bennett and Hacker consider is impressive and their discussion is thorough and illuminating." Human Nature Review
1. '[It] will certainly, for a long time to come, be the most important contribution to the mind-body problem which there is.' G. H. von Wright
2. 'everyone who thinks about the mind and consciousness should study Philosophical Foundations of Neurtoscience. ... it will ultimately contribute to a far better understanding of mind and consciousness within scientific thought as well as a better understanding of the limits of empirical investigation', Arthur Collins, The Philosophical Quarterly, 2004
3. 'Sweeping, argumentative and brilliant, this book will provoke widespread discussion among philosophers and neuroscientists alike', Dennis Patterson, Notre Dame Philosophical Review, 2003
4. '...devastating critiques of psychologists and neuroscientists ... Whether this book leads to a reconfiguring of contemporary neuroscience and the philosophy associated with it will tell us much about the dynamics of contemporary intellectual life', Anthony O'Hear, Philosophy 2003
5. 'This book is a joy to read. ... a model of clarity and directedness... [Bennett and Hacker] have produced that rarity of scholarship, a genuinely interdisciplinary work that succeeds. ... This is a wonderful book that will illuminate, provoke and delight professional scientists, philosophers and general readers alike.', Damian Grace, Australian Book Review, 2003
6. 'clinical precision and ... relentless good sense ... [a] thoughtful and wonderfully useful treatise', Daniel N. Robinson, Philosophical Quarterly, 2004
7. 'mandatory reading for anybody interested in neuroscience and consciousness research. The vast spectrum of material in philosophy and neuroscience that Bennett and Hacker consider is impressive and their discussion is thorough and illuminating.' Axel Kohler, Human Nature Review, 2003
8. 'a delicious cake of a book in which Bennett and Hacker guide the reader through a conceptual minefield of confusions repeatedly made by neuroscientists and philosophers alike.' Constantine Sandis, Metapsychology 2003
9. 'Anyone who has ever framed a theory or explained one should read this book - at the risk of forever falling silent.', The Rector, University of Sydney, Obiter Dicta 2003
10. '... impressively lucid ... Bennett and Hacker unquestionably succeed in making us challenge our own concepts, examine them for dross, and strive to home in on fundamentals.' Neil Spurway, Journal of the European Soc for Study of Science and Theology.
11. '...the fruit of a unique cooperation between a neuroscientist and a philosopher ... an excellent book that should be read by all philosophers of cognition and all researchers in the cognitive neurosciences.' Herman Philipse, ABG #2, De Academische Boekengids 2003
12. `...there are, I think, grounds for hope that this book will do an enormous amount of good, both in correcting philosophical confusion within neuroscience and in promoting a new style of dialogue between neuroscience and philosophy' David Cockburn, Philosophical Investigations, 2005
"This book was simply waiting to be written." Denis Noble, Oxford University
"Contemporary scientists and philosophers may not like Bennett and Hacker's conclusions, but they will hardly be able to ignore them. The work is a formidable achievement." John Cottingham, Professor of Philosophy, Reading University
"Neuroscientists, psychologists and philosophers will be challenged - and educated - by this sustained and well-informed critique." Paul Harris, Professor, Human Development and Psychology, Graduate School of Education, Harvard University
"This book is a joy to read. It is the fruit of collaboration across disciplines and continents between a neurophysiologist and a philosopher. They have written a polemical work that is a model of clarity and directness. Distiniguished neurophysiologist M.R. Bennett of the University of Sydney, and eminent Oxford philosopher P.M.S. Hacker have produced that rarity of scholarship, a genuinely interdisciplinary work that succeeds. ... This is a wonderful book that will illuminate, provoke and delight professional scientists, philosophers and general readers alike." Australian Book Review
"Bennett and Hacker have identified [conceptual confusions] with clinical precision and relentless good sense.... rich with philosophical insights ... thoughtful and wonderfully useful treatise ..." Philosophy
"careful application in a host of cases ...is precisely what Bennett and Hacker provide in devastating critiques of psychologists and neuroscientists such as Blakemore, Crick, Damasio, Edelman, Gazzaniga, Kandel, Kosslyn, LeDoux, Penrose and Weiskrantz; and they also raise equally disturbing questions for philosophers such as Dennett, the Churchlands, Chalmers, Nagel and Searle. Whether this book leads to a reconfiguring of contemporary neuroscience and the philosophy associated with it will tell us much about the dynamics of contemporary intellectual life." Philosophy
"The vast spectrum of material in philosophy and neuroscience that Bennett and Hacker consider is impressive and their discussion is thorough and illuminating." Human Nature Review
1. '[It] will certainly, for a long time to come, be the most important contribution to the mind-body problem which there is.' G. H. von Wright
2. 'everyone who thinks about the mind and consciousness should study Philosophical Foundations of Neurtoscience. ... it will ultimately contribute to a far better understanding of mind and consciousness within scientific thought as well as a better understanding of the limits of empirical investigation', Arthur Collins, The Philosophical Quarterly, 2004
3. 'Sweeping, argumentative and brilliant, this book will provoke widespread discussion among philosophers and neuroscientists alike', Dennis Patterson, Notre Dame Philosophical Review, 2003
4. '...devastating critiques of psychologists and neuroscientists ... Whether this book leads to a reconfiguring of contemporary neuroscience and the philosophy associated with it will tell us much about the dynamics of contemporary intellectual life', Anthony O'Hear, Philosophy 2003
5. 'This book is a joy to read. ... a model of clarity and directedness... [Bennett and Hacker] have produced that rarity of scholarship, a genuinely interdisciplinary work that succeeds. ... This is a wonderful book that will illuminate, provoke and delight professional scientists, philosophers and general readers alike.', Damian Grace, Australian Book Review, 2003
6. 'clinical precision and ... relentless good sense ... [a] thoughtful and wonderfully useful treatise', Daniel N. Robinson, Philosophical Quarterly, 2004
7. 'mandatory reading for anybody interested in neuroscience and consciousness research. The vast spectrum of material in philosophy and neuroscience that Bennett and Hacker consider is impressive and their discussion is thorough and illuminating.' Axel Kohler, Human Nature Review, 2003
8. 'a delicious cake of a book in which Bennett and Hacker guide the reader through a conceptual minefield of confusions repeatedly made by neuroscientists and philosophers alike.' Constantine Sandis, Metapsychology 2003
9. 'Anyone who has ever framed a theory or explained one should read this book - at the risk of forever falling silent.', The Rector, University of Sydney, Obiter Dicta 2003
10. '... impressively lucid ... Bennett and Hacker unquestionably succeed in making us challenge our own concepts, examine them for dross, and strive to home in on fundamentals.' Neil Spurway, Journal of the European Soc for Study of Science and Theology.
11. '...the fruit of a unique cooperation between a neuroscientist and a philosopher ... an excellent book that should be read by all philosophers of cognition and all researchers in the cognitive neurosciences.' Herman Philipse, ABG #2, De Academische Boekengids 2003
12. `...there are, I think, grounds for hope that this book will do an enormous amount of good, both in correcting philosophical confusion within neuroscience and in promoting a new style of dialogue between neuroscience and philosophy' David Cockburn, Philosophical Investigations, 2005
Im Wesentlichen dokumentiert das Buch die Möglichkeit Wittgensteins Spätphilosophie kritisch auf die konzeptionellen Prämissen der Neurowissenschaften anzuwenden. Ein Fokus liegt dabei auf der Mereologie. Die Mereologie ist eine noch relativ junge philosophische Disziplin an der Grenze zwischen Logik und Philosophie. Sie untersucht in systematischer Weise auf der Grundlage geeigneter logischer Systeme die Beziehungen zwischen Teil (griech. meros) und Ganzem. Von besonderem philosophischem Interesse ist die Frage, inwieweit sich mereologische Strukturen zur Klärung und Lösung verschiedenster Probleme vor allem der Ontologie und Erkenntnistheorie einsetzen lassen. Hackers Dartellung ist dabei ein besonders gelungener Versuch, diese Frage zu beantworten. Einigen (!) Neurowissenschaftlern unterläuft nämlich der sprachlogische Fehler Attribute auf das Gehirn anzuwenden, die nur dem Menschen als Ganzem zugeschrieben werden können. Es ist demnach also nicht möglich eine neue Grammatik einzuführen, die es erlauben würde zu postulieren, das es das menschliche Gehirn ist, welches "denkt", "konzeptioniert" oder "konstruiert". Solche Fähigkeiten können nur dem Menschen als Ganzem zugeschrieben werden. Dieser Grundgedanke zieht sich durch das ganze Buch. Sicherlich ist der Umfang des Buches nicht an allen Stellen gerechtfertigt. Die Ursache hierfür ist aber weniger bei Hacker zu suchen, als vielmehr an der Vielzahl der Neurowissenschaftler mit denen der Autor sich beschäftigt. Insgesamt ein gelungenes Werk, das zur Pflichtlektüre eines jeden gehören sollte, der sich mit der Philosophie des Geistes aus einer sprachkritischen Perspektive beschäftigen möchte. (Amazon.de, Juli 2010)