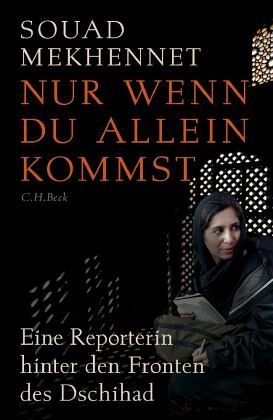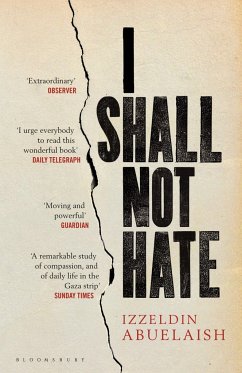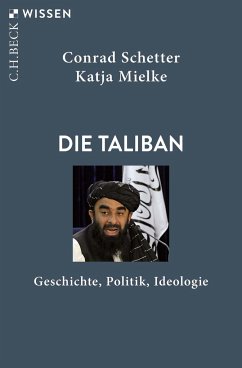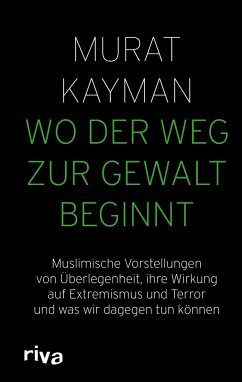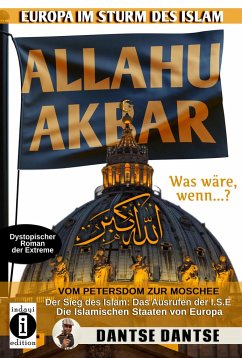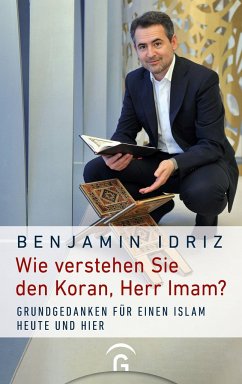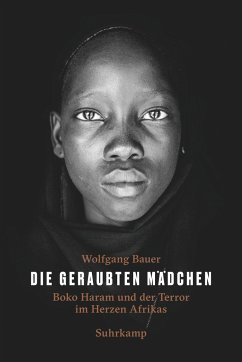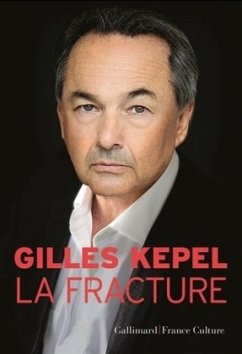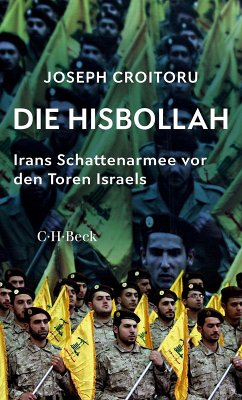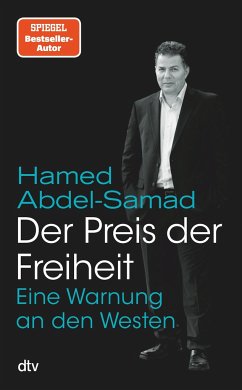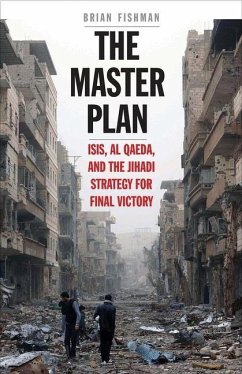Souad Mekhennet
Gebundenes Buch
Nur wenn du allein kommst
Eine Reporterin hinter den Fronten des Dschihad. Ausgezeichnet mit dem Ludwig Börne-Preis 2018 und dem Henri-Nannen-Preis 2018
Übersetzung: Nonhoff, Sky
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Was passiert hinter den Fronten des Jihad? Wie ticken Warlords und jugendliche Attentäter? Spannend wie in einem Krimi berichtet Souad Mekhennet von ihren teils lebensgefährlichen Recherchen in den No-go-Areas des Terrors, allein, ohne Handy, bekleidet mit einer schwarzen Abaya. Die Journalistin Souad Mekhennet verfügt über ungewöhnliche Verbindungen zu den Most Wanted des Jihad - und über ein einzigartiges investigatives Talent. Sie deckte die Entführung und Folterung des Deutsch-Libanesen Khaled al-Masri durch die CIA auf, interviewte den Führer von al-Qaida im Maghreb, obwohl ihr di...
Was passiert hinter den Fronten des Jihad? Wie ticken Warlords und jugendliche Attentäter? Spannend wie in einem Krimi berichtet Souad Mekhennet von ihren teils lebensgefährlichen Recherchen in den No-go-Areas des Terrors, allein, ohne Handy, bekleidet mit einer schwarzen Abaya. Die Journalistin Souad Mekhennet verfügt über ungewöhnliche Verbindungen zu den Most Wanted des Jihad - und über ein einzigartiges investigatives Talent. Sie deckte die Entführung und Folterung des Deutsch-Libanesen Khaled al-Masri durch die CIA auf, interviewte den Führer von al-Qaida im Maghreb, obwohl ihr die Geheimdienste auf den Fersen waren, lernte ein ägyptisches Foltergefängnis unfreiwillig von innen kennen, enttarnte den berüchtigten IS-Henker "Jihadi John" und wusste nach den Pariser Anschlägen schon vor der Polizei, wer der in Saint Denis erschossene Attentäter war. Ihre meisterhaften Nahaufnahmen lassen uns die Kämpfe und Wünsche der islamischen Welt besser verstehen und führen uns heilsam vor Augen, dass sich der Clash zwischen Islam und Westen in Wirklichkeit nur in den Köpfen abspielt.
Souad Mekhennet hat ihr Leben lang zwischen den Welten gelebt. Die Tochter einer türkischen Mutter und eines marokkanischen Vaters ist in Deutschland aufgewachsen, recherchiert seit dem 11. September 2001 über den islamistischen Terror und ist Mitglied des Investigativteams der Washington Post. Souad Mekhennet erhielt den Daniel Pearl Award 2017, den Sonderpreis des Nannen Preises 2018 sowie den Ludwig-Börne-Preis 2018.
Sky Nonhoff, 1962 geboren, ist Kulturjournalist, Autor (Die dunklen Säle, Don’t Believe the Hype) und Kolumnist beim MDR.
Sky Nonhoff, 1962 geboren, ist Kulturjournalist, Autor (Die dunklen Säle, Don’t Believe the Hype) und Kolumnist beim MDR.
Produktdetails
- Verlag: Beck
- Originaltitel: I Was Told To Come Alone: My Journey Behind the Lines of Jihad
- 5. Aufl.
- Seitenzahl: 384
- Erscheinungstermin: 6. September 2024
- Deutsch
- Abmessung: 219mm x 147mm x 27mm
- Gewicht: 650g
- ISBN-13: 9783406711671
- ISBN-10: 3406711677
- Artikelnr.: 48000213
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.09.2017
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.09.2017Der nächste Informant steht schon bereit
Souad Mekhennet erzählt von ihrer Reporterreise ins schwarze Herz des Dschihadismus
An einer Stelle des Buches von Souad Mekhennet hält einer ihrer lokalen Helfer es nicht mehr aus und ruft, das sei ja vollkommen verrückt, wie sie und ihr Reporterkollege mit diesen Kerlen redeten: "Für mich heißen Sie in Zukunft nur noch Team Crazy." Mekhennet und ihr Kollege von der "New York Times" hatten da gerade den Anführer einer Dschihadistenbande in dessen Hauptquartier im Nordlibanon aufgesucht und, eingekreist von schwerbewaffneten Kämpfern, um ein Interview gebeten. Dabei waren es wieder einmal Mekhennets Chuzpe und schlagfertiger Humor gewesen, welche die Gesprächspartner
Souad Mekhennet erzählt von ihrer Reporterreise ins schwarze Herz des Dschihadismus
An einer Stelle des Buches von Souad Mekhennet hält einer ihrer lokalen Helfer es nicht mehr aus und ruft, das sei ja vollkommen verrückt, wie sie und ihr Reporterkollege mit diesen Kerlen redeten: "Für mich heißen Sie in Zukunft nur noch Team Crazy." Mekhennet und ihr Kollege von der "New York Times" hatten da gerade den Anführer einer Dschihadistenbande in dessen Hauptquartier im Nordlibanon aufgesucht und, eingekreist von schwerbewaffneten Kämpfern, um ein Interview gebeten. Dabei waren es wieder einmal Mekhennets Chuzpe und schlagfertiger Humor gewesen, welche die Gesprächspartner
Mehr anzeigen
überrumpelten. Der Helfer freilich fürchtete die ganze Zeit über um sein Leben.
Andere Termine verlaufen weniger glimpflich, und mehr als einmal gerät Souad Mekhennet ernstlich in Bedrängnis. Aber wie sollte das auch anders sein, hat die in Deutschland aufgewachsene Reporterin in den vergangenen sechzehn Jahren doch praktisch alle wichtigen Entwicklungsstationen des militanten Islamismus im Nahen Osten journalistisch begleitet. Ihre Texte erschienen unter anderem in der "New York Times", der "Washington Post" und auch in dieser Zeitung.
Von diesen Reisen und Aufträgen erzählt sie in ihrem heute erscheinenden Buch. Wollte man es einer Textsorte zuordnen, so käme wohl am ehesten ein literarisches Subgenre in Betracht: die verschleierte Autobiographie. Denn Mekhennet erzählt in dem Buch de facto ihre Lebensgeschichte, von ihrer Kindheit in Deutschland und Marokko bis ins Jahr 2016. Aufgemacht ist das Buch hingegen als Reportagereise in das schwarze Herz des Dschihadismus. Diese Kombination funktioniert allerdings durchaus, ist in Mekhennets Fall sogar fast zwingend, denn ihre Herkunft und Familiengeschichte spielen immer wieder in ihre Arbeit hinein.
Es gibt zwei wiederkehrende Leitmotive in Mekhennets Schilderungen: der sich seit etwa 2003 mit zunehmender Gewalt entfaltende Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten und die oft widersprüchliche westliche Nahost-Politik, die sich am deutlichsten in dem Debakel des Einmarschs im Irak zeigt. Beide Male ist Souad Mekhennet persönlich beteiligt, beide Male steht sie sozusagen zwischen den Fronten: einmal als Tochter einer schiitischen Türkin und eines sunnitischen Marokkaners und das andere Mal als "Deutsche mit Migrationshintergrund", wie es inzwischen heißt.
1993, als Souad Mekhennet fünfzehn Jahre alt war, hieß das "Scheißzigeuner" - so wurden sie und ihr Bruder damals von Skinheads genannt. Mekhennets Geschichte ist auch die einer Suche nach Anerkennung, sie musste sich immer wieder gegen Vorurteile durchsetzen. "Meine ersten Erfahrungen als Journalistin waren niederschmetternd", schreibt sie mit Blick auf Diskriminierungserfahrungen, "ich konnte nur allzu gut nachempfinden, warum sich so viele Muslime in Europa ausgegrenzt und unerwünscht fühlten."
Dabei war Mekhennet genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nach den Anschlägen des 11. September 2001 begann die junge Journalistin kurzerhand, auf eigene Faust in Hamburger Islamistenkreisen zu recherchieren. Ihre arabischen Sprachkenntnisse und ihre Herkunft halfen ihr dabei, und so landete sie bald als freie Mitarbeiterin bei der "Washington Post" - und später mit einem ersten Auftrag im Irak. Dort - und in vielen anderen islamischen Ländern, in die sie in den folgenden Jahren reiste - erlebte Mekhennet hautnah mit, wie das uralte islamische Schisma zwischen Sunniten und Schiiten sich mit aktuellen politischen Machtkämpfen verband. Und stellte fest, wie immer mehr Sunniten ihr mit glühenden Blicken erzählten, dass bald "das Kalifat" wiederauferstehen werde.
Anschaulich berichtet sie aus ihren Begegnungen mit Kämpfern und Ideologen; etwa mit dem jordanischen Prediger, für den die Schiiten der Hizbullah die "Truppen des Satans" sind. Die Recherchen zu den jungen Dschihadisten, die als Selbstmordattentäter losgezogen waren, im jordanischen Zarqa - der Geburtsstadt von Abu Musab al Zarqawi -, sowie die Schilderung eines beinahe übel ausgegangenen Verhörs in einem Gefängnis des ägyptischen Militärgeheimdienstes Anfang 2011 gehören zu den dichtesten und bedrückendsten Kapiteln des Buches. Durchgehend wird jedoch in hohem Tempo erzählt. Das Buch ist dabei handlungsgetrieben, es lebt nicht von der Analyse, sondern davon, dass unablässig etwas passiert: Andauernd, so scheint es, meldet sich einer ihrer immer zahlreicheren Informanten und weist sie auf die nächste große Geschichte hin. Khaled el-Masri, der von der CIA entführte Deutsche, ruft sogar selbst an. Und Mekhennet wirft sich ohne zu zögern in jedes Abenteuer.
Die Erzählweise des Buches bringt es mit sich, dass die Autorin stets die smarteste, kundigste und mutigste von allen ist. Nebenbei verzaubert sie auch noch den einen oder anderen Dschihadisten und Geheimdienstoffizier - ein Taliban-Kommandeur in Pakistan benennt sogar seine Tochter nach ihr. Dass der Eindruck der Selbstverliebtheit trotzdem nicht entsteht, liegt an den Selbstzweifeln und der Erschöpfung, die Mekhennet immer wieder auch in Worte fasst - neben ihrer Kritik an der Kurzsichtigkeit der westlichen Interventionspolitik. Und an der Härte des Stoffes. Nach Monaten im Irak habe sie "der Geruch von verbranntem Fleisch, der Donner von detonierendem Sprengstoff, das Wehklagen von Männern und Frauen, die nach ihren Angehörigen suchen", verfolgt, schreibt sie an einer Stelle.
Das letzte Kapitel zeigt, wie die Berichterstattung über das Attentat im Olympia-Einkaufszentrum in München sich für Souad Mekhennet zum Familiendrama entwickelt. Nicht nur an dieser Stelle wird deutlich, wie nahe der Terrorismus auch den Menschen in Deutschland kommen kann. Und wie wenig sie sich dann von den trauernden Vätern, Müttern, Töchtern und Söhnen im Irak oder in Syrien unterscheiden.
CHRISTIAN MEIER
Souad Mekhennet:
"Nur wenn du allein kommst". Eine Reporterin hinter den Fronten des Dschihad.
Aus dem Englischen von Sky Nonhoff. C. H. Beck Verlag, München 2017. 384 S., geb., 24,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Andere Termine verlaufen weniger glimpflich, und mehr als einmal gerät Souad Mekhennet ernstlich in Bedrängnis. Aber wie sollte das auch anders sein, hat die in Deutschland aufgewachsene Reporterin in den vergangenen sechzehn Jahren doch praktisch alle wichtigen Entwicklungsstationen des militanten Islamismus im Nahen Osten journalistisch begleitet. Ihre Texte erschienen unter anderem in der "New York Times", der "Washington Post" und auch in dieser Zeitung.
Von diesen Reisen und Aufträgen erzählt sie in ihrem heute erscheinenden Buch. Wollte man es einer Textsorte zuordnen, so käme wohl am ehesten ein literarisches Subgenre in Betracht: die verschleierte Autobiographie. Denn Mekhennet erzählt in dem Buch de facto ihre Lebensgeschichte, von ihrer Kindheit in Deutschland und Marokko bis ins Jahr 2016. Aufgemacht ist das Buch hingegen als Reportagereise in das schwarze Herz des Dschihadismus. Diese Kombination funktioniert allerdings durchaus, ist in Mekhennets Fall sogar fast zwingend, denn ihre Herkunft und Familiengeschichte spielen immer wieder in ihre Arbeit hinein.
Es gibt zwei wiederkehrende Leitmotive in Mekhennets Schilderungen: der sich seit etwa 2003 mit zunehmender Gewalt entfaltende Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten und die oft widersprüchliche westliche Nahost-Politik, die sich am deutlichsten in dem Debakel des Einmarschs im Irak zeigt. Beide Male ist Souad Mekhennet persönlich beteiligt, beide Male steht sie sozusagen zwischen den Fronten: einmal als Tochter einer schiitischen Türkin und eines sunnitischen Marokkaners und das andere Mal als "Deutsche mit Migrationshintergrund", wie es inzwischen heißt.
1993, als Souad Mekhennet fünfzehn Jahre alt war, hieß das "Scheißzigeuner" - so wurden sie und ihr Bruder damals von Skinheads genannt. Mekhennets Geschichte ist auch die einer Suche nach Anerkennung, sie musste sich immer wieder gegen Vorurteile durchsetzen. "Meine ersten Erfahrungen als Journalistin waren niederschmetternd", schreibt sie mit Blick auf Diskriminierungserfahrungen, "ich konnte nur allzu gut nachempfinden, warum sich so viele Muslime in Europa ausgegrenzt und unerwünscht fühlten."
Dabei war Mekhennet genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nach den Anschlägen des 11. September 2001 begann die junge Journalistin kurzerhand, auf eigene Faust in Hamburger Islamistenkreisen zu recherchieren. Ihre arabischen Sprachkenntnisse und ihre Herkunft halfen ihr dabei, und so landete sie bald als freie Mitarbeiterin bei der "Washington Post" - und später mit einem ersten Auftrag im Irak. Dort - und in vielen anderen islamischen Ländern, in die sie in den folgenden Jahren reiste - erlebte Mekhennet hautnah mit, wie das uralte islamische Schisma zwischen Sunniten und Schiiten sich mit aktuellen politischen Machtkämpfen verband. Und stellte fest, wie immer mehr Sunniten ihr mit glühenden Blicken erzählten, dass bald "das Kalifat" wiederauferstehen werde.
Anschaulich berichtet sie aus ihren Begegnungen mit Kämpfern und Ideologen; etwa mit dem jordanischen Prediger, für den die Schiiten der Hizbullah die "Truppen des Satans" sind. Die Recherchen zu den jungen Dschihadisten, die als Selbstmordattentäter losgezogen waren, im jordanischen Zarqa - der Geburtsstadt von Abu Musab al Zarqawi -, sowie die Schilderung eines beinahe übel ausgegangenen Verhörs in einem Gefängnis des ägyptischen Militärgeheimdienstes Anfang 2011 gehören zu den dichtesten und bedrückendsten Kapiteln des Buches. Durchgehend wird jedoch in hohem Tempo erzählt. Das Buch ist dabei handlungsgetrieben, es lebt nicht von der Analyse, sondern davon, dass unablässig etwas passiert: Andauernd, so scheint es, meldet sich einer ihrer immer zahlreicheren Informanten und weist sie auf die nächste große Geschichte hin. Khaled el-Masri, der von der CIA entführte Deutsche, ruft sogar selbst an. Und Mekhennet wirft sich ohne zu zögern in jedes Abenteuer.
Die Erzählweise des Buches bringt es mit sich, dass die Autorin stets die smarteste, kundigste und mutigste von allen ist. Nebenbei verzaubert sie auch noch den einen oder anderen Dschihadisten und Geheimdienstoffizier - ein Taliban-Kommandeur in Pakistan benennt sogar seine Tochter nach ihr. Dass der Eindruck der Selbstverliebtheit trotzdem nicht entsteht, liegt an den Selbstzweifeln und der Erschöpfung, die Mekhennet immer wieder auch in Worte fasst - neben ihrer Kritik an der Kurzsichtigkeit der westlichen Interventionspolitik. Und an der Härte des Stoffes. Nach Monaten im Irak habe sie "der Geruch von verbranntem Fleisch, der Donner von detonierendem Sprengstoff, das Wehklagen von Männern und Frauen, die nach ihren Angehörigen suchen", verfolgt, schreibt sie an einer Stelle.
Das letzte Kapitel zeigt, wie die Berichterstattung über das Attentat im Olympia-Einkaufszentrum in München sich für Souad Mekhennet zum Familiendrama entwickelt. Nicht nur an dieser Stelle wird deutlich, wie nahe der Terrorismus auch den Menschen in Deutschland kommen kann. Und wie wenig sie sich dann von den trauernden Vätern, Müttern, Töchtern und Söhnen im Irak oder in Syrien unterscheiden.
CHRISTIAN MEIER
Souad Mekhennet:
"Nur wenn du allein kommst". Eine Reporterin hinter den Fronten des Dschihad.
Aus dem Englischen von Sky Nonhoff. C. H. Beck Verlag, München 2017. 384 S., geb., 24,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
»Ich sollte allein kommen. Ohne Ausweispapiere oder sonstige Dokumente; Handy, Aufnahmegerät, Uhr und Handtasche sollte ich in meinem Hotel in Antakya lassen. Erlaubt waren lediglich ein Notizbuch und ein Kugelschreiber.«
Sommer 2014. Die Journalistin Souad Mekhennet hat eine …
Mehr
»Ich sollte allein kommen. Ohne Ausweispapiere oder sonstige Dokumente; Handy, Aufnahmegerät, Uhr und Handtasche sollte ich in meinem Hotel in Antakya lassen. Erlaubt waren lediglich ein Notizbuch und ein Kugelschreiber.«
Sommer 2014. Die Journalistin Souad Mekhennet hat eine Verabredung zu einem Interview mit einem Kommandeur des IS. Mitten in der Nacht. Und allein.
Schon der Anfang des Buchs las sich wie ein Thriller. Die Gefahr, in die sich Souad Mekhennet begeben hat, wird niemand von der Hand weisen. Wie kommt eine Frau dazu, einen solchen Schritt zu wagen? Woher nimmt sie den Mut?
Ein autobiographischer Teil, der sich anschließt, hilft, die Autorin kennenzulernen. Schon früh musste sie lernen, gegen Widerstände zu kämpfen. Eben weil sie in Deutschland geboren und aufgewachsen war, es als ihre Heimat ansah und doch wegen ihrer Wurzeln diskriminiert wurde. Im September 2001 war sie eine junge Journalistin, zutiefst schockiert und von dem Wunsch getrieben zu verstehen, was da geschehen war.
Souad Mekhennet begriff es als ihre Aufgabe, die Beweggründe zu erfahren und sie der Welt mitzuteilen. Weshalb radikalisieren sich junge Männer und Frauen? Wo kommt all der Hass her? So reist sie um die Welt, von einem Krisengebiet ins nächste. Ob im türkisch-syrischen Grenzgebiet, im Irak oder in Jordanien – immer wieder begibt sie sich in Lebensgefahr. In Ägypten wird sie verhaftet und lernt ein berüchtigtes Foltergefängnis von innen kennen. Zeitgleich wird sie aber auch von westlichen Regierungen argwöhnisch beobachtet und fragt sich manchmal, von welcher Seite ihr mehr Gefahr droht.
Unbeirrt bemüht sie sich um Gespräche mit Dschihadisten, interviewt Anführer von al-Qaida, radikalisierte Jugendliche und ihre Familien, Politiker und Imame. Wo nötig zieht sie zum Gespräch eine Abaya über Jeans und T-Shirt, verzichtet aber fast nie auf das Stellen unbequemer Fragen.
In ihren Reportagen bemüht sie sich um Objektivität. Dafür bringt sie die besten Voraussetzungen mit, denn von klein auf ist sie gewohnt, zwischen den Welten zu leben. Als Kind marokkanisch-türkischer Eltern wächst sie in Deutschland auf, wird sowohl eine gläubige Muslimin als auch eine selbstbewusste, moderne Frau. Und stellt als Tochter eines Sunniten und einer Schiitin schockiert fest, dass diese beiden Glaubensrichtungen sich in Teilen der Welt abgrundtief hassen und bekämpfen.
Ihre Sichtweise und die Art zu berichten hat mich wirklich beeindruckt. Offen legt sie ihre Meinung dar, verurteilt Gewalt und Hass, bemüht sich aber auch zu verstehen, wie beides entstehen kann. Und hofft darauf, dass ihre Erkenntnisse helfen können, noch mehr Hass und Morde zu verhindern.
Ich für mein Teil habe viel Interessantes erfahren und gelernt. Souad Mekhennet schildert die Hintergründe so mancher Konflikte, erläutert die Differenzen zwischen Sunniten und Schiiten, sie denkt über die wahre Natur des sogenannten Arabischen Frühlings nach und stellt Menschen vor, die an der Deradikalisierung junger Muslime arbeiten. Sie befasst sich mit Frauenrechten, spricht aber auch über Europäerinnen, die davon träumen, einen IS-Kämpfer zu heiraten. Sehr spannend fand ich auch die Enttarnung von „Jihadi John“ – meine Güte, die Autorin ist sowohl mutig, einfallsreich als auch intelligent!
Der Stil sagte mir ebenfalls sehr zu. Obwohl reichlich Fakten geschildert werden und mir manchmal aufgrund der vielen arabischen Namen der Kopf rauchte, ist die Schilderung sehr lebhaft und gut zu lesen. Immer wieder gibt Souad Mekhennet Einblicke in ihr Gefühlsleben, man spürt, dass sie durchaus Ängste hat – und zwar nicht nur um ihr eigenes Leben, sondern auch um die Zukunft der westlichen und der arabischen Welt.
Fazit: Hut ab vor dieser großartigen Frau! Sehr lesenswerter Bericht, der informiert, nachdenklich macht und um gegenseitiges Verständnis wirbt.
»Nicht die Religion radikalisiert den Menschen; der Mensch radikalisiert die Religion.«
Weniger
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Auf rund 350 Seiten in 15 Kapitel, chronologisch aufgebaut, plus Prolog und Epilog aufgeteilt, erzählt Souad Mekhennet spannende Dinge von ihren Begegnungen mit führenden Persönlichkeiten des Jihad, die sie ihren außergewöhnlichen Kontakten zu verdanken hat. Man reist mit …
Mehr
Auf rund 350 Seiten in 15 Kapitel, chronologisch aufgebaut, plus Prolog und Epilog aufgeteilt, erzählt Souad Mekhennet spannende Dinge von ihren Begegnungen mit führenden Persönlichkeiten des Jihad, die sie ihren außergewöhnlichen Kontakten zu verdanken hat. Man reist mit ihr nach Jordanien und Libanon in 2007 (Kap. 5 und 6), nach Algerien in 2008 (Kap. 7), Pakistan in 2009 (Kap. 8), Ägypten, Tunesien, Bahrain, Iran in 2011 (Kap. 9-11). In England 2014-2015 ist man mit ihr auf der Spur von Jihadi John, dessen Identität und Werdegang dann offengelegt werden. Anfangs ist man mit der kleinen Souad in Deutschland und Marokko in 1978-1993 und im Prolog in der Türkei 2014, wo sie mit einem ganz hohen Anführer des IS sprach. Es ist eine bemerkenswerte Reise, die nicht nur im geografischen Sinne spannend ist, bei der es hier und da beschrieben wird, was man dort für Sitten pflegt und was auf den Tisch kommt, wie z.B. im Kap. 8, vielmehr ist es eine Reise durch die Weltanschauung der radikalen Islamisten, bei der sie ihren Werdegang, ihre Überzeugungen und Motive in Gesprächen mit Souad offenlegen. Klar wird dabei, dass diese Menschen, mit ethnischen Wurzeln in arabischen, nordafrikanischen, etc. Ländern, die in Westeuropa großgeworden sind und einige ihre Studienabschlüsse dort erworben haben, nun erbittert gegen den Westen kämpfen, der ihnen seine politische Federführung und noch einiges mehr aufzudrängen versucht, so ihre Auffassung; im Gegenzug aber keine Möglichkeit eingeräumt hat, sich in den westlichen Ländern zu integrieren und auf einer Augenhöhe über die gegenwärtigen Probleme zu reden. Sprache wäre da nicht das Problem. Diese Leute sind in der Regel gut gebildet und mehrsprachig. Klar ist auch, dass diese Menschen die hegemoniale Führung der USA nicht länger akzeptieren wollen und auch gegen diese nun aktiv ankämpfen, s. z.B. S.12, 165, 194, 233, 320. Souad redet mit diesen Kämpfern, um ihren Standpunkt zu verstehen, um ihren Lesern zu zeigen, wer hinter IS steht und warum sie ihre Interessen ausschließlich auf kriegerischem Wege durchzusetzen versuchen. Aber nicht alles dreht sich um Politik. Manches liest sich wie ein gutes Stück Literatur. Hin und wieder gibt es auch humorige Momente, z.B. als sich ein Sultan in Souad verliebt und ihr die Stelle seiner zweiten Frau, die seiner ersten im Haushalt und bei der Kindererziehung aushelfen sollte, bei einem üppigen Dinner in Pakistan angeboten hat.
Parallel erzählt Souad ihre eigene Geschichte, sowie das Leben ihrer Eltern, die als Gastarbeiter nach Deutschland kamen: Mutter aus der Türkei, Vater aus Marokko; auch die Lebensgeschichten ihrer Großeltern.
Souad erzählt personennah und familienbetont, sie lässt die Leser bei ihren Familiengesprächen teilhaben, um zu zeigen, dass die meisten Probleme wie Sunniten/Schiiten Konflikt, der auch in ihrer Familie präsent ist (Mutter Schiitin, Vater Sunnit), auch ohne Blutvergießen lösbar sind, wenn man einander zuhört.
Souad versucht nicht, ihre Leser mit grauenvollen Schilderungen der Blutbäder der Terroranschläge zu beeindrucken. Die Spannung, die sie aufbaut, ist viel subtiler Natur. Souad teilt ihre Erfahrungen, die sie während ihrer Arbeit gesammelt hatte. Und da lauerte die Gefahr fast an jeder Ecke. Wie viel Mut und Fingerspitzengefühl war nötig, um auf der Messers Schneide so souverän auftreten zu können!
Man kann noch viel über diese Buch schreiben, aber es ist besser, man liest es selbst.
Fazit: Ein sehr lesenswertes Buch, das sich manchmal wie ein Thriller und manchmal wie ein Roman liest. Man muss sich nicht groß für Politik interessieren, um Gefallen an diesem Werk zu finden. Das Buch ist sehr zugänglich und verständlich für alle, in einfacher, ausdruckstarker Sprache geschrieben worden. Menschenschicksale stehen dabei oft im Vordergrund und erzählen ihre bewegenden Geschichten. Für mich ist dieses Buch das erste Highlight in diesem Lese-Herbst. 5 wohl verdiente Sterne und ein klare Leseempfehlung!
Weniger
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Die Journalistin Souad Mekhennet ist in Deutschland geboren, aber ihre Wurzeln sind marrokanisch-türkisch. Dank ihrer Eltern weiß sie von klein auf, dass ein Zusammenleben von Schhiten und Sunniten möglich ist. Doch in der islamischen Welt prallen die verschiedenen …
Mehr
Die Journalistin Souad Mekhennet ist in Deutschland geboren, aber ihre Wurzeln sind marrokanisch-türkisch. Dank ihrer Eltern weiß sie von klein auf, dass ein Zusammenleben von Schhiten und Sunniten möglich ist. Doch in der islamischen Welt prallen die verschiedenen Glaubsrichtungen imemr wieder aufeinander. Viele Islamisten sind außerdem nicht gut auf den Westen zu sprechen. Die Journalistin wagt sich vor in diese gefährliche Welt und interviewt Warlords und Führer von al-Qaida. Dabei enthüllt sie Identitäten und geheime Machenschaften.
Die Journalistin erzählt ihre Lebensgeschichte und somit auch über ihre Reportagen, Interviews und Arbeitsweise. Man erfährt, dass sie in Deutschland geboren wurde, aber einen gewissen Teil ihrer Kindheit bei ihrer Großmutter in Marroko verbracht hat. Sie kann daher sehr gut Deutsch und Arabisch sprechen, was ihr später sehr viele Türen öffnen wird. Außderm ist sie sehr mit dem Islam vertraut. Früh ist Mekhennet klar, das sie Journalistin werden will und schaffst es shcließlich in Hamburg auf die Henri-Nannen-Schule. Ihre islamischen Wurzeln erlauben es ihr in Gebiete vorzudringen und Menschen zu interviewen, zu denen deutsche Journalisten niemals Zutritt bekämen. Sie weiß wie man sich zu verhalten hat und taucht entsprechend verschleiert zu ihren Inteviews auf. Außerdem lässt sie nicht lockert und lässt sich niemals einschüchtern. Das imponiert so einigen Anführern, so dass sie exklusive Interviews erhält.
Ihr journalistische Reise beginnt mit dem 11. September 2001 und führt sie über den islanischen Frühling bis in die Gegenwart. Man bekommt die andere Seite zu sehen, lernt deren Beweggründe kennen. Warum schließen sich so viele, junge Männer dem Dschiad an? Was versprechen sie sich vom Kalifat? Warum hat sie der Westen enttäuscht?
Mekhennet hat einen ganz eigenen Charakter, der sie prädestiniert für den Job als Jourlanistin. Sie hinterfragt die Dinge, sie traut sich in Krisengebiete und hört tatsächlich zu ohne zu verurteilen oder jemals nur die eine Seite zu beleuchten. Sie lässt sich auch nicht von Entführungen, Verhaftungen oder Drohungen einschüchtern. Es ist spannend sie auf ihren Reisen und Interviews zu begleiten. Mitzufiebern, wenn sie versucht geheime Identitäten und Machenschaften aufzudecken. Sie berichtet von Einzelschicksalen, bringt sie in den großen Zusammenhang und ist stets vor Ort, mittendrin in den größten Tumulten und Auseinandersetzungen.
Gerade als Westler weiß man oft nicht allzu viel über den Islam und warum sich junge Menschen zu radikalisierten Islamisten werden. Die Journalistin vermag auf eindringliche Art und Weise eine uns fast geheime Welt zu beleuchtet, in dem sie hinter die Kulissen schaut und sich nicht abschrecken lässt. Der Mut dieser Frau lässt einen neue Einblicke gewähren, die unbedingt jedem zuteil werden sollten. Daher gebe ich eine ganz klare Leseempfehlung, denn jede Medaille hat zwei Seiten.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für