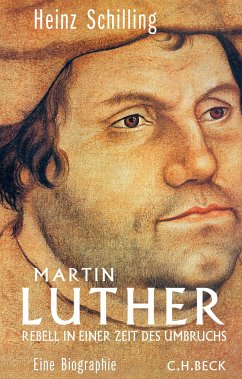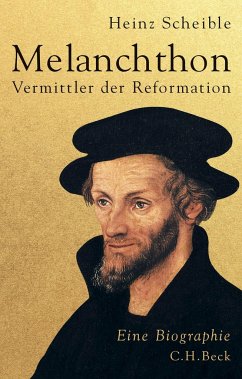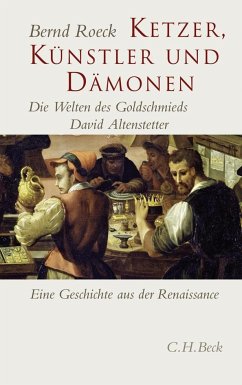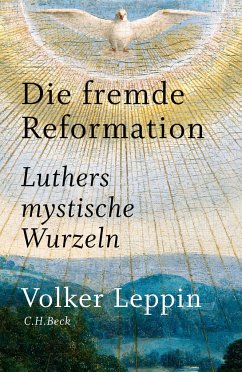Nicht lieferbar
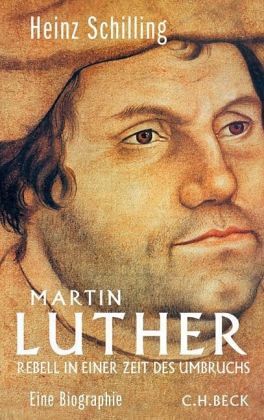
Martin Luther
Rebell in einer Zeit des Umbruchs. Eine Biographie
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Kein anderer Deutscher hat die Geschichte Europas zwischen Mittelalter und Moderne stärker geprägt als er. Der Wittenberger Mönch Martin Luther bietet Kaiser, Papst und Kirche die Stirn, will die Universalreform der Christenheit, begründet aber den Protestantismus. Damit treibt er zugleich die Entstehung der Territorialstaaten mächtig voran und verhilft auch einem Verständnis des Individuums zum Durchbruch, das den modernen Menschen wesentlich ausmachen wird.Heinz Schilling, einer der renommiertesten Kenner der Epoche, stellt diesen welthistorischen Rebell in seine Zeit und zeigt eindruc...
Kein anderer Deutscher hat die Geschichte Europas zwischen Mittelalter und Moderne stärker geprägt als er. Der Wittenberger Mönch Martin Luther bietet Kaiser, Papst und Kirche die Stirn, will die Universalreform der Christenheit, begründet aber den Protestantismus. Damit treibt er zugleich die Entstehung der Territorialstaaten mächtig voran und verhilft auch einem Verständnis des Individuums zum Durchbruch, das den modernen Menschen wesentlich ausmachen wird.
Heinz Schilling, einer der renommiertesten Kenner der Epoche, stellt diesen welthistorischen Rebell in seine Zeit und zeigt eindrucksvoll das Andere und Fremde an ihm. Er schildert ihn nicht als einsamen Heros, sondern als Akteur in einem gewaltigen Ringen um die Religion und ihre Rolle in der Welt. Seine brillante Biographie dringt tief in Luthers Sphäre ein und portraitiert den Reformator als schwierigen, widersprüchlichen Charakter, der kraft seines immensen Willens zwar die Welt verändert - in vielem aber auch ganz anders, als er es beabsichtigte.
Heinz Schilling, einer der renommiertesten Kenner der Epoche, stellt diesen welthistorischen Rebell in seine Zeit und zeigt eindrucksvoll das Andere und Fremde an ihm. Er schildert ihn nicht als einsamen Heros, sondern als Akteur in einem gewaltigen Ringen um die Religion und ihre Rolle in der Welt. Seine brillante Biographie dringt tief in Luthers Sphäre ein und portraitiert den Reformator als schwierigen, widersprüchlichen Charakter, der kraft seines immensen Willens zwar die Welt verändert - in vielem aber auch ganz anders, als er es beabsichtigte.