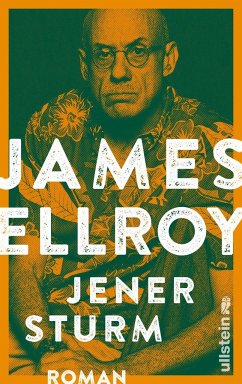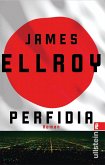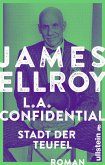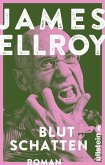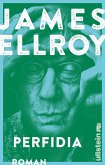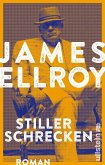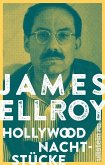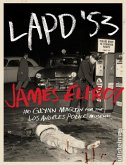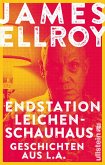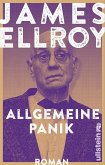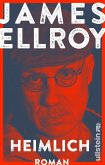am Pool
Merkwürdig monoton:
James Ellroys „Jener Sturm“
Für Cinephile mag „Jener Sturm“, der zweite Band von James Ellroys monströsem zweiten L. A.-Quartett, ziemlich qualvoll sein, weil hier Orson Welles, der es wahrlich nicht leicht hatte in Hollywood, sehr übel mitgespielt wird. Welles wird an seinem eigenen Swimmingpool gemein malträtiert, mit Nagelstiefeln und quarzsandgefüllten Schlägerhandschuhen. Dudley Smith tritt und schlägt, der fiese Cop, den man aus dem ersten L. A.-Quartett kennt und aus dem Film „L. A. Confidential“ und der hier schlimme Pläne hat. Er sammelt Naziklamotten und verachtet Hebräer, Japsen, Mexen. Den geschundenen Welles zwingt er zu Spitzeldiensten, fotografiert sein Gesicht nach der Attacke am Pool. „Die Kamera war mit Farbfilm geladen. Blutrot würde auf den Fotos überwiegen.“ Blutrot überwiegt auch in Ellroys Buch, er ist besessen vom splatterigen Detail. Handlung, Dramaturgie und Psychologie interessieren nicht wirklich. „Jener Sturm“ ist eine Symphonie, aus Tönen und Motiven, die man aus dem ersten Band „Perfidia“ kennt, nun aber schriller und sehr dissonant. Es ist wenig Bewegung im Buch, die Polyfonie klingt merkwürdig monoton.
„Jener Sturm“ beginnt Silvester 1942, wenige Tage nach Pearl Harbour, also bestimmen Kriegsangst und Rassismus die amerikanische Gesellschaft. Es gibt Verhaftung und Internierung der in der Stadt lebenden Japaner, erneut feindliche U-Boote vor der Küste, Angst vor Unterwanderung. Dudley Smith fährt nach Mexiko, verhandelt mit dubiosen Militärs dort, sein Mitstreiter ist der gewiefte Forensiker Hideo Ashida – auch ihn kennt man aus „Perfidia“ –, der nun einen militärischen Rang erhält, um ihn vor einer Verhaftung zu bewahren. Und dann ist da noch Joan Conville, ebenfalls wissenschaftlich brillant, die im Regen der Neujahrsnacht einen Unfall baut, vier Mexikaner tot und zwei Kinder. Es ist oft Regen im Anmarsch in diesem Buch.
Ellroy mag Orson Welles nicht, er findet, das Filmkunstwerk „Citizen Kane“ sei völlig überschätzt. Ellroy ist ein Monomane, in diesem Buch mehr ingeniös als genial, da muss er Orson als Konkurrenten empfinden. Mit infantilem Stolz bekundet er, er habe sich unabhängig gemacht von den modernen Medien, kein Fernsehen, keine Zeitungen, kein Internet. Sein imaginativer Fundus sind die gesammelten Magazine der Mutter, die er in der Kindheit las. Historische Akkuratesse ist sinnlos, er legt sich die Geschichte zurecht, rücksichts- und respektlos, unanständig und diffamierend. Kurt Weill treibt es hintenrum mit George Cukor, Brecht wird mit Leni Riefenstahl zusammengebracht. Auf einer Party wird die Nacht der langen Messer nachinszeniert, von Orson, im Sommer ’34, als Hitler die schwule Truppe seines alten Kampfgefährten Ernst Röhm massakrieren ließ – Visconti hat das in „Caduta degli dei“ grandios durchgespielt.
Ellroys Buch ist grotesk, aber nicht grimmig genug. Und je intensiver er sich in seine Klatsch-Realität zurückschraubt, desto deutlicher ist zu spüren, wie in der Zeit damals die aktuelle Situation der USA sich spiegelt. „Jener Sturm, die vernichtende Katastrophe.“ Eine lähmende Leere, die Kriegsgewinnler warten auf das Ende der Krise. Ein von Dudley verhörter Chinese bringt es auf den Punkt. „US kaputt nach Krieg. Nazis oder Rote übernehmen dann Welt. Demokratie für Tunten und Schwächlinge.“
GÖT
James Ellroy: Jener Sturm. Aus dem Englischen von Stephen Tree. Ullstein, Berlin 2020. 975 Seiten, 35 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Fritz Göttler geht es denn doch ein wenig zu "schrill" zu in James Ellroys zweitem von vier L.A.-Krimis um den Nazi-Ermittler Dudley Smith. Wenn ihn Ellroy hier ins Hollywood des Jahres 1942 entführt, Orson Welles mit Nagelstiefeln zusammenschlagen lässt, außerdem Riefenstahl und Brecht, Kurt Weill und George Cukor miteinander anbandeln lässt, erkennt Göttler zwar durchaus Ellroys Sinn fürs "Groteske". Insgesamt ist ihm das dann aber doch zu eintönig.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH