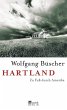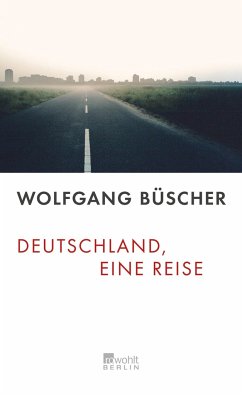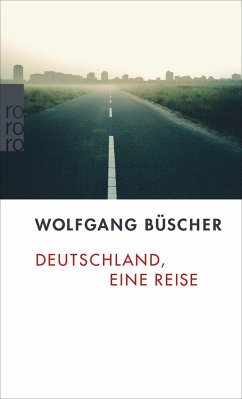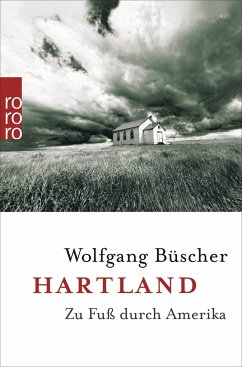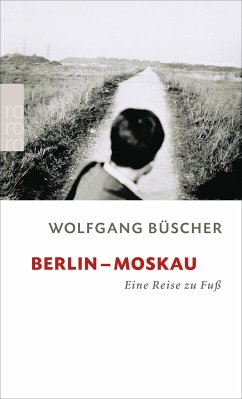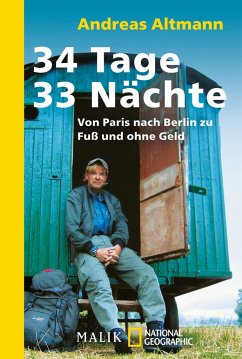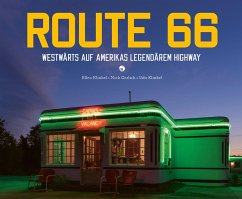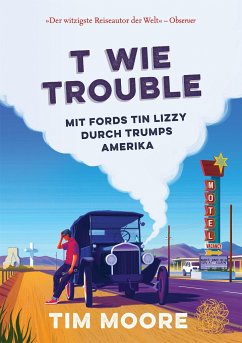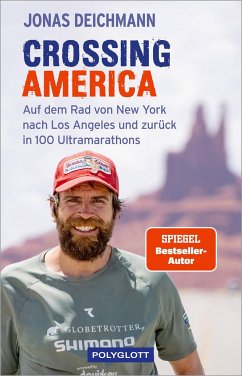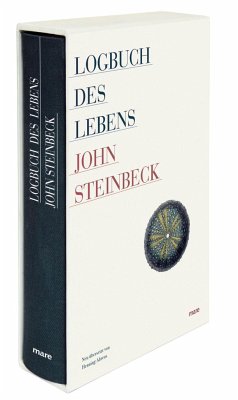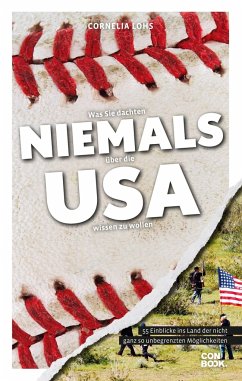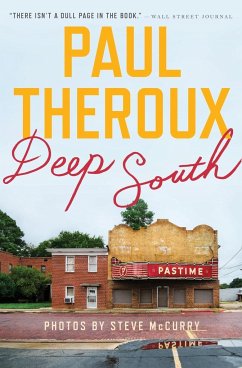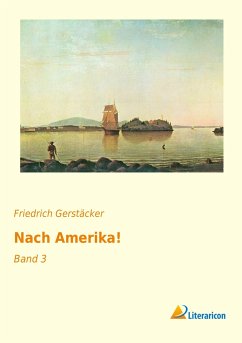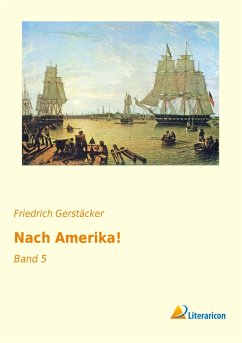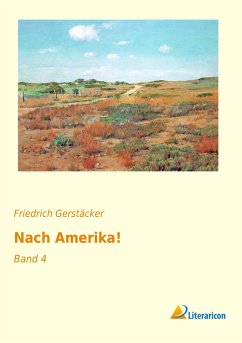Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Zu Fuß in das Herz Amerikas: das neue Reiseabenteuer von Wolfgang Büscher.
Zu Fuß in das Herz Amerikas, drei Monate lang, 3500 Kilometer von Nord nach Süd: Wolfgang Büscher hat das Abenteuer gewagt. Er läßt sich durch die schneebedeckte Prärie Norddakotas treiben, entdeckt den verlassenen Ort Hartland, der einst Heartland hieß, und freundet sich in den Great Plains mit einem rätselhaften indianischen Cowboy an. Dann folgt er der Route 77 vom Missouri bis zum Rio Grande. Bob Dylan nannte diese historische Straße einmal das eigentliche Herz Amerikas, ihr entlang lasse sich der Geist des Landes einfangen. In Kansas muss Büscher mit gespreizten Armen und Beinen am Wagen des Sheriffs stehen, auf offener Landstraße, er schläft in gespenstischen Motels und viktorianischen Herrenhäusern und flieht aus einem Nachtasyl. Dann Texas. Ranches, groß wie kleine Staaten, die Hitze des Südens. Bei Waco, wo einst die bewaffnete Davidianer-Sekte wochenlang vom FBI belagert wurde, trifft er den heutigen Sektenchef - der Wahn lebt. Büscher läßt sich weitertreiben, immerweiter nach Süden, durch die Desierto de los Muertos, bis er schließlich über den Rio Bravo nach Mexiko verschwindet ...
Ein einzigartiges Reiseabenteuer - geschrieben von einem Autor, dessen Bücher, so der «Spiegel», «zum Besten gehören, was in den letzten Jahren in deutscher Sprache erschienen ist».
"Seit 'Berlin-Moskau' wissen wir, dass Wolfgang Büscher literarisch reist wie kein anderer. Es ist ihm noch einmal gelungen, im Westen diesmal, der Sonne entgegen, Amerika im Blick, Europa im Herzen." (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Ein einzigartiges Reiseabenteuer - geschrieben von einem Autor, dessen Bücher, so der «Spiegel», «zum Besten gehören, was in den letzten Jahren in deutscher Sprache erschienen ist».
"Seit 'Berlin-Moskau' wissen wir, dass Wolfgang Büscher literarisch reist wie kein anderer. Es ist ihm noch einmal gelungen, im Westen diesmal, der Sonne entgegen, Amerika im Blick, Europa im Herzen." (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Wolfgang Büscher, geboren 1951 bei Kassel, ist Schriftsteller und Autor der 'Welt'. 'Er hat der Reiseliteratur', wie es im 'Deutschlandfunk' hieß, 'zu neuem Glanz verholfen.' Zu seinen Veröffentlichungen zählen 'Berlin - Moskau' (2003), 'Deutschland, eine Reise' (2005), 'Hartland' (2011) und 'Ein Frühling in Jerusalem' (2014). Für sein Werk wurde Wolfgang Büscher vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Kurt-Tucholsky-Preis, dem Johann-Gottfried-Seume-Literaturpreis und dem Ludwig-Börne-Preis.
Produktdetails
- Verlag: Rowohlt, Berlin
- Artikelnr. des Verlages: 18315
- 6. Aufl.
- Seitenzahl: 304
- Erscheinungstermin: 2. Mai 2011
- Deutsch
- Abmessung: 212mm x 136mm x 28mm
- Gewicht: 396g
- ISBN-13: 9783871346859
- ISBN-10: 3871346853
- Artikelnr.: 32471197
Herstellerkennzeichnung
Rowohlt Berlin
Neue Promenade 5
10178 Berlin
produktsicherheit@rowohlt.de
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.05.2011
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.05.2011Der lange Weg durch die Mitte
Wolfgang Büscher wandert durch Amerika und traut sich nicht über den Weg
Eine verkehrte Art des Reiseberichts, die dem Leser das Land rätselhaft macht, statt ihn mit Tipps zu behelligen
Je weiter man Wolfgang Büscher auf seinen Märschen folgt, desto mehr Fragen stellen sich. Dies ist nun schon die dritte Reise zu Fuß, die er in einem Buch beschreibt, und wer die beiden vorigen gelesen hat, müsste langsam wissen, um was es auf diesen Reisen geht oder zumindest wer da geht, aber das Gegenteil ist der Fall.
Im Fall dieser Reise durch Amerika kommt hinzu, dass der allein und zu Fuß gehende Mann mittleren Alters dort eine suspekte Erscheinung ist, zumal, wenn er früh im
Wolfgang Büscher wandert durch Amerika und traut sich nicht über den Weg
Eine verkehrte Art des Reiseberichts, die dem Leser das Land rätselhaft macht, statt ihn mit Tipps zu behelligen
Je weiter man Wolfgang Büscher auf seinen Märschen folgt, desto mehr Fragen stellen sich. Dies ist nun schon die dritte Reise zu Fuß, die er in einem Buch beschreibt, und wer die beiden vorigen gelesen hat, müsste langsam wissen, um was es auf diesen Reisen geht oder zumindest wer da geht, aber das Gegenteil ist der Fall.
Im Fall dieser Reise durch Amerika kommt hinzu, dass der allein und zu Fuß gehende Mann mittleren Alters dort eine suspekte Erscheinung ist, zumal, wenn er früh im
Mehr anzeigen
Jahr und durch die Mitte läuft. Ohne Auto, ohne Arbeitsmittel, ohne Familie, ja nicht mal mit Hund - solche Gestalten kennt dort nur der Horrorfilm, im Rucksack kann man Machete und Schrumpfkopf vermuten. Das weiß und spürt der Wanderer, der sich bald selbst suspekt ist. Schon bei der Einreise, die eine fiese und demütigende Verhörprozedur vorsieht, neigt der Reisende dazu, sich in vorauseilender Hermeneutik immer auch mit dem Blick der Grenzbeamten zu sehen und auf die Frage, wohin und was er eigentlich wolle, keine rechte Antwort zu wissen. Auf seiner Route steht ja keine Sehenswürdigkeit, er verfolgt keine Mission, nicht mal Termine mit aussagefähigen Personen wurden vereinbart. Er geht, als habe er die Landkarte nicht ausfalten können, stracks von oben nach unten, einmal durch die Mitte und kreuzt die Wege der alten Entdecker, öfter aber noch die Pfade der Indianer, mit denen ihn eine alte Liebe verbindet. Sie wird aber nur mäßig erwidert.
Die entscheidenden Abzweigungen führen den Wanderer in die ferne Vergangenheit, entlang der Geschichten von Black Elk oder dem deutschen Forscher Maximilian zu Wied, der 1833 an der Mündung des Heart Rivers an Land ging. In dieser für die neue Welt langen historischen Perspektive ist die Besiedlung des Westens eine Verlustgeschichte. Die Reflexion darüber, die Trauer auch, durchzieht das Buch.
Wie in all seinen Büchern schafft Büscher eine ganz eigene Erzählzeit und durchquert Länder, die in den uns vertrauten Gebieten bislang unentdeckt waren. Man kann gar nicht sagen, in welchem Jahr die Reise stattfand oder wie lange sie nun gedauert hat. Diesen Effekt erzielt er durch die gründlich durchdachte, altmeisterliche Sprache, deren Sound so unverwechselbar ist und der man so leicht verfällt: "Nichts gleicht dem Frieden, den fallender Schnee über das Gemüt des Wanderers wirft."
Es ist eine verkehrte Art des Reiseberichts, die dem Leser das Land fremd und rätselhaft macht, statt ihn etwa mit Tipps und Touren zu behelligen. Eine dieser amerikanischen Fragen ist, wohin der Buchstabe E verschwunden ist, der aus dem Heartland, dem Herzland, ein Hartland macht. Dass solche Fragen lebensentscheidend sein können, wissen Amerikafreunde seit jener öffentlichen Schulstunde, in welcher der damalige Vizepräsident Dan Quayle einem Schüler aus dem Plural von potato das E strich - und damit den Fehler beging, der seine Karriere ruinierte und ihm den Ruf einbrachte, ein Idiot zu sein. Mit dem E verschwinden die guten Geister.
Das harte Land liegt vor dem Fenster eines Hauses, in dem ein krebskranker Greis mit Gewehr sitzt und eine Website pflegt, die an seine große Zeit als Jäger und Soldat erinnert. Herzlich ist hier nichts mehr, die Leere der Mitte Amerikas ist eine einzige existentialistische Herausforderung. Die passende Antwort darauf ist, so erfährt es der Reisende immer wieder, das Spiel. Ob im Casino, am Automaten, beim Rodeo oder in der Politik - mit jeder neuen Partie geht das große Abwägen der Schicksalsmächte von Neuem los, und was könnte spannender sein in dieser von Weite und Langeweile geplagten Gegend.
Leider verrät uns das Buch kaum etwas von den praktischen Fragen, die auf so einer Tour zu lösen sind, außer wenn es wirklich eng wird. Einmal macht er in einem Eichenwald Rast, legt sein Gepäck am Fuße eines Baums ab und erkundet die Umgebung. Dann findet er den Baum nicht mehr, oder der Rucksack wurde geklaut. Immerhin beschert uns die Episode einen der seltenen relativ heiteren Sätze des Buches, als er sich nämlich vergeblich an Merkmale oder Zeichen des Baumstamms zu erinnern versucht, daran aber angesichts der Fülle der Bäume verzweifelt: "So viele Eichen, so viele Zeichen." Er erfährt dann, mitten in Texas, eine spontane Hilfsbereitschaft von zufällig vorbeikommenden, einfachen Leuten - das ist wirklich der schönste und anmutigste Charakterzug dort. Viele Amerikareisende haben Ähnliches erlebt.
Die beklemmendste Episode des Buches ist eine, die gar nicht stattgefunden hat. Eines Abends, es war in Fremont, nicht weit von Omaha, findet er kein anderes Quartier als ein freundliches Obdachlosenasyl. Es geht alles gut, aber eine Art innerer Stimme überwältigt den deutschen Alleinreisenden: "Du bist hier, weil du hierher gehörst (. . .) Du zögertest vorhin, die Klingel zu drücken, nun füge dich, nun drückst du sie jeden Tag." Es ist eine Zwangsvorstellung. Abermals übernimmt er den Blick der besorgten Fürsorger und wird darin vom Alleinreisenden zum Penner, und er entkommt ihr nur, indem er seinen Rucksack nimmt und sich beweist, dass er frei ist, hinauszulaufen und einen Bus zu nehmen. Die Erleichterung darüber empfindet auch der Leser: "Plötzlich erschien mir die öde Landschaft aus Motels, Imbissen und Tankstellen als das Reich der Freiheit und die gen Himmel ragenden Werbemasten wie versteinerte urweltliche Baumriesen."
Kurz vor Mexiko entdeckt er noch eine Art Abbild des Paradieses, jenseits der Grenze aber eine menschliche Hölle, so viel wird dort geschossen und gestorben. Es gibt aber einen Priester dort, der ihn gleich abschleppen will, und als der Reisende fragt, wohin, antwortet der: "Beichten. Sie sehen aus, als könnten Sie's brauchen."
Da denkt der Leser an all das zurück, was im Buch keine Erwähnung findet, an die Schnitte, Abblenden und Schwarzbilder und fragt sich erst recht, mit wem er da eigentlich gereist ist.
NILS MINKMAR
Wolfgang Büscher: Hartland. Zu Fuß durch Amerika. Rowohlt Berlin 2011, 302 Seiten, 19,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Die entscheidenden Abzweigungen führen den Wanderer in die ferne Vergangenheit, entlang der Geschichten von Black Elk oder dem deutschen Forscher Maximilian zu Wied, der 1833 an der Mündung des Heart Rivers an Land ging. In dieser für die neue Welt langen historischen Perspektive ist die Besiedlung des Westens eine Verlustgeschichte. Die Reflexion darüber, die Trauer auch, durchzieht das Buch.
Wie in all seinen Büchern schafft Büscher eine ganz eigene Erzählzeit und durchquert Länder, die in den uns vertrauten Gebieten bislang unentdeckt waren. Man kann gar nicht sagen, in welchem Jahr die Reise stattfand oder wie lange sie nun gedauert hat. Diesen Effekt erzielt er durch die gründlich durchdachte, altmeisterliche Sprache, deren Sound so unverwechselbar ist und der man so leicht verfällt: "Nichts gleicht dem Frieden, den fallender Schnee über das Gemüt des Wanderers wirft."
Es ist eine verkehrte Art des Reiseberichts, die dem Leser das Land fremd und rätselhaft macht, statt ihn etwa mit Tipps und Touren zu behelligen. Eine dieser amerikanischen Fragen ist, wohin der Buchstabe E verschwunden ist, der aus dem Heartland, dem Herzland, ein Hartland macht. Dass solche Fragen lebensentscheidend sein können, wissen Amerikafreunde seit jener öffentlichen Schulstunde, in welcher der damalige Vizepräsident Dan Quayle einem Schüler aus dem Plural von potato das E strich - und damit den Fehler beging, der seine Karriere ruinierte und ihm den Ruf einbrachte, ein Idiot zu sein. Mit dem E verschwinden die guten Geister.
Das harte Land liegt vor dem Fenster eines Hauses, in dem ein krebskranker Greis mit Gewehr sitzt und eine Website pflegt, die an seine große Zeit als Jäger und Soldat erinnert. Herzlich ist hier nichts mehr, die Leere der Mitte Amerikas ist eine einzige existentialistische Herausforderung. Die passende Antwort darauf ist, so erfährt es der Reisende immer wieder, das Spiel. Ob im Casino, am Automaten, beim Rodeo oder in der Politik - mit jeder neuen Partie geht das große Abwägen der Schicksalsmächte von Neuem los, und was könnte spannender sein in dieser von Weite und Langeweile geplagten Gegend.
Leider verrät uns das Buch kaum etwas von den praktischen Fragen, die auf so einer Tour zu lösen sind, außer wenn es wirklich eng wird. Einmal macht er in einem Eichenwald Rast, legt sein Gepäck am Fuße eines Baums ab und erkundet die Umgebung. Dann findet er den Baum nicht mehr, oder der Rucksack wurde geklaut. Immerhin beschert uns die Episode einen der seltenen relativ heiteren Sätze des Buches, als er sich nämlich vergeblich an Merkmale oder Zeichen des Baumstamms zu erinnern versucht, daran aber angesichts der Fülle der Bäume verzweifelt: "So viele Eichen, so viele Zeichen." Er erfährt dann, mitten in Texas, eine spontane Hilfsbereitschaft von zufällig vorbeikommenden, einfachen Leuten - das ist wirklich der schönste und anmutigste Charakterzug dort. Viele Amerikareisende haben Ähnliches erlebt.
Die beklemmendste Episode des Buches ist eine, die gar nicht stattgefunden hat. Eines Abends, es war in Fremont, nicht weit von Omaha, findet er kein anderes Quartier als ein freundliches Obdachlosenasyl. Es geht alles gut, aber eine Art innerer Stimme überwältigt den deutschen Alleinreisenden: "Du bist hier, weil du hierher gehörst (. . .) Du zögertest vorhin, die Klingel zu drücken, nun füge dich, nun drückst du sie jeden Tag." Es ist eine Zwangsvorstellung. Abermals übernimmt er den Blick der besorgten Fürsorger und wird darin vom Alleinreisenden zum Penner, und er entkommt ihr nur, indem er seinen Rucksack nimmt und sich beweist, dass er frei ist, hinauszulaufen und einen Bus zu nehmen. Die Erleichterung darüber empfindet auch der Leser: "Plötzlich erschien mir die öde Landschaft aus Motels, Imbissen und Tankstellen als das Reich der Freiheit und die gen Himmel ragenden Werbemasten wie versteinerte urweltliche Baumriesen."
Kurz vor Mexiko entdeckt er noch eine Art Abbild des Paradieses, jenseits der Grenze aber eine menschliche Hölle, so viel wird dort geschossen und gestorben. Es gibt aber einen Priester dort, der ihn gleich abschleppen will, und als der Reisende fragt, wohin, antwortet der: "Beichten. Sie sehen aus, als könnten Sie's brauchen."
Da denkt der Leser an all das zurück, was im Buch keine Erwähnung findet, an die Schnitte, Abblenden und Schwarzbilder und fragt sich erst recht, mit wem er da eigentlich gereist ist.
NILS MINKMAR
Wolfgang Büscher: Hartland. Zu Fuß durch Amerika. Rowohlt Berlin 2011, 302 Seiten, 19,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Er hat es wieder getan: Wolfgang Büscher, der schon von Berlin nach Moskau zu Fuß unterwegs war, hat nun auf Schusters Rappen die Vereinigten Staaten durchquert. Aber nicht frontiermäßig von Osten nach Westen, sondern von Norden nach Süden. Sehr beeindruckend findet der Rezensent Klaus Birnstiel das Ergebnis. Gegen Grenzposten, den Wind und anderes Wetter hat Büscher zu kämpfen, als größten Erfolg sieht es Birnstiel allerdings, dass er den Kampf gegen die üblichen Amerika-Klischees souverän besteht. Was daran liege, dass Büscher sich einlässt und dass er, dies wohl sogar zuerst, eine Sprache besitzt, die sowohl das Reiseführerdeutsch als auch "die erdenschwere Tiefsinnigkeit reisender Studiosi" weit neben und hinter sich lässt. Er hält die Augen offen, beschreibt Menschen, Landschaft und historische Hinterlassenschaften ganz genau. Heraus kommt erneut, so der Rezensent, ein Reisebericht von ganz eigener und meisterhafter Art.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Zu Fuß durch die USA von Nord nach Süd, von North Portal bis Brownsville. Zu Fuß wäre eher der Ausdruck ohne eigenes Auto, denn als auf der Straße aufgelesener Wanderer kann der Autor durchaus oftmals in einem Auto mitfahren. Von den sicherlich eher einsamen Tagen der …
Mehr
Zu Fuß durch die USA von Nord nach Süd, von North Portal bis Brownsville. Zu Fuß wäre eher der Ausdruck ohne eigenes Auto, denn als auf der Straße aufgelesener Wanderer kann der Autor durchaus oftmals in einem Auto mitfahren. Von den sicherlich eher einsamen Tagen der Wanderung liest man weniger, dafür von besonderen Begegnungen und Eindrücken. Teilweise regelrecht poetisch geschildert. Den Ort Hartland, der einst Heartland hieß, entdeckte er in Norddakota. Das Ende der Geschichte der Plainsindiander wird recht ausgiebig erwähnt, hat ja auch was tragisches. Der Autor hat auf seiner Reise vielfältig Begegnungen, aber eigentlich sind diese durchweg freundlich und hilfsbereit, auch wenn manch ein Sheriff ihn erstmal die Beine spreizen lässt, da ein Fußgänger eher ungewöhnlich ist.
Eine etwas andere Reisegeschichte, die sich gut lesen lässt, und wo man durchaus mehr Lust auf Reisegeschichten, und Begegnungen bekommt.
Weniger
Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote