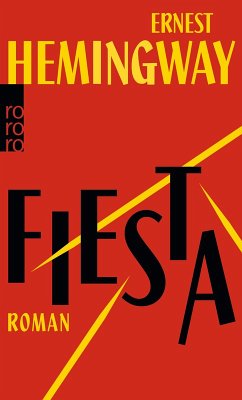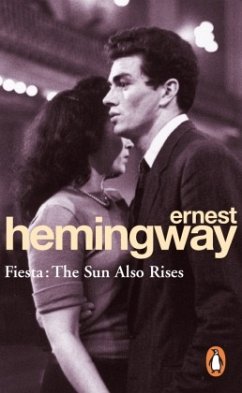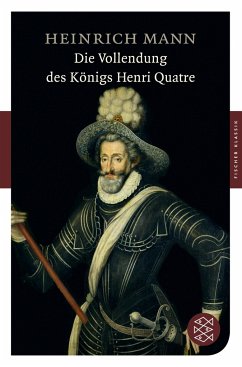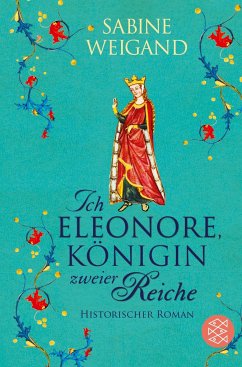Nicht lieferbar
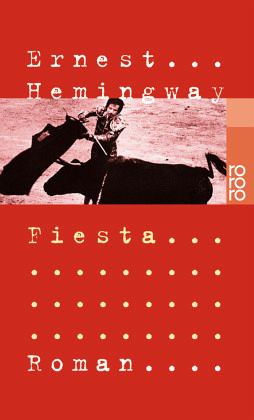





Körperlich verletzt und seelisch verwundet, sucht der amerikanische Journalist Jake Barnes nach einem Lebenssinn. Er streift durch die Bohèmecafés von Montparnasse, reist zur Fiesta von Pamplona - rastlos, zweifelnd, immer im Zwiespalt zwischen Glückssuche und Zynismus. Diesen 1926 in den USA erschienenen Roman widmete Hemingway ausdrücklich der «verlorenen Generation» des Ersten Weltkriegs.
«Fiesta» ist ein Buch über den Krieg, obwohl es nicht vom Krieg handelt, sondern von den beschädigten Existenzen, die das Massensterben auf Europas Schlachtfeldern überlebt haben.
«Fiesta» ist ein Buch über den Krieg, obwohl es nicht vom Krieg handelt, sondern von den beschädigten Existenzen, die das Massensterben auf Europas Schlachtfeldern überlebt haben.
Hemingway, ErnestErnest Hemingway, geboren 1899 in Oak Park, Illinois, gilt als einer der einflussreichsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. In den zwanziger Jahren lebte er als Reporter in Paris, später in Florida und auf Kuba; er nahm auf Seiten der Republikaner am Spanischen Bürgerkrieg teil, war Kriegsberichterstatter im Zweiten Weltkrieg. 1953 erhielt er den Pulitzer-Preis, 1954 den Nobelpreis für Literatur. Hemingway schied nach schwerer Krankheit 1961 freiwillig aus dem Leben.
Horschitz-Horst, AnnemarieAnnemarie Horschitz-Horst wurde 1899 in Berlin geboren. Einen Namen machte sie sich durch ihre Übersetzungen der Werke von Ernest Hemingway - die einzigen Übertragungen ins Deutsche, die vom Autor selbst autorisierten waren. Sie verstarb 1970 in der Nähe von Wien.
Horschitz-Horst, AnnemarieAnnemarie Horschitz-Horst wurde 1899 in Berlin geboren. Einen Namen machte sie sich durch ihre Übersetzungen der Werke von Ernest Hemingway - die einzigen Übertragungen ins Deutsche, die vom Autor selbst autorisierten waren. Sie verstarb 1970 in der Nähe von Wien.

Produktdetails
- rororo Taschenbücher 22603
- Verlag: Rowohlt TB.
- Originaltitel: The Sun Also Rises
- Artikelnr. des Verlages: 18936
- 14. Aufl.
- Seitenzahl: 281
- Erscheinungstermin: November 2009
- Deutsch
- Abmessung: 19mm
- Gewicht: 232g
- ISBN-13: 9783499226038
- ISBN-10: 3499226030
- Artikelnr.: 07862133
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Eine fesselnde, wunderschön absurde, herzzerreißende Erzählung. The New York Times
Broschiertes Buch
Wär schön gewesen
Um «Fiesta» von Ernest Hemingway habe ich jahrzehntelang einen großen Bogen gemacht, denn untrennbar mit diesem ersten, größeren Roman des späteren Nobelpreisträgers verband sich für mich Pamplona und der Stierkampf. Auf …
Mehr
Wär schön gewesen
Um «Fiesta» von Ernest Hemingway habe ich jahrzehntelang einen großen Bogen gemacht, denn untrennbar mit diesem ersten, größeren Roman des späteren Nobelpreisträgers verband sich für mich Pamplona und der Stierkampf. Auf einer Andalusien-Reise vor zwei Jahren erzählte uns ein Reiseleiter während der Busfahrt gedankenverloren so detailliert von der Corrida de Toros, dass ein offensichtlich zartbesaiteter Mitreisender erregt eingeschritten ist und ihn ultimativ aufforderte, sofort diese blutrünstige Schilderung abzubrechen, - das war damals durchaus auch in meinem Sinne. Nach der Lektüre dieses Romans nun muss ich mein diesbezügliches Vorurteil revidieren, Hemingways Schilderung der Fiesta de San Fermin mit den dazugehörigen Stierkämpfen ist überhaupt nicht abstoßend, ja sie hat bei mir sogar ein gewisses Verständnis für die Euphorie der Spanier erzeugt. Insoweit gibt es also wirklich keinen Grund, dieses Buch nicht zu lesen, das vorab!
Hemingway ist ja ein typischer Vertreter der «Lostgeneration», jener durch den Ersten Weltkrieg desillusionierte Gruppe junger Menschen, die in diesem Roman die Protagonisten stellen und deren Ziellosigkeit die eigentliche Thematik der Geschichte bildet. Ich-Erzähler Jake, ein amerikanischer Journalist in Paris, stellt uns zu Beginn Robert vor, ein ehemaliger Box-Champion in Princeton. «Glauben Sie nicht etwa, dass mir so ein Boxtitel imponiert» heißt es dann schon im zweiten Satz, der Autor spricht seinen Leser also direkt an, stellt mit ihm sofort eine gewisse Intimität her. Robert wurde Schriftsteller, und mit Bill gehört noch ein weiterer Schriftsteller zu dem Kreis um Jake. Sie beschließen, zur Fiesta nach Pamplona zu fahren und vorher noch eine Woche lang in den Pyrenäen Forellen zu angeln. Die 34jährige Lady Ashley, ehemalige Krankenschwester, von den Freunden Brett genannt, und Mike, den sie zu heiraten gedenkt, ein Bankrotteur, wie sich später herausstellt, wollen auch nach Pamplona kommen. Brett liebt zwar Jake, sie hatten sich einst im Lazarett kennengelernt, er aber ist durch seine Kriegsverletzung impotent geworden. Darin nun liegt die Tragik dieser lebensgierigen Frau, um die sich im Grunde alles dreht in diesem Roman, sie schätzt nun mal eine robuste Virilität bei ihren Männern.
Der überwiegende Teil des kurzen Romans ist in Dialogform geschrieben, in der für Hemingway typischen, spartanisch knappen Sprache. «In diesem Buch wird viel getrunken. Erst in Paris: Absinth, Champagner, dann in Spanien der funkelnde Fundador. Und es wird auch viel geraucht ... ». Dieses Zitat stammt zwar aus dem Buch, ist aber nicht vom Autor, es ist eine durchaus stimmige, listig in mein historisches Buchexemplar von 1952 eingefügte Zigaretten-Werbung. Und in der Tat, gefühlt ein Drittel des Textes handelt vom Essen, Trinken - oft eher Saufen - und vom Rauchen, was neben Jagen, Fischen, dem Stierkampf und Frauen natürlich die Passionen Hemingways sind. Dass er seinen ihm, dem ausgewiesenen Macho, so ähnlichen Helden nun ausgerechnet impotent sein lässt, verleiht seiner Geschichte eine urkomische Tragik. Und so heißt es denn auch im Schlusssatz melancholisch: «Ach, Jake … wir hätten so glücklich sein können». Der erwidert: «Ja, … wär schön gewesen».
Die Gespräche der Protagonisten sind fast durchweg Geschwafel ohne tieferen Sinn, lebensnah eben in ihrer Banalität. Literarisch erfreulicher fand ich den Ausflug zum Forellenangeln und die wirklich gelungene Beschreibung der Corrida. Die Personen aber bleiben allesamt blass und unkonturiert, ihre Beziehungen zueinander sind oberflächlich, selbst die des Liebespaares. Begeistern konnte mich das alles nicht!
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für