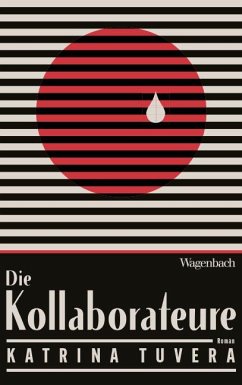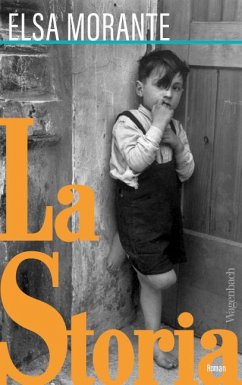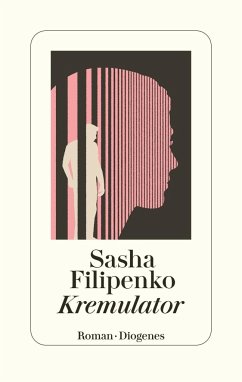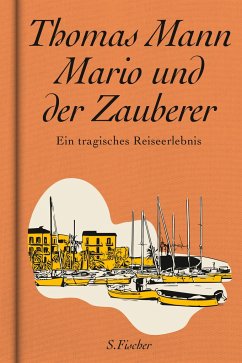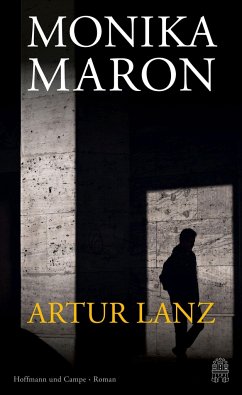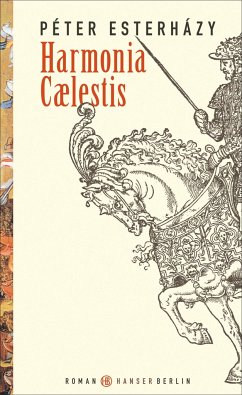Nicht lieferbar

Imre Kertész
Gebundenes Buch
Fiasko
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





Ein Mann um die Fünfzig muß mit dem Fiasko fertigwerden, daß sein Erstlingswerk, der «Roman eines Schicksallosen», vom Verlag abgelehnt wurde. In seinem winzigen Arbeitszimmer eingesperrt, unternimmt er den träumerischen Versuch, einer Begegnung mit seiner Existenz auszuweichen: er erfindet sich einen Helden, dem er die Bürde seiner eigenen Erfahrungen auflädt, und verdammt ihn zur Wiederholung.
Kertész, ImreImre Kertész, 1929 in Budapest geboren, wurde 1944 als 14-Jähriger nach Auschwitz und Buchenwald deportiert. In seinem "Roman eines Schicksallosen" hat er diese Erfahrung auf außergewöhnliche Weise verarbeitet. Das Buch erschien zuerst 1975 in Ungarn, wo er während der sozialistischen Ära jedoch Außenseiter blieb und vor allem von Übersetzungen lebte (u.a. Nietzsche, Hofmannsthal, Schnitzler, Freud, Joseph Roth, Wittgenstein, Canetti). Erst nach der europäischen Wende gelangte er zu weltweitem Ruhm, 2002 erhielt er den Literaturnobelpreis. Seitdem lebte Imre Kertész überwiegend in Berlin und kehrte erst 2012, schwer erkrankt, nach Budapest zurück, wo er 2016 starb.
Produktdetails
- Verlag: Rowohlt, Berlin
- Originaltitel: A kudarc
- Artikelnr. des Verlages: 2296
- 2. Aufl.
- Seitenzahl: 448
- Erscheinungstermin: 10. September 1999
- Deutsch
- Abmessung: 215mm x 128mm x 45mm
- Gewicht: 560g
- ISBN-13: 9783871342127
- ISBN-10: 3871342122
- Artikelnr.: 08226757
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.04.2009
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.04.2009Literatur Fängt ein Roman so an: "Vielleicht sollte ich einen Roman schreiben", dann hat er schon mal schlechte Karten. Wen interessieren die Nöte des Schriftstellers beim Schreiben? "Die Liebe am Nachmittag" von Erno Szép (dtv, jetzt auch als Hörbuch) hat aber überhaupt nichts Selbstreferentielles, ebenso wenig wie "Fiasko" von Imre Kertész, für den Szép ein Idol und Vorbild war. Auch passt der neckische deutsche Titel nicht. Im Original heißt das Buch von 1935 "Ádámcsutka". Ein gewisser Mihály, Theaterschriftsteller und Feuilletonist, bemerkt im schönen Vorkriegsbudapest an sich und anderen sichere Vorzeichen des Verfalls: Wie bei den hageren Endvierzigern die Adamsäpfel wachsen, wie bei den eher Runden die Korsettkontur durchschlägt,
Mehr anzeigen
gefärbte Haare, kaschierte Falten, eine Überdosis Rasierwasser, Diät, Brille, Sport, Goldkrone und dann diese immer jünger werdenden Freundinnen. "Das Gemeinste ist, dass Herren und auch Damen einem sagen: Prächtig schaust du aus oder Wie gut Sie doch aussehen. Dem jungen Menschen sagt keiner, dass er gut aussieht. Junge, sagt man, miserabel schaust du aus, Freund! Bist wohl ein Nachtschwärmer, die Lumperei und all die Weibergeschichten, du Lüstling! Auch ich gewöhne mir an, zu den fetten, angeschimmelten Visagen zu sagen: Gut sieht er aus, der gnädige Herr." Mihály lebt noch in einer Welt, in der junge Mädchen "Backfisch" genannt werden dürfen und auf Kaffeehaustischen ihr "Retikül" abstellen. Diese Welt ist dem Untergang geweiht, und sie weiß es. Eigentlich also eine Tragödie, aber leicht und frech geschrieben. Eine auf ironischer Spitze getanzte Ballade, ein Gutenachtlied auf Alt-Kakanien in 43 Strophen. Nach "Ádámcsutka" schrieb Szép dann nur noch seinen Bericht aus dem Arbeitslager "Drei Wochen in 1944", den gibt es zurzeit immerhin auf Englisch: "The Smell of Humans". Jetzt warten wir also auf die deutsche Übersetzung. Im schwedischen Exil sprach Szép von sich selbst nur noch in der Vergangenheit.
eeb
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
eeb
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
In einer langen, sehr schwer zu lesenden Rezension, erläutert FAZ-Autor Eberhard Rathgeb die intellektuelle Figur der Wiederholung, die seiner Meinung nach den Roman von Kertész kennzeichnet. Die "Stimmung des Ernstes" kann man nur ein einziges Mal zeigen, behauptet Rathgeb, und das habe Kertész mit seinem ersten "Roman eines Schicksallosen" getan. Deshalb bleibe dem Autor nur noch "der Stachel der Wiederholung, die Reflexion". Rathgeb denkt ausführlich über die Gründe nach, warum Kertész seinen Roman so und nicht anders geschrieben hat. Darüber scheint er alles zu wissen. Da der Rezensent sich so intensiv mit dem Buch auseinandersetzt, scheint er es zumindest äußerst eindrucksvoll zu finden. Ganz sicher kann man da aber nicht sein. Er kennzeichnet Kertész als einen "zutiefst verzweifelten Menschen". Da verbietet sich für ihn vielleicht die Vergabe einer Art Gütesiegel.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Broschiertes Buch
Vom Fiasko der Matroschka-Romane
Der Autor Imre Kertész gehört nach eigenem Bekunden nicht zur nationalen ungarischen Literatur, er sehe sich vielmehr in einer Reihe mit Paul Celan und Franz Kafka. Seine Befürchtung, dass er «ein ewig verkannter und missverstandener Autor …
Mehr
Vom Fiasko der Matroschka-Romane
Der Autor Imre Kertész gehört nach eigenem Bekunden nicht zur nationalen ungarischen Literatur, er sehe sich vielmehr in einer Reihe mit Paul Celan und Franz Kafka. Seine Befürchtung, dass er «ein ewig verkannter und missverstandener Autor bleibe» wurde durch das Nobelkomitee widerlegt, welches ihn 2002 ehrte und zur Begründung anmerkte: «Sein Werk behauptet die zerbrechliche Erfahrung des Einzelnen gegenüber der barbarischen Willkür der Geschichte». Kertész wurde 1944 als Fünfzehnjähriger nach Auschwitz deportiert und gelangte von dort nach Buchenwald, wo er bei Kriegsende befreit wurde. Diese einjährige traumatische KZ-Erfahrung ist prägend für sein gesamtes, stark autobiografisch inspiriertes Werk, hinzu kommen noch die Jahrzehnte der ebenfalls albtraumartigen Zeit während des kommunistischen Regimes in Ungarn. Sein Roman «Fiasko» ist Teil der «Tetralogie der Schicksallosigkeit», der Autor verarbeitet hierin seine Erfahrungen als Schriftsteller in einem autoritären Staatssystem.
In einer eigenwilligen, nebensatzreichen Sprache, ergänzt durch kaskadenartig in Klammer gesetzte, zahlreiche Hinzufügungen und Wiederholungen wird uns «der Alte» vorgestellt, ein erfolgloser Schriftsteller, der in armseligsten Verhältnissen lebt und dessen KZ-Roman über einen jüdischen Jungen im Vernichtungslager (sic!) vom Verlag abgelehnt wurde. Er ist zu journalistischer Gelegenheitsarbeit und zu Übersetzungen genötigt, nimmt jedoch immer wieder seinen Ordner «Ideen, Skizzen, Fragmente» zur Hand, ohne aber tatsächlich einen neuen Stoff zu entwickeln. Die Perspektive wechselt in diesem ersten Teil des Buches häufig zwischen auktorialer und personaler Erzählsituation, was Kertész hier neben seiner ungewöhnlichen Syntax bewusst als Stilmittel einsetzt. Eines Tages aber spannt der Alte plötzlich einen Bogen in seine Schreibmaschine und tippt in Grossbuchstaben «FIASKO» in die Mitte der ersten Zeile.
Im zweiten, größeren und nun ganz konventionell erzählten Teil lesen wir genau diesen Roman. Er handelt von einem Schriftsteller namens Steinig, der in die kafkaesken Welt eines nicht benannten Staates hineingerät und dort Wundersames, Willkürliches und kaum Erklärliches erlebt, ohne recht zu wissen, welche Mächte da am Werke sind. Sein Leben nimmt beruflich und privat immer wieder völlig überraschende Wendungen, und zwischendurch findet er sogar Zeit, einen Roman zu schreiben, der aber abgelehnt wird. Er lernt immer mehr Menschen kennen, sein beliebtester Treffpunkt ist ein Lokal namens «Südsee». Dort verkehrt auch Berg, ein geheimnisvoller Mann, der ebenfalls schreibt und ihm eines Tages nach langem Zureden aus seinem Manuskript mit dem Titel «Ich, der Henker» vorliest, worauf sich eine kontroverse Diskussion anschließt. Am Ende schließlich erfährt Steinig, dass sein Roman doch gedruckt wird. Der Alte aber, der all das geschrieben hat, ist skeptischer als seine Romanfigur: «Seine Person hat er zu einem Gegenstand gemacht, sein hartnäckiges Geheimnis ins Allgemeine verwässert, seine unaussprechliche Wirklichkeit zu Zeichen destilliert», sein einzig mögliches Buch würde nun «das Massenschicksal der anderen Bücher» teilen.
Es ist keine leichte Kost, die da auf ihren Leser wartet. Kertész hat kunstvoll nach Art russischer Matroschka-Puppen drei Romane ineinander verschachtelt und dabei ein unbequemes Thema aufgearbeitet. Er durchleuchtet die Düsternis der menschlichen Seele in unglaublich vielen, tiefsinnigen Gedankengängen. Wer sich die Zeit nimmt und seinen Reflexionen willig folgt, den dürfte diese Lektüre ungemein bereichern.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für