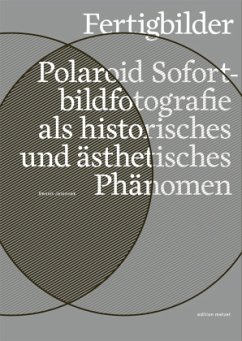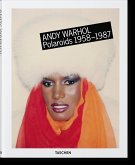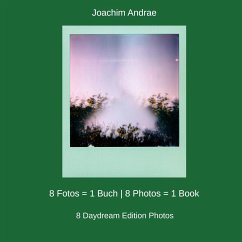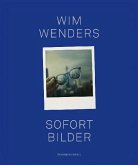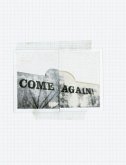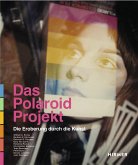Die Sofortbildfotografietechnik des US-amerikanischen Her¬stellers Polaroid verbreitete sich seit ihrer Vorstellung 1947 / Markteinführung 1948 in mehr als fünf Jahrzehnten weltweit und erregte mit zahlreichen technischen Innovationen immer wieder Aufsehen - eine ihrer Popularität entsprechende Beachtung durch die Kunst- und Fotografiegeschichte wurde dieser "one-step photography" bislang jedoch nicht zuteil.Der Autor nähert sich dem Polaroid unter ästhetischen, wissenschaftshistorischen, sozialen und ökonomischen Gesichtspunkten und konzentriert sich zunächst auf die Analyse der technischen Entwicklung, des konkreten Gebrauchs und der medienkritischen Rezeption. Er nimmt eine theoretische und mediale Einordnung des Polaroid-Verfahrens im Kontext der Fotografie-, Wissenschafts- und Design¬geschichte im Laufe des 20. und 21. Jahrhunderts vor. Schließlich untersucht er das Sofortbild anhand exem¬plarischer Arbeiten von Robert Heinecken, Andy Warhol, Marcel Duchamp und Cyprien Gaillard. In dieser umfassenden Zusammenschau wird die kulturgeschichtliche und ästhetische Dimension des Phänomens Polaroid und deren Verbindung mit wissenschaftshistorischen und ökonomischen Aspekten in ihrer Komplexität erstmals greifbar.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Der hier rezensierende Literaturwissenschaftler Bernd Stiegler kann es kaum glauben, dass bisher noch keine Monografie zum Polaroid erschienen war. Glücklicherweise liegt nun dieses Buch des Kunsthistorikers Dennis Jelonnek vor, freut sich der Kritiker, der hier "kenntnisreich" durch die Geschichte der Fertigbilder geführt wird. Stiegler liest nicht nur, wie geschickt Edwin Land, der Erfinder des Polaroids, die neue Technik als "magisches Bild" vermarktete, sondern staunt auch über Jelonneks "filigrane" Einführung in die technischen Aspekte. Von der Verwendung in der Kunst bei Andy Warhol, Robert Heinecken und Marcel Duchamp liest der Kritiker hier ebenso, wie er vom Gebrauch als Massenmedium erfährt. Dass die typografische Gestaltung den Lesefluss mitunter beeinträchtigt, geht für den Rezensenten angesichts des "anregenden" Textes in Ordnung.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Als Bilder für jedermann schon fast sofort verfügbar wurden: Dennis Jelonnek macht kenntnisreich mit Technik, Vermarktung und Geschichte der Polaroidfotografie bekannt.
Andy Warhol hat es getan. Nobuyoshi Araki, Cy Twombly und Richard Hamilton haben es getan. Und auch Sie haben es vielleicht getan - wenn Sie alt oder jung genug sind: Polaroids angefertigt. Angesichts der Begeisterung für dieses Medium, das über ein halbes Jahrhundert hinweg Alltagskultur und Kunst geprägt hat, ist es überraschend, dass erst jetzt eine Monographie über seine Facetten erschienen ist. Zu ihnen gehört auch die Haltbarkeit, oder besser, unterstellte Vergänglichkeit der Sofortbilder, denen Dennis Jelonnek das letzte Kapitel seiner anregenden, aufgrund der typographischen Gestaltung allerdings schwer lesbaren Studie gewidmet hat. Um die oft gestellte Frage nach dem Verblassen gleich zu beantworten: Es kommt auf die Art des Films und die Lagerung an.
Filigran erläutert Jelonnek hier wie auch in weiteren Abschnitten die technischen Aspekte des Verfahrens, das 1947 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Im Mittelpunkt stehen jedoch andere Fragen. Neben dem Gebrauch der Aufnahmen schildert der Autor die historischen Kontexte, welche Edwin Land, der Erfinder des Polaroids, aufruft, um sich und seine neuen Bilder ins rechte Licht zu rücken. Sodann stellt er in Fallstudien zu Robert Heinecken, Andy Warhol und Marcel Duchamp drei künstlerische Auseinandersetzungen mit diesem Medium vor.
Wie so oft erfindet sich die Fotografie auch hier ein weiteres Mal neu. In seinen Texten gemahnt Edwin Land an den Erfinder der Fotografie, William Henry Fox Talbot, um die Einführung des Polaroids als neuerliche Urszene präsentieren zu können. Die Fotografie wird als eine Art magisches Bild vorgestellt. Land setzt die "konsequente Selbsttätigkeit des fotografischen Bildes", dessen Entwicklung der Apparat übernimmt, als technisches Wunder in Schauexperimenten in Szene. Auch die doppelte Verwendung der Fotografie als "Kunst und Wissenschaft", die bereits ihre Anfänge kennzeichnete, gibt er als Programm aus. Dementsprechend stellt Land die Vorstellung seines Verfahrens in eine Reihe mit dem Urvater der effektsicheren Präsentation technischer Errungenschaften: Michael Faraday.
Mit Talbot und Faraday sind zwei der Wahlverwandten Lands bereits benannt. Ungleich bemerkenswerter sind hingegen zwei weitere, die in Bildern und Texten erkenntlich werden. Einer ist Vannevar Bush, der aufgrund seines 1945 veröffentlichten Texts "As We May Think" als Vordenker des Personal Computer gilt. Seine Idee einer unmittelbar verfügbaren Fotografie, die für den Memex-Computer vorgesehen war, setzte Land mit seinen Polaroids in die Tat um. Bush zitiert mit dem Titel seines Aufsatzes John Deweys Essay "How We Think" und liefert damit den weiteren Bezugsraum, in dem sich Land verortet.
Seine in diversen Werbekampagnen beschworene "Polaroid Experience" ist, wie Jelonnek rekonstruiert, eine besondere Auslegung von Deweys pragmatistischer ästhetischer Theorie, die er in "Kunst als Erfahrung" ausformuliert. Die Erfindung des Sofortbildverfahrens, das "jedermann ein Erzeugen und Interagieren mit fotografischen Bildern ermöglichte", verstand sich vor allem als eine Form der Durchdringung des Ich mit der Welt der Dinge und Ereignisse, als eine das Leben bereichernde Technik. Es sollte technisch und massenmedial neue Sichtweisen eröffnen. Fotografie wurde dabei als ein Bildmedium der Partizipation vorgestellt, das auf visuelle Erfahrungen setzte.
Dass die Werbung für die neue Erfindung sexistische Stereotype einsetzte, verdeutlicht, dass wir es auch mit einem kommerziellen Massenmedium zu tun haben, bei dem demokratisch-partizipative Ideale mit der Alltagspraxis und auch den technischen Gegebenheiten in Konflikt geraten.
Die Sofortbildfotografie reduziert die Eingriffsmöglichkeit des Menschen auf den Apparat um ein weiteres Moment. Bereits am Ende des neunzehnten Jahrhunderts hatte die Firma Eastman Kodak die Entwicklung und die Abzüge, welche vorher noch in den Händen des Fotografen lagen, an ein Labor delegiert. Aus dem Slogan "You Press the Button! We Do the Rest!" der Kodak wurde nun "Snap it! See it!" der Polaroid: Der fotografische Akt beschränkte sich auf den Moment des Betätigens des Auslösers, der noch dazu oft durch Programme der Kamera vorgegeben wurde. Dann kamen sechzig magische Sekunden bis das Bild erschien. Dieser automatisierte Kontrollverlust produzierte nicht nur eine neue Form zeitversetzter Unmittelbarkeit, sondern auch Korrekturmöglichkeiten, die für uns heute in Zeiten der digitalen Bilder alltäglich geworden sind. Damals musste man erstmals nicht länger auf die Ergebnisse des Fotolabors warten, sondern konnte gleich zum nächsten Bild schreiten, wenn man mit dem ersten nicht zufrieden war.
Mit Aufkommen der digitalen Bilder war auch die Zeit der Polaroids erst einmal vorüber: Die Firma musste Anfang des Jahrhunderts Konkurs anmelden. Dass Sofortaufnahmen jüngst als Retroformen imperfekter Bilder wiederentdeckt wurden, ist nicht mehr Gegenstand von Jelonneks Studie, die kenntnisreich, wenn auch ein wenig mäandernd durch die Geschichte dieser besonderen Art der Fotografie führt.
BERND STIEGLER
Dennis Jelonnek: "Fertigbilder". Polaroid Sofortbildfotografie als historisches und ästhetisches Phänomen.
Edition Metzel, München 2020. 304 S., Abb., geb., 28,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main