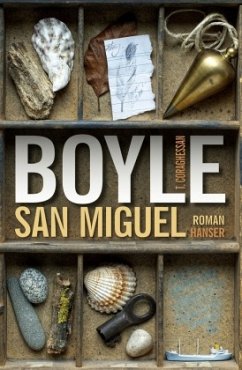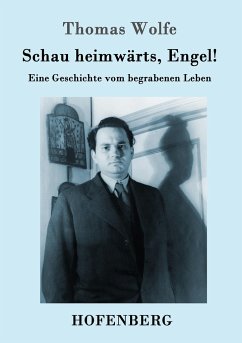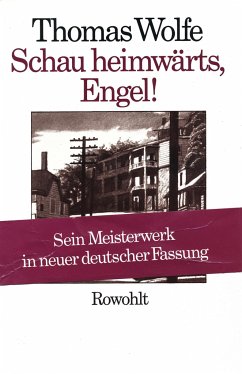Nicht lieferbar
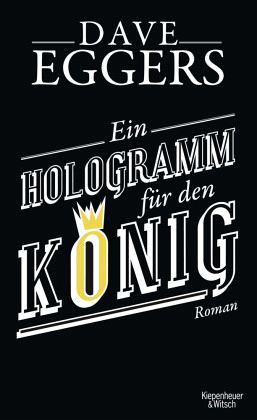
Ein Hologramm für den König
Roman
Übersetzung: Timmermann, Klaus; Wasel, Ulrike
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Dem US-Schriftsteller Dave Eggers ist mit seinem neuen Roman „Ein Hologramm für den König“ eine komische und berührende Parabel auf die Wirkungsmächte der Global Economy gelungen. Eggers’ sechstes Buch erzählt die Geschichte einer letzten Hoffnung so eindrücklich, dass uns Lesern wieder klar wird, warum man der Literatur die Gabe zusagt, dass sie besonders gut die Welt erklären könne.Die Hoffnung des Alan Clay – sie liegt im Nichts, in der Wüste, unweit der saudi-arabischen Stadt Jeddah. Dort lässt der saudische König Abdullah mit seinen Ölmilliarden eine neue Stadt erricht...
Dem US-Schriftsteller Dave Eggers ist mit seinem neuen Roman „Ein Hologramm für den König“ eine komische und berührende Parabel auf die Wirkungsmächte der Global Economy gelungen. Eggers’ sechstes Buch erzählt die Geschichte einer letzten Hoffnung so eindrücklich, dass uns Lesern wieder klar wird, warum man der Literatur die Gabe zusagt, dass sie besonders gut die Welt erklären könne.
Die Hoffnung des Alan Clay – sie liegt im Nichts, in der Wüste, unweit der saudi-arabischen Stadt Jeddah. Dort lässt der saudische König Abdullah mit seinen Ölmilliarden eine neue Stadt errichten – die King Abdullah Economic City (KACE). Der US-Autor Dave Eggers hat diesen Ort zum Zentrum seines neuen Romans „Ein Hologramm für den König“ (KIWI) gemacht. Das Bauprojekt mag als Sinnbild dafür stehen, was man alles vermag, wenn man unerschöpflich viel Geld hat – und so selbst einen so unwirtlichen Ort wie die Wüste beleben kann. So ein Ort ist auch eine künstlich erschaffene Welt, eine Illusion. Und das macht Eggers gleich zu Anfang deutlich, als Clay mit seinem Taxi das Tor zu dieser Stadt erreicht. „Es sah aus, als hätte jemand eine Straße durch unnachgiebige Wüste gebaut und dann irgendwo in der Mitte ein Tor errichtet, um das Ende von etwas und den Beginn von etwas anderem anzudeuten. Es war hoffnungsvoll, aber nicht überzeugend.“
Clay soll für die US-Firma „Reliant Systems“ einen Megadeal an Land ziehen. Sein Auftraggeber will für die IT-Infrastruktur in der neuen Wüstenstadt sorgen. Mit seinem Team will Clay dem König ein High-End-Hologramm vorspielen, über das ein Londoner Kollege als 3-D-Geist im Königszelt erscheint und die IT-Pläne des Konzerns vorstellt. Für Clay ist der Deal wohl die letzte Chance, seinem Leben noch eine positive Wendung zu geben. Er ist ein gebrochener Mann, über 50, er trinkt zu viel, schaut sich wehmütig alte Baseballspiele an, ist geschieden, hat mehr als 100.000 Dollar Schulden. Mit dem Honorar könnte er die begleichen und seiner Tochter eine gute Highschool-Ausbildung ermöglichen. Eggers’ Held hat vor seiner Zeit als selbstständiger Berater bei den Fahrradmachern von Schwinn in Chicago gearbeitet. Dort montierte er anfangs Räder und zum Schluss war er im Zuge der Globalisierung für die Verlegung der Produktion in Länder wie China verantwortlich – und damit rationalisierte er sich quasi gleich mit weg. Nun träumt Clay davon, wieder eine kleine Fahrradfabrik aufzubauen. Es ist die vage Hoffnung eines Mannes, dessen Zeit abgelaufen scheint und in der sich auch die Situation der globalisierten US-Wirtschaft widerspiegelt. Ein Mann, den Clay im Flugzeug trifft, sagt: „Wir sind eine Nation von Stubenhockern geworden ... Eine Nation von Zweiflern, Bedenkenträgern, Grüblern. Gott sei Dank waren die Amerikaner, die dieses Land besiedelt haben, nicht so. Die hatten ein ganz anderes Format!“
Das Buch ist Eggers’ zweiter Roman, der nicht auf echten Lebensgeschichten wie etwa in seinem Debüt, in „Weit gegangen“ (2006) oder in „Zeitoun“ (2009) aufbaut, sondern aus der Welt des Fiktiven kommt, die uns aber die Wirklichkeit messerscharf und luzide erklärt – wie es nur gute Literatur kann. Denn das Buch erzählt davon, wie Clay Tag für Tag in die Wüste hinausfährt – in der Hoffnung, den König zu treffen. Aber der lässt sich nicht blicken. Stattdessen lässt Eggers Clay absurde Episoden erleben, die seltsame Schwerelosigkeit im saudi-arabischen Wohlstand durchfliegen, sich in Erinnerungen und vor allem in Hoffnung wälzen. „Er konnte es! Er musste glauben, dass er es konnte. Natürlich konnte er es.“ In diesem enervierenden Warten auf den Tag der vermeintlichen Erlösung erkennt der Leser natürlich Samuel Becketts „Warten auf Godot“. Eggers versteht es, Clays emotionales Absurdistan sprachlich überzeugend auszubauen. Denn er hat die aufgekratzte Sprache seiner ersten Bücher hinter sich gelassen. Diesmal schreibt er mit einer klaren Hemingwayschen Sprache, in deren kurzen Sätzen man die Leere der Wüste einerseits und die Seelenmüdigkeit und Hoffnungslosigkeit von Menschen wie Clay andererseits besonders gut nachspüren kann.
Eggers wäre natürlich nicht Eggers, wenn er den Leser geradewegs in ein schwarzes Loch schicken würde. Schließlich ist er auch ein Optimist, was sich zum Beispiel im Titel seiner Zeitschrift „The Believer“ ausdrückt. Allerdings ist Eggers auch ein sehr verschlagener Optimist, der um die Fallen der Realität weiß. Die Geschichte endet also mit einer Episode, die zumindest ein ganz klein wenig Hoffnung erwachsen lässt.
Die Hoffnung des Alan Clay – sie liegt im Nichts, in der Wüste, unweit der saudi-arabischen Stadt Jeddah. Dort lässt der saudische König Abdullah mit seinen Ölmilliarden eine neue Stadt errichten – die King Abdullah Economic City (KACE). Der US-Autor Dave Eggers hat diesen Ort zum Zentrum seines neuen Romans „Ein Hologramm für den König“ (KIWI) gemacht. Das Bauprojekt mag als Sinnbild dafür stehen, was man alles vermag, wenn man unerschöpflich viel Geld hat – und so selbst einen so unwirtlichen Ort wie die Wüste beleben kann. So ein Ort ist auch eine künstlich erschaffene Welt, eine Illusion. Und das macht Eggers gleich zu Anfang deutlich, als Clay mit seinem Taxi das Tor zu dieser Stadt erreicht. „Es sah aus, als hätte jemand eine Straße durch unnachgiebige Wüste gebaut und dann irgendwo in der Mitte ein Tor errichtet, um das Ende von etwas und den Beginn von etwas anderem anzudeuten. Es war hoffnungsvoll, aber nicht überzeugend.“
Clay soll für die US-Firma „Reliant Systems“ einen Megadeal an Land ziehen. Sein Auftraggeber will für die IT-Infrastruktur in der neuen Wüstenstadt sorgen. Mit seinem Team will Clay dem König ein High-End-Hologramm vorspielen, über das ein Londoner Kollege als 3-D-Geist im Königszelt erscheint und die IT-Pläne des Konzerns vorstellt. Für Clay ist der Deal wohl die letzte Chance, seinem Leben noch eine positive Wendung zu geben. Er ist ein gebrochener Mann, über 50, er trinkt zu viel, schaut sich wehmütig alte Baseballspiele an, ist geschieden, hat mehr als 100.000 Dollar Schulden. Mit dem Honorar könnte er die begleichen und seiner Tochter eine gute Highschool-Ausbildung ermöglichen. Eggers’ Held hat vor seiner Zeit als selbstständiger Berater bei den Fahrradmachern von Schwinn in Chicago gearbeitet. Dort montierte er anfangs Räder und zum Schluss war er im Zuge der Globalisierung für die Verlegung der Produktion in Länder wie China verantwortlich – und damit rationalisierte er sich quasi gleich mit weg. Nun träumt Clay davon, wieder eine kleine Fahrradfabrik aufzubauen. Es ist die vage Hoffnung eines Mannes, dessen Zeit abgelaufen scheint und in der sich auch die Situation der globalisierten US-Wirtschaft widerspiegelt. Ein Mann, den Clay im Flugzeug trifft, sagt: „Wir sind eine Nation von Stubenhockern geworden ... Eine Nation von Zweiflern, Bedenkenträgern, Grüblern. Gott sei Dank waren die Amerikaner, die dieses Land besiedelt haben, nicht so. Die hatten ein ganz anderes Format!“
Das Buch ist Eggers’ zweiter Roman, der nicht auf echten Lebensgeschichten wie etwa in seinem Debüt, in „Weit gegangen“ (2006) oder in „Zeitoun“ (2009) aufbaut, sondern aus der Welt des Fiktiven kommt, die uns aber die Wirklichkeit messerscharf und luzide erklärt – wie es nur gute Literatur kann. Denn das Buch erzählt davon, wie Clay Tag für Tag in die Wüste hinausfährt – in der Hoffnung, den König zu treffen. Aber der lässt sich nicht blicken. Stattdessen lässt Eggers Clay absurde Episoden erleben, die seltsame Schwerelosigkeit im saudi-arabischen Wohlstand durchfliegen, sich in Erinnerungen und vor allem in Hoffnung wälzen. „Er konnte es! Er musste glauben, dass er es konnte. Natürlich konnte er es.“ In diesem enervierenden Warten auf den Tag der vermeintlichen Erlösung erkennt der Leser natürlich Samuel Becketts „Warten auf Godot“. Eggers versteht es, Clays emotionales Absurdistan sprachlich überzeugend auszubauen. Denn er hat die aufgekratzte Sprache seiner ersten Bücher hinter sich gelassen. Diesmal schreibt er mit einer klaren Hemingwayschen Sprache, in deren kurzen Sätzen man die Leere der Wüste einerseits und die Seelenmüdigkeit und Hoffnungslosigkeit von Menschen wie Clay andererseits besonders gut nachspüren kann.
Eggers wäre natürlich nicht Eggers, wenn er den Leser geradewegs in ein schwarzes Loch schicken würde. Schließlich ist er auch ein Optimist, was sich zum Beispiel im Titel seiner Zeitschrift „The Believer“ ausdrückt. Allerdings ist Eggers auch ein sehr verschlagener Optimist, der um die Fallen der Realität weiß. Die Geschichte endet also mit einer Episode, die zumindest ein ganz klein wenig Hoffnung erwachsen lässt.



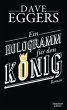

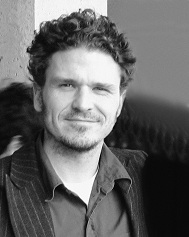
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.03.2013
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.03.2013