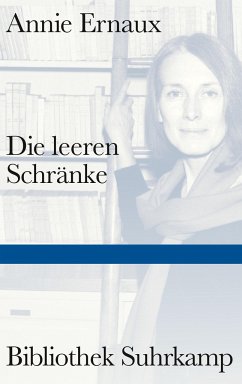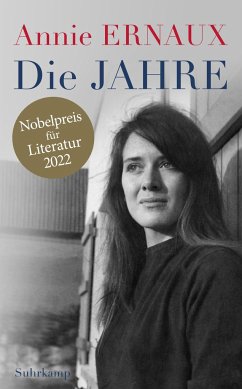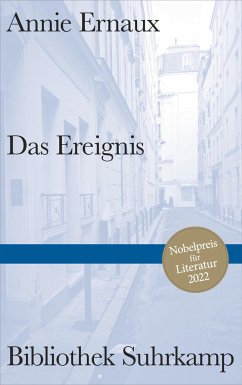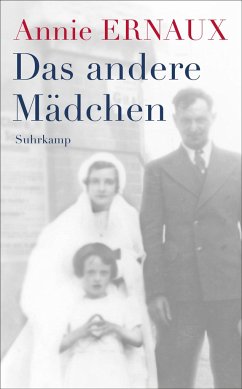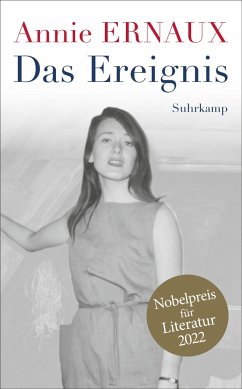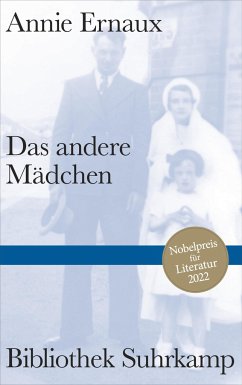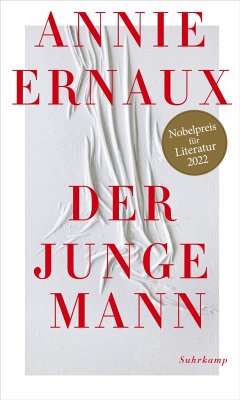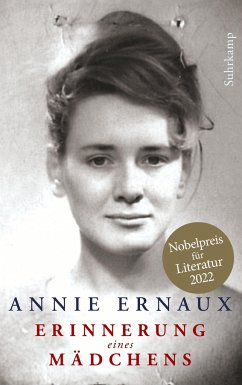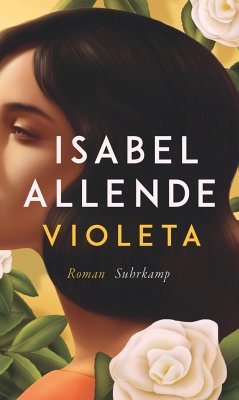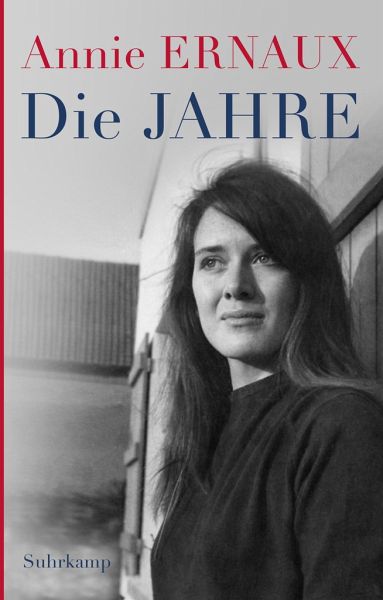
Die Jahre
Geschenkausgabe Nobelpreis für Literatur 2022
Übersetzung: Finck, Sonja
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
13,00 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Geschichte ihrer selbst, Gesellschaftsporträt, universelle Chronik: Annie Ernaux' aufsehenerregendes Werk wirkt von Beginn an weit über die französischen Grenzen hinaus. Eine faszinierende Einladung, das eigene Leben zu hinterfragen.Kindheit in der Nachkriegszeit, Algerienkrise, die Karriere an der Universität, das Schreiben, eine prekäre Ehe, die Mutterschaft, das Jahr 1968, Krankheiten und Verluste, die sogenannte Emanzipation der Frau, Frankreich unter Mitterrand, die Folgen der Globalisierung, das eigene Altern. Anhand von Fotografien, Erinnerungen und Aufzeichnungen, von Wörtern, Me...
Geschichte ihrer selbst, Gesellschaftsporträt, universelle Chronik: Annie Ernaux' aufsehenerregendes Werk wirkt von Beginn an weit über die französischen Grenzen hinaus. Eine faszinierende Einladung, das eigene Leben zu hinterfragen.
Kindheit in der Nachkriegszeit, Algerienkrise, die Karriere an der Universität, das Schreiben, eine prekäre Ehe, die Mutterschaft, das Jahr 1968, Krankheiten und Verluste, die sogenannte Emanzipation der Frau, Frankreich unter Mitterrand, die Folgen der Globalisierung, das eigene Altern. Anhand von Fotografien, Erinnerungen und Aufzeichnungen, von Wörtern, Melodien und Gegenständen vergegenwärtigt Annie Ernaux die Jahre, die vergangen sind und betrachtet auf faszinierende Weise ihr Leben - unser Leben, das Leben.
Kindheit in der Nachkriegszeit, Algerienkrise, die Karriere an der Universität, das Schreiben, eine prekäre Ehe, die Mutterschaft, das Jahr 1968, Krankheiten und Verluste, die sogenannte Emanzipation der Frau, Frankreich unter Mitterrand, die Folgen der Globalisierung, das eigene Altern. Anhand von Fotografien, Erinnerungen und Aufzeichnungen, von Wörtern, Melodien und Gegenständen vergegenwärtigt Annie Ernaux die Jahre, die vergangen sind und betrachtet auf faszinierende Weise ihr Leben - unser Leben, das Leben.