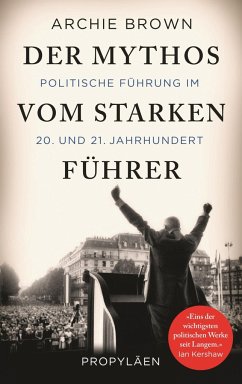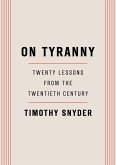»In den letzten Jahren wurden die großen Demokratien von inneren Konflikten erschüttert und mit schwerwiegenden äußeren Herausforderungen konfrontiert. In solchen Zeiten wirkt die Vorstellung verlockend, man müsse nur den richtigen politischen Führer finden, eine heroische Figur, die alle Probleme resolut in Angriff nehmen wird.«
In seinem epochalen Werk beleuchtet Archie Brown die Erfolge und Misserfolge der größten Demokraten und Diktatoren der vergangenen hundert Jahre und zeigt: Wenn wir einem einzelnen Menschen erlauben, viel Macht anzuhäufen, ebnen wir den Weg für gravierende Fehler und im schlimmsten Fall für katastrophales Blutvergießen. Von Hitler und Stalin über Trump, Putin und Erdogan bis hin zu Brandt, Mandela und Gorbatschow untersucht Brown verschiedene Führungsstile und stellt weitverbreitete Annahmen über politische Wirksamkeit und Stärke in Frage. Anhand zahlreicher Beispiele belegt er, dass das Modell einer kollektiven Führerschaft viel effektiver ist als die Stärke eines Einzelnen. Eine scharfsichtige Lektüre, aus der wir viel für unsere Gegenwart lernen können.
In seinem epochalen Werk beleuchtet Archie Brown die Erfolge und Misserfolge der größten Demokraten und Diktatoren der vergangenen hundert Jahre und zeigt: Wenn wir einem einzelnen Menschen erlauben, viel Macht anzuhäufen, ebnen wir den Weg für gravierende Fehler und im schlimmsten Fall für katastrophales Blutvergießen. Von Hitler und Stalin über Trump, Putin und Erdogan bis hin zu Brandt, Mandela und Gorbatschow untersucht Brown verschiedene Führungsstile und stellt weitverbreitete Annahmen über politische Wirksamkeit und Stärke in Frage. Anhand zahlreicher Beispiele belegt er, dass das Modell einer kollektiven Führerschaft viel effektiver ist als die Stärke eines Einzelnen. Eine scharfsichtige Lektüre, aus der wir viel für unsere Gegenwart lernen können.

Archie Browns politische Kulturgeschichte
Wer zu viele Autobiografien von Politikerinnen und Politikern liest oder Wahlkampfbücher Romanen vorzieht, bekommt leicht den Eindruck, am Ende komme es immer auf eine starke Führungsfigur an – höchstens noch auf ein paar Berater. Dieser Tage aber genügt es vermutlich, sich einfach in der Welt umzuschauen: Die Sehnsucht nach mächtigen Anführern ist weit verbreitet, und in vielen Ländern sind stark anmutende Politiker an der Macht. Der britische Politologe und Historiker Archie Brown, der lange in Oxford lehrte, will mit seinem 2014 erschienenen Buch, das nun um ein Vorwort ergänzt auf Deutsch vorliegt, den Mythos des starken politischen Führers erschüttern.
Er stellt die Idee der politischen Führung zwar nicht an sich infrage, aber hält die „Stark-schwach-Dichotomie“ für problematisch, ja sogar gefährlich. Dominantes Verhalten solle nicht das entscheidende Kriterium sein, wenn es darum geht, eine Regierungszeit zu bewerten. „Stärke ist bewundernswert, Schwäche weckt Bedauern.“ Diese banale Formel sei hier wenig sinnvoll. Überhaupt werde in demokratischen Staaten, wenn sich alle über die Wahlergebnisse beugten, oft das Gewicht der Spitzenkandidaten überschätzt. Viel besser laufe es, wenn ein Politiker seine Regierung als kollektive Führung denke, wenn delegiert und kooperiert werde.
Neben einem allgemeinen Teil, in dem es Archie Brown um die Herausbildung und Entwicklung der demokratischen Führung geht, bildet eine Typologie den eigentlichen Kern des Buches. Brown nimmt sich ein paar ausgewählte Formen der Machtausübungen genauer vor: neudefinierende, transformative, revolutionäre, autoritäre und totalitäre Führung.
Als Beispiele für neudefinierende Führung, die die Grenzen des politisch Möglichen verschiebe, führt er etwa Franklin D. Roosevelt mit seinem New Deal, Lyndon B. Johnson, der den Civil Rights Act unterzeichnete, und Margaret Thatcher ins Feld, weil sie die politischen Spielregeln in Großbritannien neu bestimmt habe. Die transformative Führung hingegen verändere das politische und ökonomische System eines Landes fundamental. Charles de Gaulle, Adolfo Suárez, der erste spanische Ministerpräsident nach Franco, Michail Gorbatschow, Deng Xiaoping oder Nelson Mandela fallen in diese Kategorie, Politiker also, die an der Schwelle zu einer neuen Ordnung regierten. Von der chinesischen über die russischen Revolutionen gelangt Brown, der lange zur Geschichte des Kommunismus geforscht hat, schließlich zum Arabischen Frühling, er schildert Umwälzungen, die mit oder ohne Führung abliefen. Zuletzt kommen Stalin, Mao Zedong, Mussolini und Hitler an die Reihe, also autoritäre oder totalitäre Führer.
Der Politiker, der Browns Vorstellung von einer guten – in diesem Fall einer neudefinierenden – Regierung am nächsten kommt, ist Clement Attlee, was in Wahrheit natürlich bedeutet: dessen Regierung war Brown die liebste. Attlee amtierte von Juli 1945 bis 1951 als Premierminister, nachdem Labour bei den Unterhauswahlen überraschend die absolute Mehrheit errungen hatte. Vor ihm und nach ihm führte Churchill die Regierung. Attlee sei nicht nur bescheiden und loyal gewesen, sondern habe die Gruppe zusammengehalten und jeden seiner Minister in die Lage versetzt, seine Aufgaben zu erfüllen. In dieser Zeit verstaatlichte die Labour-Regierung die Bank of England, die Eisenbahnen, die Strom- und Gasversorgung, die zivile Luftfahrt, die Kohlegruben und die Stahlindustrie. Die Unterstützung für Kranke und Arbeitslose wurde ausgebaut und eine egalitäre Umverteilungspolitik betrieben. An den Marktradikalimus von Thatcher, die später innerhalb eines Jahrzehnts zwei Drittel des britischen Staatseigentums wieder verkaufen sollte, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu denken.
Noch schlechter als Thatcher, die wohl am liebsten ganz auf ihre Minister verzichtet hätte, kommen Neville Chamberlain und Tony Blair weg. Insbesondere außenpolitisch haben beide, laut Brown, eine desaströse Bilanz vorzuweisen. Es geht um Chamberlains Appeasement-Politik, die Hitler und das nationalsozialistische Deutschland zu lange gewähren ließ. Und um Blairs unbändigen Willen, Großbritannien 2003 an der Seite der Vereinigten Staaten in den Irakkrieg zu führen. Er stellte sich gegenüber Meinungen anderer Politiker, Experten und Diplomaten taub. Brown sieht hier vor allem Selbsttäuschung am Werk.
Im Grunde durchleuchtet Archie Brown unterschiedliche Arten, die politische Bühne zu betreten, sie zu bespielen und wieder zu verlassen. Interessant sind dabei Karrieren wie die von Deng Xiaoping, der unter Mao aufstieg, zweimal verbannt wurde und immer wieder zurückkehrte. Nach Maos Tod trieb er die wirtschaftliche Modernisierung Chinas voran, ohne eine Führungsposition innezuhaben. Der politische Abgang erfolgt dann entweder freiwillig, unfreiwillig oder scheinbar freiwillig. Manchmal kann er zäh sein. Man verliert eine Wahl, darf nicht mehr antreten, produziert einen Skandal oder die Partei stürzt einen.
Browns Kategorien überzeugen nicht bis ins Letzte, denn so eindeutig lässt sich eine politische Führung oft nicht zuordnen und irgendetwas hat ja fast jede Regierung neu definiert. Insofern leuchtet die weit gefasste Kategorie der neudefinierenden Führung nicht ein. Zudem spielt es für Brown oft kaum eine Rolle, in welche Richtung die politische Reise dann ging. So erstrahlt die Amtszeit Adenauers bei Brown nur im hellsten Licht. Überhaupt lesen sich die Kanzlerschaften Adenauers, Brandts und Kohls, als habe ein Erfolg den nächsten gejagt. Man wüsste eben gern, wie Brown das Verhältnis von Führung und politischen Inhalten denkt.
Manches an diesem Buch mag grob, einfach, antiquiert und allemal konventionell sein, aber es ist ein großes Vergnügen, es zu lesen. Archie Brown zeigt kompakt und einnehmend die Unterschiede zwischen Regierungsstilen und die entscheidenden politischen Momente des 20. und der ersten Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts auf. Er erzählt eine mitreißende, globale politische Kulturgeschichte, kenntnis- und geistreich und unterhaltsam. Für jede Regierungszeit hat er eine gute Geschichte parat. Das Überraschende und Schöne ist, dass es in diesem Buch letztlich gar nicht so sehr um die „großen Männer“ geht, sondern um Entscheidungsfindung, Gelingen und Scheitern in der Politik.
ISABELL TROMMER
Die Analyse mag oft grob sein,
doch sie ist geistreich
und überdies unterhaltsam
Archie Brown:
Der Mythos vom
starken Führer.
Politische Führung im 20. und 21. Jahrhundert. Aus dem Englischen von
Stephan Gebauer. Propyläen Berlin 2018.
480 Seiten, 25 Euro.
E-Book 22,99 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Warum nicht jeder politische "Führer" ein Verbrecher sein muss
Selbst im gegenwärtig politisch aufgeheizten Klima der Bundesrepublik erklingt nur selten öffentlich der Ruf nach einem "Führer". Die Ursache ist klar: Die Idee politischen Führertums ist in Deutschland aus berechtigten historischen Gründen desavouiert. In den deutschen Politik- und Geschichtswissenschaften spielt deshalb die Kategorie des Führertums kaum eine Rolle. Jenseits der Wissenschaften ist im deutschen Kontext von Führung denn auch nur in Ausnahmefällen die Rede: Die Bundeswehr befasst sich mit ihrer "Inneren Führung", und Nachwuchskräften aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft werden teure und mitunter fragwürdige Schulungen in Sachen "leadership" angeboten. Es ist auffällig, dass im letztgenannten Fall der deutsche Begriff vermieden und stattdessen ein inhaltlich im Kern deckungsgleicher, jedoch offenbar politisch weniger belasteter englischer Begriff verwendet wird. Vor diesem Hintergrund ist die Abfassung einer Geschichte politischer Führung im 20. und 21. Jahrhundert aus Deutschland kaum zu erwarten gewesen.
Umso dankbarer muss man dem renommierten Oxforder Emeritus Archie Brown sein, dass er sich in einer 2014 veröffentlichten und nunmehr auch auf Deutsch verfügbaren umfangreichen Studie des Themas angenommen hat. Denn Brown ist ein bemerkenswertes Buch gelungen, das die Schwierigkeiten des Themas gekonnt umschifft und zugleich neue Einsichten eröffnet. Dieses Kunststück gelingt ihm, weil er einerseits die Kategorien von "Führer" und "Führertum" aus dem beruhigteren englischen Sprachumfeld entnommen und sie in ein kategorial ebenso klares wie scharfsinniges politikwissenschaftliches Raster eingebunden hat. Andererseits legt Brown keine Verherrlichung des Führertums vor, sondern nimmt seinen Ausgang von der Kritik an der seines Erachtens "beunruhigenden", weltweit zunehmenden Tendenz, vermeintlichen "Machern" oder "Entscheidern" zu viel zuzutrauen. Am Ende erweist sich die Untersuchung deshalb als ein Plädoyer für die "kollektive", nicht solitäre Führung in modernen Demokratien.
Ihre Schlüssigkeit gewinnen Browns Ausführungen durch die souveräne Unterfütterung mit historischen Beispielen. Im Zentrum steht dabei die Darstellung des Handelns unterschiedlicher Staats- und Regierungschefs. Auch wenn darunter die Miniaturen aus der britischen, amerikanischen und sowjetischen Geschichte am eindruckvollsten gelungen sind, vervollständigt erst die Einbeziehung etwa chinesischer Beispiele das Bild. Jüngere Entwicklungen wie die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten oder die ausgreifenden Ermächtigungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping werden denn auch in dem für die deutsche Ausgabe neu verfassten Vorwort erörtert.
Anhand dieser Beispiele illustriert Brown seine Unterscheidung fünf verschiedener Formen von politischer Führung. Diese Kategorien beziehen sich stets auf individuelle "Führer", die als Entscheider über erhebliche persönliche Macht verfügen, öffentlich wie auch innerhalb ihrer Partei einen besonderen Einfluss besitzen und nachhaltige Wirkung entfalten. Unter einer "neudefinierenden Führung" versteht Brown dabei eine Form der Führung, welche "die Vorstellung der Gesellschaft davon, was machbar und wünschenswert ist, verändert" und schließlich die Gesellschaft selbst umgestaltet. Franklin D. Roosevelts "New Deal" und Margaret Thatchers liberale Wirtschaftspolitik stehen beispielhaft dafür. Gleichwohl wird mit diesen "Führern" keine grundsätzliche Umwälzung des wirtschaftlichen und politischen Systems verbunden. Die "Führer" dagegen, die in erheblichem Maße zum Wandel des wirtschaftlichen oder politischen Systems eines Landes oder gar des internationalen Staatensystems beitragen, unterscheidet Brown wiederum anhand der Gestaltung wie der Folgen dieses Übergangs: "Transformative Führer" wie Charles de Gaulle, Adolfo Suárez, Michail Gorbatschow, Deng Xiaoping oder Nelson Mandela erlangen ihre Macht und verändern ihre Mitwelt vergleichsweise friedlich. Den negativen Gegenentwurf dazu bilden "revolutionäre Führer" wie Lenin, Tito, Mao Tse-tung und Pol Pot, die zumeist im Zuge gewaltsamer Veränderungsprozesse an die Macht kommen, welche mit dem Zusammenbruch eines hergebrachten Regimes und der Ausbildung einer neuen, oft ebenfalls gewalthaltigen Ordnung einhergehen.
"Totalitäre" und "autoritäre Führung" wiederum sind in den politischen Systemen anzutreffen, in denen die politische Führung über eine geradezu unbeschränkte Macht verfügt. Gerade in diesem Kontext erweist sich besonders deutlich, dass nach innen wie nach außen "die uneingeschränkte individuelle Herrschaft fraglos gefährlicher als die kollektive" ist. Unter den politischen Bedingungen solcher Regime halten sich auch "toxische Führer" an der Macht. Sie stützt dann eine Mischung aus Amtsautorität und "irrationalem Glauben" an die "Illusion, die Menschheit brauche starke Führer". Andererseits kann gerade in solchen Regimen ein Führungswechsel viel bewirken, wie die Entwicklungen verdeutlichen, die nach dem Tod schier allmächtiger "Führer" wie Stalin und Mao einsetzten.
Die deutsche Geschichte bietet Brown die Gelegenheit, drei seiner Führungstypen exemplarisch zu diskutieren: Auf den totalitären "Führer" Adolf Hitler folgten mit Konrad Adenauer, Willy Brandt und Helmut Kohl drei neudefinierende Führer. Zwar haben die drei Bundeskanzler Deutschland und Europa auf unterschiedliche Weise geprägt, doch bezeugt Brown zufolge die Entwicklung der Bundesrepublik insgesamt "einen Zusammenhang zwischen guter Führung und demokratischer Konsolidierung". Auch die gegenwärtige Bundeskanzlerin charakterisiert Brown äußerst positiv: Angela Merkel erscheint ihm als "eine sehr kompetente politische Führerin", da sie nicht narzisstisch sei und zudem eine ,realistische' Politik mache. Damit aber wäre sie davor gefeit, jenem "Hybrissyndrom" (David Owen) anheimzufallen, das Brown zufolge viele selbsterklärte "starke Führer" auszeichnet: Ausgehend von der Selbstwahrnehmung, "eine überlegene Urteilskraft zu besitzen", würden diese zunehmend beratungsresistent und träfen dann fragwürdige fachliche Entscheidungen. Die Folgen reichen von unausgereiften Gesetzesvorstößen bis zu "Unterdrückung und Blutvergießen".
Brown plädiert daher für eine "kollegiale und kollektive Führung", die Entscheidungen auf möglichst breiter Grundlage mit anderen Spitzenpolitikern und Fachleuten sowie mit der eigenen Partei und der Öffentlichkeit berät und diskutiert. Insbesondere in einer Demokratie sei es nämlich "unangemessen, große Macht in die Hände einer einzigen Person zu legen, und eine Regierung, in der tatsächlich nur eine Person in der Lage wäre, über sämtliche Fragen zu entscheiden, wäre eine sehr inkompetente Regierung". Das Geheimnis effektiver und guter Führung hat bereits 1948 Premierminister Clement Attlee erkannt, als er erklärte, "dass die Grundlage demokratischer Freiheit in der Bereitschaft liegt anzunehmen, dass andere Menschen klüger sein können als man selbst".
MARIAN NEBELIN
Archie Brown: Der Mythos vom starken Führer. Politische Führung im 20. und 21. Jahrhundert. Aus dem Amerikanischen von Stephan Gebauer.
Propyläen Verlag, Berlin 2018. 480 S., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Archie Browns Studie kommt in ihrer deutschen Übersetzung mit einem aktualisierten Vorwort zur richtigen Zeit: Sie erinnert anhand zahlreicher Beispiele daran, dass die sogenannten starken Führer eben nicht automatisch auch effektive Staatslenker sind [...]" Michael Kuhlmann DLF Andruck 20180604