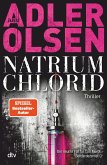Ein verblüffender Fund: Der junge Theodor Fontane entdeckt die viktorianische Erfolgsautorin Catherine Gore - Fontanes Übersetzung zeigt den werdenden Romancier.
Catherine Gore (1799-1861), eine der meistgelesenen Autorinnen ihrer Zeit, porträtierte in ihrem 1842 in Fortsetzungen
erschienenen Gesellschaftsroman Der Geldverleiher die englische Gesellschafts- und Finanzwelt. Mit drastischem Realismus und ihrer Beschreibungs- und Beobachtungskunst demaskiert sie eine Epoche voller Standesdünkel und antijüdischer Vorurteile. Theodor Fontane (1819-1898) hat den Roman der Zeitgenossin von der britischen Insel mit einer erstaunlichen Sprach- und Stilsicherheit übertragen - lange bevor er seine berühmten Romane schrieb, die ihn zum großen Klassiker des bürgerlichen Realismus machten.
Auf Grundlage eines wiederentdeckten Typoskripts hat der Literaturwissenschaftler, Historiker und Fontane-Biograph
Iwan-Michelangelo D'Aprile dieses übersetzerische Meisterstück aus Fontanes jungen Jahren ediert; sein Vorwort erhellt ein fehlendes Stück in Fontanes Gesamtwerk und bereichert uns um die Kenntnis seiner englischen Vorbilder.
"Ein richtiger Schmöker. Ein äußerst interessantes Buch des Übergangs von der romantischen Schauergeschichte zum
realistischen Roman ... Gore wollte unterhalten, und das ist ihr sehr gelungen." - Jürgen Kaube, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Catherine Gore (1799-1861), eine der meistgelesenen Autorinnen ihrer Zeit, porträtierte in ihrem 1842 in Fortsetzungen
erschienenen Gesellschaftsroman Der Geldverleiher die englische Gesellschafts- und Finanzwelt. Mit drastischem Realismus und ihrer Beschreibungs- und Beobachtungskunst demaskiert sie eine Epoche voller Standesdünkel und antijüdischer Vorurteile. Theodor Fontane (1819-1898) hat den Roman der Zeitgenossin von der britischen Insel mit einer erstaunlichen Sprach- und Stilsicherheit übertragen - lange bevor er seine berühmten Romane schrieb, die ihn zum großen Klassiker des bürgerlichen Realismus machten.
Auf Grundlage eines wiederentdeckten Typoskripts hat der Literaturwissenschaftler, Historiker und Fontane-Biograph
Iwan-Michelangelo D'Aprile dieses übersetzerische Meisterstück aus Fontanes jungen Jahren ediert; sein Vorwort erhellt ein fehlendes Stück in Fontanes Gesamtwerk und bereichert uns um die Kenntnis seiner englischen Vorbilder.
"Ein richtiger Schmöker. Ein äußerst interessantes Buch des Übergangs von der romantischen Schauergeschichte zum
realistischen Roman ... Gore wollte unterhalten, und das ist ihr sehr gelungen." - Jürgen Kaube, Frankfurter Allgemeine Zeitung

seiner Kunst
Was für ein Fund: der junge Fontane als Übersetzer
Da ist der Anderen Bibliothek, die sich auf vergessene oder anders besondere Bücher in edler und origineller Ausstattung spezialisiert, ein echter Fund gelungen: Theodor Fontane, von dem es stets hieß, er habe sich erst spät im Leben dem Roman zugewandt, hat sich tatsächlich bereits als junger Mann, gerade mal in seinen Zwanzigern, intensiv mit dem Genre beschäftigt, ja selbst ein komplettes Exemplar produziert, das unverkennbar schon den späteren Autor ahnen lässt – in Gestalt einer Übersetzung aus dem Englischen. Gedruckt wurde der Text bislang nie, entsprechende Versuche Fontanes selbst verliefen im Sande. Der Redakteur, der das Manuskript verwahrte, nahm es nach der missglückten Revolution von 1848 mit auf seine Flucht in die USA, dessen Tochter, nunmehr in Florenz lebend, bot es über einen Mittelsmann dem Verleger Friedrich Fontane an, Theodors Sohn; dem war der Kaufpreis zu hoch, aber er ließ, wohl nicht ganz legal, eine maschinenschriftliche Kopie anfertigen. Das Original wurde schließlich vom Märkischen Museum erworben, ging im Zweiten Weltkrieg verloren – das Typoskript jedoch überlebte und erblickt, ediert von Iwan-Michelangelo D'Aprile, mit einer Verzögerung von 180 Jahren nunmehr das Licht der Öffentlichkeit.
Die Verfasserin, Catherine Gore, mit Dutzenden Romanen in ihrer Zeit höchst erfolgreich, ist heute weitgehend vergessen; die Encyclopedia Britannica erwähnt sie in den 70er-Jahren mit keiner Silbe mehr. Den Plot muss man als ein rechtes Melodram, um nicht zu sagen als Moritat bezeichnen: Keiner in den höchsten Rängen der englischen Gesellschaft entgeht den Klauen des gefürchteten Geldverleihers A.O., der mit seinem vollen Namen Abednego Osalez relativ spät hervortritt. Im Munde der anderen erscheint er wie ein düsteres Ungeheuer, das ihrer aller Leben überschattet – aber kaum hat der jugendliche Protagonist Basil Annesley Gelegenheit erhalten, ihn persönlich kennenzulernen, erweist er sich, bei aller Geschäftstüchtigkeit, als weiser Humanist, trotz seines schweren Geschicks; immer und überall hatte er es büßen müssen, dass schon sein Name ihn unüberhörbar zum Juden stempelte. Die Einleitung vergleicht ihn mit Lessings Nathan, was leider stimmt.
Es stellt sich zum Schluss heraus, dass irgendwie alle mit allen verwandt sind. Der reiche A.O. stattet Basil und dessen geliebte Esther mit dem nötigen Vermögen aus, und endlich können sie heiraten: „Basil, glaube mir, dass unter allen Gaben, die uns ein geliebtes Wesen bieten mag, Reichtum nicht fehlen darf, um mit Wahrscheinlichkeit auf eine glückliche Zukunft schließen zu können!“, sagt die Mutter. So weit, so schlecht und sentimental-konventionell. Doch fährt sie fort: „Geld, mein lieber Basil ist die Quelle alles Einflusses hier auf Erden.“ Die englischen Aristokraten, unter denen das Buch spielt, leben von ihrem Grundbesitz, der ihnen pro Jahr eine bestimmte feste Summe einträgt, recht hoch zwar, doch längst nicht hoch genug, um ihre Ausgaben zu decken. Sie sehen sich durch ihren Stand gezwungen, es aufs Prunkvollste zu verschleudern. Wer pro Jahr 20000 Pfund hat, muss im Wert von mindestens 25000 Pfund repräsentieren, sonst gilt er nichts. Die Differenz wird durch Kredite ausgeglichen, welche die Schuldner, der Art ihrer Einkünfte entsprechend, schlechterdings nicht bedienen können.
So stürzen Grafen und Herzöge erst vor A.O. auf die Knie, um sein steinernes Herz zu rühren, und dann in den Ruin. Ihre feudalen Renten verwandeln sich per Bankrott zu Kapital, zu Geld im neuen und eigentlichen Sinn. Die durchtriebene Lady Maitland, die bereits ihren ganzen Schmuck versetzt hat, sucht mit Charme und Finten den Geldverleiher zu einem letzten Darlehen zu bewegen, dieser hält ihr eine salbungsvolle Standpauke über ihre Verschwendungssucht, eine bühnenreif pathetische Szene – aber als sie geknickt und geschlagen abzieht, ist an ihr und durch ihr Unglück der ökonomische Wandel ratifiziert. Der junge Annesley kann nur staunen, was da mit dem Geld geschieht: „Es war hier ,Zweck’ und nicht ,Mittel’.“
Die Charaktere an sich bleiben recht blass, besonders der milchbärtige Basil. Doch glänzen sie dort (und mit ihnen der Roman), wo sie sich im ritualisiertem Rahmen der Clubs und Salons zusammenfinden. Die besten Passagen des Buchs haben die Sitten der Gesellschaft zum Gegenstand, das Wort sowohl im geselligen als auch im soziologischen Sinn verstanden - „prachtliebend, herzlos und Leute nach der Mode“, so kennzeichnet sie die Autorin, ohne dabei im geringsten schlechte Laune zu kriegen. Und genau diese Passagen zeigen auch am besten, was schon der ganz junge Fontane kann: Figuren im Gespräch erschaffen. Bei aller Oberflächlichkeit des Geplauders werden die Personen vollkommen deutlich.
Fontane (oder vielleicht auch schon Gore) schreibt Psidias statt Phidias und Momento mori, wo ein Memento mori am Platz wäre, bezeugt aber gerade so seine Nähe zur gleißnerischen Halbbildung, in der die Figuren zuhaus sind; der Herausgeber hat sich zurecht gehütet, an diesen glücklichen Fettnäpfchen etwas zu bessern. Dafür sollte die geneigte Leserin – und auf eine solche ist es offenkundig abgesehen – schon wissen, was ein coup de grâce und ein Chevalier d'honneur ist, eine Equipage oder eine Chaiselongue: In solchen Vokabeln fängt sich die gesellige Anmut dieser Kreise wie ein Lichtreflex im Kristallglas ihrer Feste.
Ein Rätsel jedoch bleibt bei diesem gegen Ende hin etwas schleppenden, im Ganzen aber doch sehr unterhaltsamen Buch: Da Fontane hier den klaren Beweis in Händen hielt, dass ihm der Roman als Form und Stilprinzip lag – warum hat es dann noch so lang gedauert, bis er sich im Ernst ans Werk machte?
BURKHARD MÜLLER
Die englischen Aristokraten,
unter denen das Buch spielt,
leben von ihrem Grundbesitz
Catherine Gore:
Der Geldverleiher.
Ein viktorianischer Roman. Aus dem Englischen von Theodor Fontane.
Herausgegeben und
eingeleitet von Iwan-Michelangelo D'Aprile. Die Andere Bibliothek, Berlin 2021.
468 Seiten, 44 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Die englische Schriftstellerin Catherine Gore kennt hierzulande kaum jemand. Theodor Fontane hat sie zwar übersetzt - doch übers Manuskript kam er nicht hinaus. Jetzt erscheint dieser Roman "Der Geldverleiher" erstmals auf Deutsch.
Von Jürgen Kaube
Der Roman beginnt mit einer großartigen rhetorischen Figur. Auf den ersten vier Seiten wird ausgeführt, dass die Laster über die Gesellschaft wie Epidemien herrschen. Sehr allgemein. Raub und Mord seien als barbarische Verbrechen inzwischen durch "Ordnung und Gesetz" unterdrückt worden, doch stattdessen seien Lug und Trug die Zeichen einer überreifen Zivilisation. Schon etwas konkreter. Der Sieg über Napoleon habe in den ersten fünfzehn Jahren des neunzehnten Jahrhunderts die Seelen der Engländer gereizt, in Überschwang versetzt, maßlos und wild gemacht. Ziemlich zeitgenau. Sie fingen an, zu spielen, zu konsumieren und ihr Vermögen zu verschwenden. Also machten sie Schulden und wendeten sich darum - an den Helden dieses Romans.
Selten dürfte ein Romanheld seit Homer mit einer solchen aus höchster Höhe auf ihn herabstürzenden Kamerafahrt und so prinzipiell eingeführt worden sein. Catherine Gore, die es auf diese Weise tat, hatte gar keine philosophischen Absichten. Sie verstand nur die Techniken, Spannung zu erzeugen. Zwischen 1823 und 1858 hat sie mehr als siebzig Werke publiziert: zumeist Romane und Erzählungen, zehn Theaterstücke. Vom "Geldverleiher" wurden in zwölf Jahren vierzehntausend Exemplare verkauft, für die Zeit eine sehr respektable Menge. Da die meisten Leser sich in Leihbibliotheken versorgten, war ihre Zahl um ein Vielfaches höher. Den Durchbruch am englischen Buchmarkt erzielte Gore 1841 mit "Cecil oder Abenteuer eines Gockels". Ein guter Titel, denn an der Darstellung von Gockeln - überwiegend männlichen, aber nicht nur - lag ihr viel. Hierzulande ist sie leider völlig unbekannt.
Ihre Romane werden der Gattung der "Silver Fork Novel" zugeordnet, ein Name, den William Hazlitt 1827 im Umlauf gebracht hatte, um sich über eine Literatur lustig zu machen, die mehr daran interessiert war, mit welchem Besteck die Bessergestellten Fisch aßen, als für ihre Gefühle und Taten. Thomas Carlyles herrliche Geschichte vom "wiedergeschneiderten Schneider", der "Sartor Resartus", in der ein deutscher romantischer Professor an einer Philosophie der Kleider arbeitet, hat 1838 diesen Spott perfektioniert. Es waren Jahrzehnte, in denen viel über den Unterschied von Schein und Wesen sowie die Darstellungsüberschüsse im geselligen Verkehr nachgedacht wurde. Besonders in der Großstadt war es nicht leicht herauszufinden, was hinter großen Auftritten steckt. Womöglich war alles nur Fassade.
Die Silbergabelromane, zu deren bekanntesten Autoren Edward Bulwer Lytton ("Pelham") und Benjamin Disraeli ("The Young Duke") gehörten, erzählten den Lesern aus der Mittelschicht von der Welt der Oberschicht, von Reisen, Luxuskonsum und von der Mode. "Was weiß mein Sohn denn von Herzögen?", soll Disraelis Vater gefragt haben und traf damit eine durch Welthandel, Tourismus und Großstadtleben entzündete Phantasie. Von Herzögen musste man nur so viel wissen wie heute die "Bunte", nämlich fast gar nichts. Denn es ging nicht um Herzöge an sich, sondern um solche für das Publikum. Dem Genre trug das und die detailreiche Beschreibung der Warenwelt den Verdacht ein, eine höhere Form von Reklame zu sein. Hazlitt beschwerte sich über zu viel "Macassar Öl, Kölnisch Wasser, Seltzer-Sprudel, Ottos Rosenextrakt und göttliche Pomade" in den Romanen.
Das traf manche Hervorbringung, aber nicht alle Romane von Catherine Gore. In ihrem Frühwerk erklärt sie ganz offen, Plots und Personenkonstellationen aus Jane Austens ("Mrs. Austin"!) Romanen in die Londoner Oberschicht zu verlegen, und schulte sich ein wenig am Stil der Vorgängerin. In ihren Werken ist entsprechend die Kritik an der Aufgeblasenheit und dem Egoismus prätentiöser Schichten spürbar. Deren verkapselte Härte wird geschildert, ihr verzweifelter Versuch, einem Publikum zu gefallen, das sie eigentlich verachten, ihre Dummheit. Im Grunde wird für eine Mittelschicht geworben, die sich von den Übertreibungen des Konsums fernhält und zugleich für ihn empfänglich ist. Sieben Jahre lang hielt sich Gore in Paris auf, wo gerade die große Stadt und ihre Untergründe zum literarischen Motiv geworden waren.
Gores "Geldverleiher" war 1842 nach ihrer Rückkehr aus Frankreich erschienen. Balzac schließt gerade seine "Verlorenen Illusionen" ab, als die Zeit der Reforminitiativen des liberalen britischen Adels, an den sich viele Silbergabelschmiede angelehnt hatten, schon wieder vorbei war. Gores Roman schildert eine Welt, in der die Aristokratie allmählich ihre Funktion verliert, der Gesellschaft als solcher vorzustehen. Er kritisiert den Antisemitismus in den Oberschichten anhand des pseudonymen Titelhelden A.O. Der scheint zunächst vor allem ein schattenhafter Kredithai zu sein, erweist sich aber allmählich als der einzige Träger von ökonomischem Verstand in ganz London. A.O. ist der, den alle aufsuchen, wenn sie illiquide sind, den aber niemand je weiterempfohlen hat, der einmal seine Dienste in Anspruch nahm; eine Art Gespenst.
Denn Abednego Onsalez, wie er ausgeschrieben heißt, ist auch ein vorweggenommener Graf von Monte Christo, der sich an der vermeintlich guten Gesellschaft für die Zurückweisung rächen will, die er durch sie erfährt. "Der Wolf ist wild, wenn man Jagd auf ihn macht", sagt er in seinem langen Schlussbekenntnis mit einem verhaltensbiologisch gewagten Bild. Man redet schlecht über den angeblichen Juden, ignoriert, dass er, wie schon sein Großvater, aufrichtig christlichen Glaubens ist und konvertierte, verwehrt ihm die Zugänge zur Oberschicht, aber sucht ihn heimlich auf, weil das "bloße Geld" doch eben begehrt wird. Weil er das schlechte Gewissen der Oberschicht ist, kann er tun, was er will, das Stigma wird er nicht los.
Dass Gore hier einen Konvertiten zum Opfer des Vorurteils macht, deutet an, was ihr als Forderung von Toleranz möglich schien. Anders als im französischen Pendant von Alexandre Dumas, das von 1844 bis 1846 erschien, erzählt Gore die Geschichte des Helden nicht direkt, sondern erschließt sie Schritt für Schritt durch die Geschichte eines seiner Kreditnehmer, des Gardeoffiziers Basil Annesley. Der wiederum nimmt seine Schulden durchaus uneigennützig auf, um einen Emigranten zu unterstützen, der unter dem Druck der Karlsbader Beschlüsse von Heidelberg nach London floh. Weil es ein Maler ist, kann Gore auch alle Aspekte der künstlerischen Freiheit und des Kunstmarktes, der sie gängelt, mit in ihre Darstellung hineinziehen.
Die Topographie Londons wird dabei fast vollständig abgeschritten: von den Villenvierteln über die City, die Spielsalons und die Gefängnisse bis zum East End und der Paulet-Street, in der noch nie eine Kutsche gesehen wurde. Gore schrieb für Leser, die das kannten. Heute liest es sich wie eine Einführung in die Londoner Milieus jener Zeit. Bettler, Auktionatoren, Dandys, Polizisten und Opernsänger und müßiggängerische Lords haben ihren Auftritt. Allegorisch aufgefasst, sagt Gore, dass die Stadt weniger durch Kapital oder Arbeit als durch Schulden zusammengehalten wird: "Zu den traurigen Wahrheiten der Fashion, deren Seltsamkeit oft jede Dichtung übersteigt, gehört vorzüglich die, daß man bei einer Rente von zwanzigtausend Pfund jährlich für fünfundzwanzigtausend mit Leichtigkeit entlehnen kann."
Das alles ist in eine Geschichte eingebracht, die wenig riskant erzählt wird, kein Pathos scheut und ein anrührendes Ende hat. Die Figuren handeln, einmal gekonnt eingeführt, wenig überraschend. Heute würde man eine Fernsehserie daraus machen, und es könnte eine sehr gute werden. Gore wollte unterhalten, und das ist ihr sehr gelungen. Wer nicht darauf besteht, Romane sollten die Weltsicht ihrer Leser erschüttern, wird hier nichts zu beanstanden haben. Wobei viele Leser des Romans von Catherine Gore gerade in puncto Judentum durchaus eine andere Weltsicht gehabt haben dürften. Insofern darf der Roman zumindest moralisch mutig genannt werden.
Dass Catherine Gores Buch jetzt auf Deutsch erscheint, liegt aber weniger an ihrem Mut und ihrer Unterhaltungskraft, sondern an ihrem Übersetzer. Der junge Theodor Fontane hatte während seiner Ausbildung zum Apotheker begonnen, sich stark für die englische Literatur und für die Verhältnisse in der führenden Industrienation wie ihrer Hauptstadt zu interessieren. So stieß er in einer schottischen Monatszeitschrift auf den "Geldverleiher", der dort als Fortsetzungsroman erschien, und fertigte sofort eine deutsche Fassung an. Mitunter übersetzte er dabei den Londoner Dialekt ins Berlinerische. Aus "I've been watchin on him this quarter of an hour" wird "Ick hab ihn schonstens seit ne Viertelstunde uf de Kieke". Mitunter färbte er den englischen Adel preußisch ein. Aus "What a devil of a show up" wird "Verteufelter Anblick das!", und wo die Adligen im Deutschen gern "Auf Ehre!" rufen, steht im Englischen gar nichts.
Einen Verleger fand Fontane dafür nicht. Dass das lange verschollen geglaubte Manuskript mit dem Titel "Abednego der Pfandleiher" über verwinkelte Wege, die bis ins amerikanische Milwaukee reichten, doch erhalten blieb, ist ein kleines Wunder. Iwan-Michelangelo D'Aprile, Verfasser der schönsten Biographie Fontanes, hat es wiedergefunden und jetzt herausgegeben. Zum einen ist es ein richtiger Schmöker. Zum anderen ein äußerst interessantes Buch des Übergangs von der romantischen Schauergeschichte zum realistischen Roman. Für die Weihnachtslektüre kann man es nur empfehlen.
Catherine Gore: "Der Geldverleiher". Ein viktorianischer Roman.
Aus dem Englischen von Theodor Fontane. Die Andere Bibliothek, Berlin 2021. 472 S., geb., 44,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
Rezensentin Maike Albath schwärmt für Catherine Gores grandios unterhaltsamen Roman über einen Geldverleiher und seine Kundschaft und alles, was das viktorianische London im Innern zusammenhält: Schulden. Wie scharfsinnig die Autorin das Soziale und die dekadente Oberschicht erfasst, wie sie dem Leser das Gefühl vermittelt auf der moralisch richtigen Seite zu stehen, wie sie den Plot inszeniert, markante Figuren mit unterschiedlichen Sprachregistern erschafft, findet Albath lesenswert. Theodor Fontane fand es eine Übersetzung wert, und die ist laut Albath wiederum so kongenial, dass der berlinische Dialekt, den der Übersetzer einschmuggelt ("Langfingermacher") fast gar nicht auffällt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH