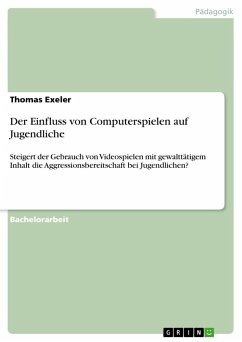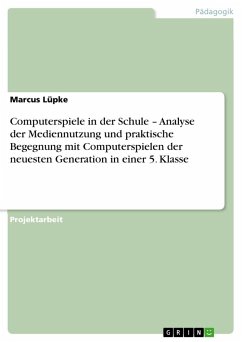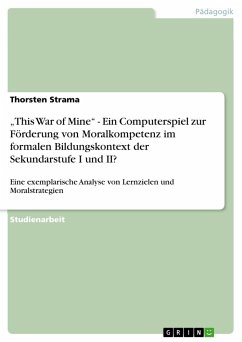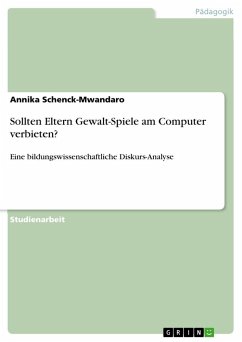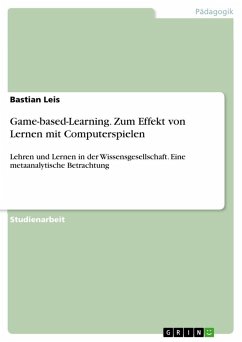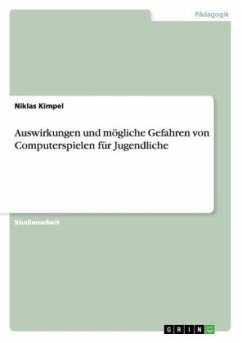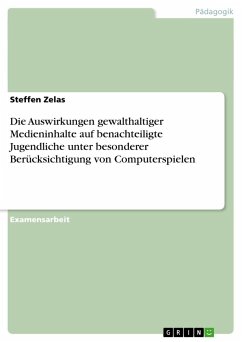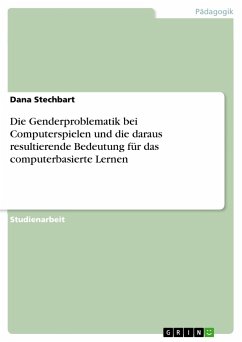Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Pädagogik - Medienpädagogik, Note: 1,0, Universität Osnabrück, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Medium der Computerspiele ist heutzutage weit verbreitet und längst gehört es nicht mehrzur Ausnahme, wenn im Kinderzimmer neben konventionellem Spielzeug ein Computer odereine Videospielkonsole steht. Immer mehr Kinder scheinen im Alltag Videospiele zu spielen unddafür das konventionelle Spiel mit Freunden oder "draußen" zu vernachlässigen. Studien belegendie steigende Präsenzzeit, die Kinder vor jenen Bildschirmspielen verbringen, um damit in dienicht-reale/virtuelle Welt zu versinken (vgl. Kap. 3.2). Eltern und Erzieher scheinen hilflos undbesorgt auf diese sich abzuzeichnende Tendenz zu blicken, einer förmlichen Dekadenz destraditionellen Spiels, mit Sorge erfüllt, ob den jenes "unbewegliche" Spiel vor dem Bildschirmpädagogisch wertvollen Ansprüchen gerecht wird. Es stellt sich die Frage, ob Heranwachsendemit zunehmender Präsenz vor dem Bildschirm dennoch die nötigen sozialen Komponentenerwerben, die für ein intersoziales Miteinander nötig wären. Aufgrund schrecklicher Vorfälle anSchulen, die von Jugendlichen begangen worden sind, avancierte der Aufenthalt in der Virtualitätals Sündenbock. Nach Angabe vieler Printmedien, Online-Nachrichtendiensten und TVReportagen1wurde bekannt, dass sämtliche Jugendliche, die einen Amoklauf verübten, sich mitsogenannten "Killerspielen" in ihrer Freizeit beschäftigten. Es entstand eine Debatte über Verbotund Abschaffung jener gewaltbeinhaltenden Spiele2, so dass auch Studien auftauchten dieverdeutlichten, dass nicht nur Spiele, die Gewalt in Spielen verherrlichen, sondernComputerspiele allgemein als bedenklich gelten (vgl. Kap. 5). Dem entgegen setzen sich Nutzerder vermeintlich gefährlichen Spiele zur Wehr und bestreiten dementsprechend die Gefahr undden aggressionsfördernden Einfluss der von den Spielen ausgehen soll. Da in dieser Debattekeine tatsächliche Gewissheit vorliegt, ob und inwiefern Videospiele Einfluss auf den Nutzerhaben, soll in dieser Arbeit die Fragestellung behandelt werden: "Steigert der Gebrauch vonVideospielen mit gewalttätigem Inhalt die Aggressionsbereitschaft bei Jugendlichen?". Dazu istes allerdings erforderlich den zur Debatte stehenden Gegenstand, das Videospiel an sich, zu allererst zu betrachten, bevor auf theoretischen Grundlagen der Wirkungsforschung etwas über seinenEinfluss und Wirkung auf Jugendliche gesagt werden kann. Hierzu wird im folgendem dasmethodologische Vorgehen erläutert.