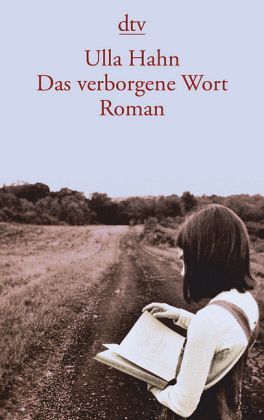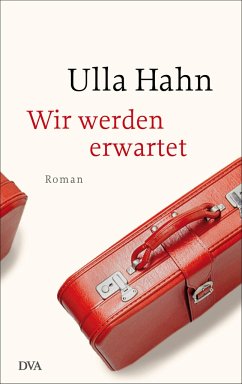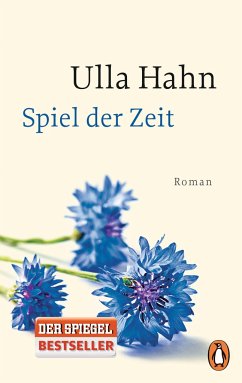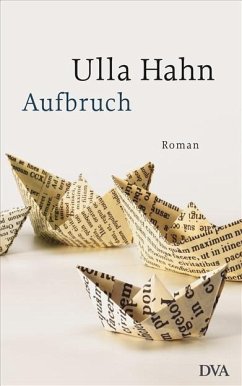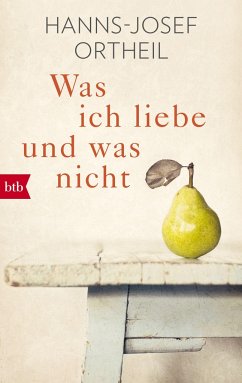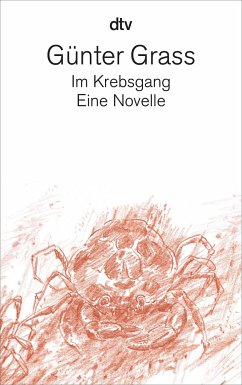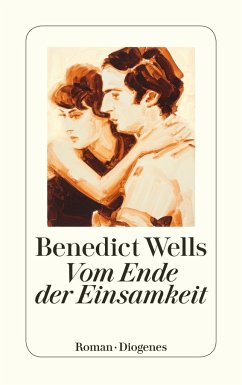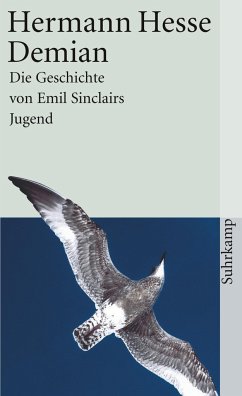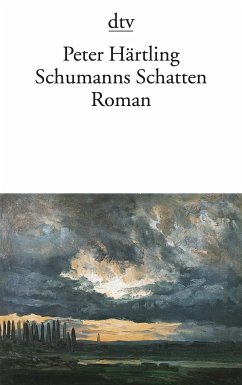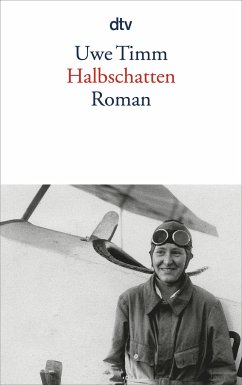Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar





Hildegard Palm, 1945 in Dondorf bei Köln geboren, ist die Tochter eines ungelernten Arbeiters und seiner Frau Maria, erzogen im katholischen Glauben. »Wie viele Seiten hat ein Ding?« fragt die Sechsjährige ihren Großvater. »So viele, wie wir Blicke für sie haben«, antwortet er. Ihren Eltern ist Hilde verdächtig. Sie ist ganz offensichtlich aus der Art geschlagen, will sich nicht anpassen an die Regeln der Arbeiterklasse, strebt nach Höherem, spricht Hochdeutsch und rezitiert Schiller. Das weckt Mißtrauen und Angst in ihrer Familie.
Als sie neun Jahre alt ist, legt sie eine Sammlung schöner Sätze und Wörter an - als Gegenwelt zum Gebrüll ihres Vaters und dem ängstlichen Geflüster der Mutter. Bücher werden zu ihrer Rettungsinsel. Als Hildegard in den Schulferien zum ersten Mal am Fließband steht und den anzüglichen Gesprächen ihrer Kolleginnen ausgeliefert ist, wirft sie einen entsetzten Blick in die Zukunft, die ihre Eltern für sie vorgesehen haben - Doch sie findet eine zweite, reichere Wirklichkeit: die Freiheit im Wort und die Kraft in der Literatur.
Als sie neun Jahre alt ist, legt sie eine Sammlung schöner Sätze und Wörter an - als Gegenwelt zum Gebrüll ihres Vaters und dem ängstlichen Geflüster der Mutter. Bücher werden zu ihrer Rettungsinsel. Als Hildegard in den Schulferien zum ersten Mal am Fließband steht und den anzüglichen Gesprächen ihrer Kolleginnen ausgeliefert ist, wirft sie einen entsetzten Blick in die Zukunft, die ihre Eltern für sie vorgesehen haben - Doch sie findet eine zweite, reichere Wirklichkeit: die Freiheit im Wort und die Kraft in der Literatur.
Im Deutschland der fünfziger und frühen sechziger Jahre sieht sich Hildegard Palm, kleiner Leute Kind voller Neugier und Lebenswillen, im Käfig einer engen katholischen Dorfgemeinschaft gefangen. Sie, die als ein bißchen verrückt gilt, zerbricht fast an der Härte und Verständnislosigkeit des Elternhauses und der Schule. Aber dann beginnt sie, die Welt der Literatur zu entdecken, große Gedanken und eine zweite, reichere Wirklichkeit zu erkennen, und findet so den Weg in die Freiheit.
Hahn, Ulla
Ulla Hahn wurde am 30. April 1945 in Brachthausen/Sauerland geboren und wuchs im Rheinland auf. Studium der Literaturwissenschaft, Geschichte und Soziologie, Promotion. Lehraufträge an den Universitäten Hamburg, Bremen und Oldenburg, anschließend Redakteurin für Literatur beim Rundfunk in Bremen. Für ihre Lyrik wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
Ulla Hahn wurde am 30. April 1945 in Brachthausen/Sauerland geboren und wuchs im Rheinland auf. Studium der Literaturwissenschaft, Geschichte und Soziologie, Promotion. Lehraufträge an den Universitäten Hamburg, Bremen und Oldenburg, anschließend Redakteurin für Literatur beim Rundfunk in Bremen. Für ihre Lyrik wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

© Julia Braun
Produktdetails
- dtv Taschenbücher Nr.13089
- Verlag: DTV
- 10. Aufl.
- Seitenzahl: 624
- Erscheinungstermin: 19. Mai 2003
- Deutsch
- Abmessung: 192mm x 122mm x 35mm
- Gewicht: 504g
- ISBN-13: 9783423130899
- ISBN-10: 342313089X
- Artikelnr.: 11199362
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.10.2001
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.10.2001Die Guten aufs Töpfchen
Heimatmelodie für Müppen: Ulla Hahn trifft den hohen Ton der Tiefebene / Von Gerhard Schulz
Neugierig und voller Schaulust kann man um Ulla Hahns Roman "Das verborgene Wort" herumgehen, wie um eine große Skulptur, deren Charakter und Schönheit changiert, je nachdem von welcher Seite man sie betrachtet. Versprochen wird uns die Geschichte von der kleinen Hildegard Palm, die als Kind einer Hilfsarbeiterfamilie irgendwo zwischen Düsseldorf und Köln in stockkatholischer Gegend zur Welt kommt und sich allen Hindernissen zum Trotz auf den langen Weg zu den Büchern, zum Erkennen und Wissen begibt - die Geschichte einer Jugend also und sicherlich ein Stück Autobiographie der 1946 im Sauerland
Heimatmelodie für Müppen: Ulla Hahn trifft den hohen Ton der Tiefebene / Von Gerhard Schulz
Neugierig und voller Schaulust kann man um Ulla Hahns Roman "Das verborgene Wort" herumgehen, wie um eine große Skulptur, deren Charakter und Schönheit changiert, je nachdem von welcher Seite man sie betrachtet. Versprochen wird uns die Geschichte von der kleinen Hildegard Palm, die als Kind einer Hilfsarbeiterfamilie irgendwo zwischen Düsseldorf und Köln in stockkatholischer Gegend zur Welt kommt und sich allen Hindernissen zum Trotz auf den langen Weg zu den Büchern, zum Erkennen und Wissen begibt - die Geschichte einer Jugend also und sicherlich ein Stück Autobiographie der 1946 im Sauerland
Mehr anzeigen
geborenen Autorin.
Frontal betrachtet ist dieses dicke Buch ein Stück deutscher Heimatgeschichte, nicht unähnlich jener Filmsaga aus dem Hunsrück, mit der Edgar Reitz vor Jahren das Fernsehpublikum weit über die deutschen Grenzen hinaus in seinen Bann zog. Reich an Personen, an Großeltern, Eltern, Kindern, Tanten, Onkeln, Geschwistern, an Kranken und Gesunden, an Priestern, Lehrern, Flüchtlingen, Fremdarbeitern, Fließbandarbeiterinnen, Sekretärinnen und ihren Chefs ist Ulla Hahns kleine Welt, die sich in großem Detail, lebhaft und leibhaftig, entfaltet. Kirmes, Hochzeit, Beerdigung sind Höhepunkte im Alltag, der von den Riten der Kirche durchdrungen ist. Katholische Wundergläubigkeit beschränkt die Köpfe, die Lehre vom erbsündigen Menschen macht selbst das Töpfchensitzen des Kindes zu einem Gott wohlgefälligen Akt, und der geile Kaplan gehört als Phänotyp wie selbstverständlich dazu.
Hie und da dringt ein Hauch Nachkriegszeit in Ulla Hahns epische Heimat, obwohl die große Politik und das goldglänzende Wirtschaftswunder nur ganz selten hindurchscheinen. Aber immerhin vollzieht sich die Entwicklung dieses kleinen Mädchens vor dem Hintergrund des wieder zu Selbstbewußtsein drängenden westdeutschen Staates. Fokus bleibt zwar stets das Leben dieser Hildegard - später "Hilla" - Palm, aber ihr Leben nimmt dennoch so etwas wie symbolische Züge für den deutschen Drang zu einem neuen Selbstwertgefühl an, nur daß es sich in ihr als Sehnsucht nach einer Neugründung im Kulturell-Geistigen, nicht im Materiellen äußert. Darin liegt wohl das Bedeutendste und Attraktivste dieses Romans.
Für Hilla Palm ist es ein Weg aus einer nahezu analphabetischen Sphäre zu den Buchstaben und in die Literatur. Wie das im einzelnen inszeniert wird, wie das kleine Kind aus Steinen Geschichten herausliest, nach dem Verhältnis von Worten und Dingen sucht und in Märchen die Magie der Sprache entdeckt oder aber als intelligente Schülerin leiden muß, das ist mit so viel Feingefühl und Beobachtungsreichtum dargestellt, daß allein dies schon reichen Lohn für die Ausdauer bei der Lektüre des Buches darstellt. "Zauberworte mußte man wissen, damit Felsen sich öffneten, Steine zu Menschen wurden . . ." Es ist nicht schwer, daraus ein Stück Initiation der Lyrikerin Ulla Hahn herauszulesen, der dann die Einweihung der Schriftstellerin und Germanistin in die Literaturgeschichte folgt. Denn Hilla Palm erschließt sich lesend die Werke von Lessing, Goethe, Schiller, Kleist, Keller, Heine, Rilke und der Droste: "Bücher starben nicht", waren resistent gegen die Vergänglichkeit, deren unerklärliche und erbarmungslose Macht dem Kind nach und nach bewußt wird. Ein Bildungsroman also?
Das wohl nicht, sondern allenfalls ein Entwicklungs- oder, besser noch, ein Auswicklungsroman, denn nicht so sehr in der Wechselwirkung von Welt und Ich vollzieht sich der Werdegang dieses jungen Mädchens, sondern eher als Durchsetzung von etwas in ihr Angelegtem. So zumindest gibt es uns die erwachsene Erzählerin zu verstehen, deren Perspektive im zurückhaltenden, oft nur implizierten Deuten des einen oder anderen Geschehens spürbar wird, obwohl ein Kind spricht, dem vieles noch unverständlich bleiben muß. Geht man also neugierig ein wenig weiter um Ulla Hahns Buch herum und betrachtet seine epische Fülle von der Seite, dann erscheint das alles doch ein wenig flach. So stark die episodische Buntheit rheinischen Lebens wirkt - in seiner Summe bleibt es die Enge eines Heimatromans, die dieses Buch prägt, fernab von den Lehrjahren eines Wilhelm Meister, die uns in ein ganzes Zeitalter voller großer geschichtlicher Bewegung hineinblicken lassen, und fernab auch von den intellektuellen Höhen eines Zauberbergs.
Nicht daß diesem Buch Intellektuelles fehlte. Gerade die Begegnungen der jungen Hilla mit der Literatur sind immer wieder Anlaß zu guten, richtigen, nützlichen Gedanken. Aber da ebendieses Gute, Richtige, Nützliche Absicht und Ziel solcher Begegnungen ist, bleiben auch sie etwas flach im Ganzen des Romans. Wie nach einem diskret verborgenen Lehrplan, dem man Tendenzen und Mühen anmerkt, wird dieses Begegnen veranstaltet, bei dem allein schon die Vielfalt der Werke ihrer Wirkung in die Quere kommt, und von der existentiellen Wucht, mit dem Shakespeares Hamlet den jungen Wilhelm Meister trifft, ist hier gewiß nichts zu spüren.
Ähnlich absichtsvoll sind im Grunde auch die Fäden der Zeitgeschichte und der unmittelbaren deutschen Vergangenheit hineingewebt. Nicht daß Ulla Hahn aufdringlich und grob auf das politisch Korrekte aus wäre. Dazu ist sie eine viel zu sensitive Künstlerin. Aber man kann sich dennoch nicht des Eindrucks erwehren, daß Lessings Nathan, daß Abel, der Junge mit der Schiebermütze, ein Zigeuner oder der Lehrer Rosenbaum da sind, weil sie einfach da sein müssen, also in das Leben der jungen Heldin notwendig gehören, sondern weil sie von der Autorin um des Guten, Richtigen, Nützlichen willen erst ihr Existenzrecht erhalten haben.
Ulla Hahns Roman ist ein Buch aus der rheinischen Tiefebene, durchsetzt von deren Dialekt, der zusammengerechnet wohl kaum weniger als ein Fünftel des fast sechshundertseitigen Buches ausmacht. Ein Glossar am Ende verzeichnet einiges aus dem Plattdeutsch dieser Landschaft. Darin wird das Wort "Müppe" als "Asoziale" definiert, im Buche selbst hingegen genereller als jemand, der im Dorf nicht dazugehörte: "Es gab eingeborene, dreckige Müppen, evangelische Müppen und die Flüchtlingsmüppen aus der kalten Heimat." Der Rezensent muß gestehen, daß er, hätte es ihn in Ulla Hahns fiktives Dondorf verschlagen, ganz sicher unter die Kategorie der Müppen gerechnet worden wäre. Das bedeutet allerdings auch, daß zu ihm und seinesgleichen dieses Buch nicht im gleichen Maße reden kann wie zu denjenigen, die seine Sprache sprechen.
Das ist das Handicap aller Heimatliteratur und Dialektdichtung. Auch Fritz Reuter oder Ludwig Thoma, das Ohnsorg-Theater oder der Komödienstadl sind nicht jedermanns Sache. Und Gerhart Hauptmann? Gerade im Vergleich mit ihm werden die Grenzen von Ulla Hahns Buch noch einmal erkennbar. Hauptmanns "Dialekt" ist in Wirklichkeit Soziolekt; keine seiner Gestalten spricht die gleiche Sprache, immer enthüllt sich in den mit großer Genauigkeit differenzierenden dialektischen oder umgangssprachlichen Eigenheiten seiner Weber, Fabrikarbeiter oder Beamten ihre Persönlichkeit in ihrer Herkunft und ihrem sozialen Umfeld. Hier aber herrscht linguistisches Kolorit, und die Fußnoten oder Glossare vermögen dazu nicht mehr zu tun, als Wortbedeutung zu dolmetschen.
Und dennoch: Mit diesem Roman hat sich die Lyrikerin Ulla Hahn als Epikerin etabliert. Fern von Thesenhaftigkeit wie von verkrampfter Originalitätssucht hat sie kräftig zupackend und zugleich feinnervig eine deutsche Geschichte erzählt und damit Selbsterfahrenem Sinn zu geben versucht: "Im Lichte des hellen Geistes verstand ich alles. Die Schönheit war der Schlüssel, die Schönheit der Ordnung, des Sinns. Bestimmung der Buchstaben war es, Wort zu werden, Zweck des Wortes war der Sinn, wer im Wort war, war im Sinn."
Es ist müßig zu fragen, inwieweit die Lebensgeschichte der Hilla Palm derjenigen der Ulla Hahn entspricht. Die Freiheit gegenüber den Gestalten und dem Geschehen des Buches darf sich die Autorin vorbehalten, wenn sie nicht Anspruch auf eine Autobiographie erhebt. Aber gelegentlich darf sie wohl auch bedeutsames Spiel mit den Gestalten treiben. Hilde Palm ist der bürgerliche Name der Lyrikerin Hilde Domin, die sich ihren Künstlernamen aus Dankbarkeit für die Dominikanische Republik gab, weil dieses Land der aus Deutschland Vertriebenen einst Asyl gewährte. 1992 erhielt Hilde Domin den Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg; Ulla Hahn hielt ihr damals die Laudatio. Falls hier eine stille Dedikation vermutet werden dürfte, wäre das nicht das Unbedeutendste, was es in diesem Buch zu entdecken gäbe.
Ulla Hahn: "Das verborgene Wort". Roman. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, München 2001. 595 S., geb., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Frontal betrachtet ist dieses dicke Buch ein Stück deutscher Heimatgeschichte, nicht unähnlich jener Filmsaga aus dem Hunsrück, mit der Edgar Reitz vor Jahren das Fernsehpublikum weit über die deutschen Grenzen hinaus in seinen Bann zog. Reich an Personen, an Großeltern, Eltern, Kindern, Tanten, Onkeln, Geschwistern, an Kranken und Gesunden, an Priestern, Lehrern, Flüchtlingen, Fremdarbeitern, Fließbandarbeiterinnen, Sekretärinnen und ihren Chefs ist Ulla Hahns kleine Welt, die sich in großem Detail, lebhaft und leibhaftig, entfaltet. Kirmes, Hochzeit, Beerdigung sind Höhepunkte im Alltag, der von den Riten der Kirche durchdrungen ist. Katholische Wundergläubigkeit beschränkt die Köpfe, die Lehre vom erbsündigen Menschen macht selbst das Töpfchensitzen des Kindes zu einem Gott wohlgefälligen Akt, und der geile Kaplan gehört als Phänotyp wie selbstverständlich dazu.
Hie und da dringt ein Hauch Nachkriegszeit in Ulla Hahns epische Heimat, obwohl die große Politik und das goldglänzende Wirtschaftswunder nur ganz selten hindurchscheinen. Aber immerhin vollzieht sich die Entwicklung dieses kleinen Mädchens vor dem Hintergrund des wieder zu Selbstbewußtsein drängenden westdeutschen Staates. Fokus bleibt zwar stets das Leben dieser Hildegard - später "Hilla" - Palm, aber ihr Leben nimmt dennoch so etwas wie symbolische Züge für den deutschen Drang zu einem neuen Selbstwertgefühl an, nur daß es sich in ihr als Sehnsucht nach einer Neugründung im Kulturell-Geistigen, nicht im Materiellen äußert. Darin liegt wohl das Bedeutendste und Attraktivste dieses Romans.
Für Hilla Palm ist es ein Weg aus einer nahezu analphabetischen Sphäre zu den Buchstaben und in die Literatur. Wie das im einzelnen inszeniert wird, wie das kleine Kind aus Steinen Geschichten herausliest, nach dem Verhältnis von Worten und Dingen sucht und in Märchen die Magie der Sprache entdeckt oder aber als intelligente Schülerin leiden muß, das ist mit so viel Feingefühl und Beobachtungsreichtum dargestellt, daß allein dies schon reichen Lohn für die Ausdauer bei der Lektüre des Buches darstellt. "Zauberworte mußte man wissen, damit Felsen sich öffneten, Steine zu Menschen wurden . . ." Es ist nicht schwer, daraus ein Stück Initiation der Lyrikerin Ulla Hahn herauszulesen, der dann die Einweihung der Schriftstellerin und Germanistin in die Literaturgeschichte folgt. Denn Hilla Palm erschließt sich lesend die Werke von Lessing, Goethe, Schiller, Kleist, Keller, Heine, Rilke und der Droste: "Bücher starben nicht", waren resistent gegen die Vergänglichkeit, deren unerklärliche und erbarmungslose Macht dem Kind nach und nach bewußt wird. Ein Bildungsroman also?
Das wohl nicht, sondern allenfalls ein Entwicklungs- oder, besser noch, ein Auswicklungsroman, denn nicht so sehr in der Wechselwirkung von Welt und Ich vollzieht sich der Werdegang dieses jungen Mädchens, sondern eher als Durchsetzung von etwas in ihr Angelegtem. So zumindest gibt es uns die erwachsene Erzählerin zu verstehen, deren Perspektive im zurückhaltenden, oft nur implizierten Deuten des einen oder anderen Geschehens spürbar wird, obwohl ein Kind spricht, dem vieles noch unverständlich bleiben muß. Geht man also neugierig ein wenig weiter um Ulla Hahns Buch herum und betrachtet seine epische Fülle von der Seite, dann erscheint das alles doch ein wenig flach. So stark die episodische Buntheit rheinischen Lebens wirkt - in seiner Summe bleibt es die Enge eines Heimatromans, die dieses Buch prägt, fernab von den Lehrjahren eines Wilhelm Meister, die uns in ein ganzes Zeitalter voller großer geschichtlicher Bewegung hineinblicken lassen, und fernab auch von den intellektuellen Höhen eines Zauberbergs.
Nicht daß diesem Buch Intellektuelles fehlte. Gerade die Begegnungen der jungen Hilla mit der Literatur sind immer wieder Anlaß zu guten, richtigen, nützlichen Gedanken. Aber da ebendieses Gute, Richtige, Nützliche Absicht und Ziel solcher Begegnungen ist, bleiben auch sie etwas flach im Ganzen des Romans. Wie nach einem diskret verborgenen Lehrplan, dem man Tendenzen und Mühen anmerkt, wird dieses Begegnen veranstaltet, bei dem allein schon die Vielfalt der Werke ihrer Wirkung in die Quere kommt, und von der existentiellen Wucht, mit dem Shakespeares Hamlet den jungen Wilhelm Meister trifft, ist hier gewiß nichts zu spüren.
Ähnlich absichtsvoll sind im Grunde auch die Fäden der Zeitgeschichte und der unmittelbaren deutschen Vergangenheit hineingewebt. Nicht daß Ulla Hahn aufdringlich und grob auf das politisch Korrekte aus wäre. Dazu ist sie eine viel zu sensitive Künstlerin. Aber man kann sich dennoch nicht des Eindrucks erwehren, daß Lessings Nathan, daß Abel, der Junge mit der Schiebermütze, ein Zigeuner oder der Lehrer Rosenbaum da sind, weil sie einfach da sein müssen, also in das Leben der jungen Heldin notwendig gehören, sondern weil sie von der Autorin um des Guten, Richtigen, Nützlichen willen erst ihr Existenzrecht erhalten haben.
Ulla Hahns Roman ist ein Buch aus der rheinischen Tiefebene, durchsetzt von deren Dialekt, der zusammengerechnet wohl kaum weniger als ein Fünftel des fast sechshundertseitigen Buches ausmacht. Ein Glossar am Ende verzeichnet einiges aus dem Plattdeutsch dieser Landschaft. Darin wird das Wort "Müppe" als "Asoziale" definiert, im Buche selbst hingegen genereller als jemand, der im Dorf nicht dazugehörte: "Es gab eingeborene, dreckige Müppen, evangelische Müppen und die Flüchtlingsmüppen aus der kalten Heimat." Der Rezensent muß gestehen, daß er, hätte es ihn in Ulla Hahns fiktives Dondorf verschlagen, ganz sicher unter die Kategorie der Müppen gerechnet worden wäre. Das bedeutet allerdings auch, daß zu ihm und seinesgleichen dieses Buch nicht im gleichen Maße reden kann wie zu denjenigen, die seine Sprache sprechen.
Das ist das Handicap aller Heimatliteratur und Dialektdichtung. Auch Fritz Reuter oder Ludwig Thoma, das Ohnsorg-Theater oder der Komödienstadl sind nicht jedermanns Sache. Und Gerhart Hauptmann? Gerade im Vergleich mit ihm werden die Grenzen von Ulla Hahns Buch noch einmal erkennbar. Hauptmanns "Dialekt" ist in Wirklichkeit Soziolekt; keine seiner Gestalten spricht die gleiche Sprache, immer enthüllt sich in den mit großer Genauigkeit differenzierenden dialektischen oder umgangssprachlichen Eigenheiten seiner Weber, Fabrikarbeiter oder Beamten ihre Persönlichkeit in ihrer Herkunft und ihrem sozialen Umfeld. Hier aber herrscht linguistisches Kolorit, und die Fußnoten oder Glossare vermögen dazu nicht mehr zu tun, als Wortbedeutung zu dolmetschen.
Und dennoch: Mit diesem Roman hat sich die Lyrikerin Ulla Hahn als Epikerin etabliert. Fern von Thesenhaftigkeit wie von verkrampfter Originalitätssucht hat sie kräftig zupackend und zugleich feinnervig eine deutsche Geschichte erzählt und damit Selbsterfahrenem Sinn zu geben versucht: "Im Lichte des hellen Geistes verstand ich alles. Die Schönheit war der Schlüssel, die Schönheit der Ordnung, des Sinns. Bestimmung der Buchstaben war es, Wort zu werden, Zweck des Wortes war der Sinn, wer im Wort war, war im Sinn."
Es ist müßig zu fragen, inwieweit die Lebensgeschichte der Hilla Palm derjenigen der Ulla Hahn entspricht. Die Freiheit gegenüber den Gestalten und dem Geschehen des Buches darf sich die Autorin vorbehalten, wenn sie nicht Anspruch auf eine Autobiographie erhebt. Aber gelegentlich darf sie wohl auch bedeutsames Spiel mit den Gestalten treiben. Hilde Palm ist der bürgerliche Name der Lyrikerin Hilde Domin, die sich ihren Künstlernamen aus Dankbarkeit für die Dominikanische Republik gab, weil dieses Land der aus Deutschland Vertriebenen einst Asyl gewährte. 1992 erhielt Hilde Domin den Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg; Ulla Hahn hielt ihr damals die Laudatio. Falls hier eine stille Dedikation vermutet werden dürfte, wäre das nicht das Unbedeutendste, was es in diesem Buch zu entdecken gäbe.
Ulla Hahn: "Das verborgene Wort". Roman. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, München 2001. 595 S., geb., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
»Ein wichtiges, schönes, schreckliches Buch über das Erwachsenwerden, Wachwerden, Menschwerden.« (Erdmute Klein im Rheinischen Merkur)
»Was bleibt und überwiegt, ist Bewunderung: […] für den beeindruckenden, streckenweise überwältigenden Roman, der aus dem nährstoffarmen Boden dieser Provinz erwachsen konnte.« (Martin Ebel in der Neuen Zürcher Zeitung)
»Eine dicht erzählte Geschichte, die nie langatmig wird, die bis in die Lebensentwürfe der Nebenfiguren hinein brillant konstruiert ist. Klug und sprachlich wunderschön. Ein Roman, an dem die Lyrikerin Ulla Hahn viele Jahre gearbeitet hat und für den sich jede Stunde Lesezeit lohnt.« (Brigitte extra - Buchspecial)
»Dieser Roman hat ein schlagend wirkliches Herz und ein
»Was bleibt und überwiegt, ist Bewunderung: […] für den beeindruckenden, streckenweise überwältigenden Roman, der aus dem nährstoffarmen Boden dieser Provinz erwachsen konnte.« (Martin Ebel in der Neuen Zürcher Zeitung)
»Eine dicht erzählte Geschichte, die nie langatmig wird, die bis in die Lebensentwürfe der Nebenfiguren hinein brillant konstruiert ist. Klug und sprachlich wunderschön. Ein Roman, an dem die Lyrikerin Ulla Hahn viele Jahre gearbeitet hat und für den sich jede Stunde Lesezeit lohnt.« (Brigitte extra - Buchspecial)
»Dieser Roman hat ein schlagend wirkliches Herz und ein
Mehr anzeigen
Charaktergesicht. Und während der Rhein im Hintergrund dahinströmt und mit dem Reichtum des Inhalts beinahe über die Buchdeckel schwappt, wird hier eine deutsche Geschichte erzählt im Format eines großartigen Mädchens.« (Tanja Jeschke in der Stuttgarter Zeitung)
»Dieser Erziehungs- und Bildungsroman ist eine wunderbare Lektüre. Wer hätte gedacht, dass das Schiller’sche Pathos von der Freiheit der Gedanken noch einmal so überzeugen könnte wie in diesem Roman über ›dat Heldejaad‹ aus Dondorf, das sich befreit aus der lieblosen, knechtenden Enge eines proletarischen Haushalts mit der Kraft des Wortes?« (Stuttgarter Nachrichten)
»Und warum interessiert diese ellenlange Geschichte von 600 Seiten? Weil in diesen Zeiten der Kurznachrichten und Schnellschreiberei, der hastigen Meinungen und hohlen Polemiken diese Ausführlichkeit das Herz wärmt […] Ein unübertreffliches Sittengemälde.« (Jürgen Flimm in der Woche)
»Wie das kleine Kind aus Steinen Geschichten herausliest, nach dem Verhältnis von Worten und Dingen sucht und in Märchen die Magie der Sprache entdeckt oder aber als intelligente Schülerin leiden muß, das ist mit so viel Feingefühl und Beobachtungsreichtum dargestellt, daß allein diese schon reichen Lohn für die Ausdauer bei der Lektüre des Buches darstellt.« (Gerhard Schulz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung)
»Wegen seiner Lebensfülle und seines authentischen Zeitkolorits vermag der Text in seinen Bann zu schlagen. Und wegen des Leidensdrucks, der sich mit liebevoller, nie gehässiger Ironie und Situationskomik zur Geschichte eines persönlichen Triumphes verbindet.« (Katrin Hillgruber in der Badischen Zeitung)
»Dieser Erziehungs- und Bildungsroman ist eine wunderbare Lektüre. Wer hätte gedacht, dass das Schiller’sche Pathos von der Freiheit der Gedanken noch einmal so überzeugen könnte wie in diesem Roman über ›dat Heldejaad‹ aus Dondorf, das sich befreit aus der lieblosen, knechtenden Enge eines proletarischen Haushalts mit der Kraft des Wortes?« (Stuttgarter Nachrichten)
»Und warum interessiert diese ellenlange Geschichte von 600 Seiten? Weil in diesen Zeiten der Kurznachrichten und Schnellschreiberei, der hastigen Meinungen und hohlen Polemiken diese Ausführlichkeit das Herz wärmt […] Ein unübertreffliches Sittengemälde.« (Jürgen Flimm in der Woche)
»Wie das kleine Kind aus Steinen Geschichten herausliest, nach dem Verhältnis von Worten und Dingen sucht und in Märchen die Magie der Sprache entdeckt oder aber als intelligente Schülerin leiden muß, das ist mit so viel Feingefühl und Beobachtungsreichtum dargestellt, daß allein diese schon reichen Lohn für die Ausdauer bei der Lektüre des Buches darstellt.« (Gerhard Schulz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung)
»Wegen seiner Lebensfülle und seines authentischen Zeitkolorits vermag der Text in seinen Bann zu schlagen. Und wegen des Leidensdrucks, der sich mit liebevoller, nie gehässiger Ironie und Situationskomik zur Geschichte eines persönlichen Triumphes verbindet.« (Katrin Hillgruber in der Badischen Zeitung)
Schließen
"Was bleibt und überwiegt, ist Bewunderung: [...] für den beeindruckenden, streckenweise überwältigenden Roman, der aus dem nährstoffarmen Boden dieser Provinz erwachsen konnte." Martin Ebel in der 'Neuen Zürcher Zeitung'
"Eine dicht erzählte Geschichte, die nie langatmig wird, die bis in die Lebensentwürfe der Nebenfiguren hinein brillant konstruiert ist. Klug und sprachlich wunderschön. Ein Roman, an dem die Lyrikerin Ulla Hahn viele Jahre gearbeitet hat und für den sich jede Stunde Lesezeit lohnt." Birgitte extra (Buchspecial)
"Wer wissen will, wozu Literatur im Stande ist, der kann es sich von diesem Roman zeigen lassen." Sandra Leis im 'Bund'
"Dieser Roman hat ein schlagend wirkliches Herz und ein
"Eine dicht erzählte Geschichte, die nie langatmig wird, die bis in die Lebensentwürfe der Nebenfiguren hinein brillant konstruiert ist. Klug und sprachlich wunderschön. Ein Roman, an dem die Lyrikerin Ulla Hahn viele Jahre gearbeitet hat und für den sich jede Stunde Lesezeit lohnt." Birgitte extra (Buchspecial)
"Wer wissen will, wozu Literatur im Stande ist, der kann es sich von diesem Roman zeigen lassen." Sandra Leis im 'Bund'
"Dieser Roman hat ein schlagend wirkliches Herz und ein
Mehr anzeigen
Charaktergesicht. Und während der Rhein im Hintergrund dahinströmt und mit dem Reichtum des Inhalts beinahe über die Buchdeckel schwappt, wird hier eine deutsche Geschichte erzählt im Format eines großartigen Mädchens." Tanja Jeschke in der 'Stuttgarter Zeitung'
"Ein faszinierendes, wunderschön geschriebenes Buch, das dem 'geheimen Orden' [der Leser] neuen Zulauf bescheren könnte." Duglore Pizzini in der 'Presse'
"Dieser Erziehungs- und Bildungsroman ist eine wunderbare Lektüre. Wer hätte gedacht, dass das Schiller'sche Pathos von der Freiheit der Gedanken noch einmal so überzeugen könnte wie in diesem Roman über 'dat Heldejaad' aus Dondorf, das sich befreit aus der lieblosen, knechtenden Enge eines proletarischen Haushalts mit der Kraft des Wortes?" Stuttgarter Nachrichten
"Und warum interessiert diese ellenlange Geschichte von 600 Seiten? Weil in diesen Zeiten der Kurznachrichten und Schnellschreiberei, der hastigen Meinungen und hohlen Polemiken diese Ausführlichkeit das Herz wärmt [...] Ein unübertreffliches Sittengemälde." Jürgen Flimm in der 'Woche'
"Wie das kleine Kind aus Steinen Geschichten herausliest, nach dem Verhältnis von Worten und Dingen sucht und in Märchen die Magie der Sprache entdeckt oder aber als intelligente Schülerin leiden muß, das ist mit so viel Feingefühl und Beobachtungsreichtum dargestellt, daß allein diese schon reichen Lohn für die Ausdauer bei der Lektüre des Buches darstellt." Gerhard Schulz in der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung'
"Wegen seiner Lebensfülle und seines authentischen Zeitkolorits vermag der Text in seinen Bann zu schlagen. Und wegen des Leidensdrucks, der sich mit liebevoller, nie gehässiger Ironie und Situationskomik zur Geschichte eines persönlichen Triumphes verbindet." Katrin Hillgruber in der 'Badischen Zeitung' Lesermeinung (amazon.de):
"Welche Kraft und welch' Ausdruck die deutsche Sprache besitzen kann! Es ist schon erstaunlich, wie eine Schriftstellerin aus Banalitäten des Alltags eine sinnesraubende Wortzauberei erschafft. Der Roman ist über große Strecken an Poesie kaum zu übertreffen und sucht in der zeitgenössischen Literatur Vergleichbares! Ulla Hahns Roman ist eine wunderbare, über Strecken schmerzhafte Beschreibung des Lebens, Fühlens und Denkens eines Kindes der 50er Jahre. Geht oder ging es mir in den 60er Jahren, der heutigen Generation, anders? Das bisschen Kölsch stört nicht! Ganz im Gegenteil: Die Wortklaubereien manch anderer, oftmals preisüberhäufter, Schriftsteller/innen werden ad absurdum geschrieben! Ein wunderbarer Roman! Auf diesem Wege mein Dank für viele Stunden intensiven Lesens, Verstehenlernens und der Genugtuung, endlich eine der deutschen Sprache mächtigen Schriftstellerin gefunden zu haben. Liebe Ulla Hahn: Wann folgt die Fortsetzung? Mit 14 oder 15 Jahren fängt das Leben doch erst an!"
"Ein faszinierendes, wunderschön geschriebenes Buch, das dem 'geheimen Orden' [der Leser] neuen Zulauf bescheren könnte." Duglore Pizzini in der 'Presse'
"Dieser Erziehungs- und Bildungsroman ist eine wunderbare Lektüre. Wer hätte gedacht, dass das Schiller'sche Pathos von der Freiheit der Gedanken noch einmal so überzeugen könnte wie in diesem Roman über 'dat Heldejaad' aus Dondorf, das sich befreit aus der lieblosen, knechtenden Enge eines proletarischen Haushalts mit der Kraft des Wortes?" Stuttgarter Nachrichten
"Und warum interessiert diese ellenlange Geschichte von 600 Seiten? Weil in diesen Zeiten der Kurznachrichten und Schnellschreiberei, der hastigen Meinungen und hohlen Polemiken diese Ausführlichkeit das Herz wärmt [...] Ein unübertreffliches Sittengemälde." Jürgen Flimm in der 'Woche'
"Wie das kleine Kind aus Steinen Geschichten herausliest, nach dem Verhältnis von Worten und Dingen sucht und in Märchen die Magie der Sprache entdeckt oder aber als intelligente Schülerin leiden muß, das ist mit so viel Feingefühl und Beobachtungsreichtum dargestellt, daß allein diese schon reichen Lohn für die Ausdauer bei der Lektüre des Buches darstellt." Gerhard Schulz in der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung'
"Wegen seiner Lebensfülle und seines authentischen Zeitkolorits vermag der Text in seinen Bann zu schlagen. Und wegen des Leidensdrucks, der sich mit liebevoller, nie gehässiger Ironie und Situationskomik zur Geschichte eines persönlichen Triumphes verbindet." Katrin Hillgruber in der 'Badischen Zeitung' Lesermeinung (amazon.de):
"Welche Kraft und welch' Ausdruck die deutsche Sprache besitzen kann! Es ist schon erstaunlich, wie eine Schriftstellerin aus Banalitäten des Alltags eine sinnesraubende Wortzauberei erschafft. Der Roman ist über große Strecken an Poesie kaum zu übertreffen und sucht in der zeitgenössischen Literatur Vergleichbares! Ulla Hahns Roman ist eine wunderbare, über Strecken schmerzhafte Beschreibung des Lebens, Fühlens und Denkens eines Kindes der 50er Jahre. Geht oder ging es mir in den 60er Jahren, der heutigen Generation, anders? Das bisschen Kölsch stört nicht! Ganz im Gegenteil: Die Wortklaubereien manch anderer, oftmals preisüberhäufter, Schriftsteller/innen werden ad absurdum geschrieben! Ein wunderbarer Roman! Auf diesem Wege mein Dank für viele Stunden intensiven Lesens, Verstehenlernens und der Genugtuung, endlich eine der deutschen Sprache mächtigen Schriftstellerin gefunden zu haben. Liebe Ulla Hahn: Wann folgt die Fortsetzung? Mit 14 oder 15 Jahren fängt das Leben doch erst an!"
Schließen
"Ulla Hahn schrieb ein Buch, das autobiografische Züge enthält - ein wichtiges, schönes und schreckliches Buch über das Erwachsenwerden, Wachwerden und Menschwerden."
Blickwechsel November 2008
Blickwechsel November 2008
»>Das verborgene Wort< spiegelt wie kaum ein anderer Zeitroman die kulturelle Atmosphäre der fünfziger Jahre.« Die Zeit
Ein trauriges Buch übers erwachsen werden einer
Hochbegabten Frau in der Nachkriegszeit. Es ist mir schwer gefallen weil Kölnich eben nicht Hochdeutsch ist, habe ich aber im nachhinein doch noch kapiert. Werde es deshalb nochmal lesen.
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
„Lommer jon!“, so beginnt die Geschichte von Hildegard, die in einem fiktiven Dorf im Rheinland im Nachkriegsdeutschland der 50er Jahre aufwächst. Die erzkatholische Enge, der Vater, der Schläge großzügiger verteilt als Liebe und die Großmutter, die Hildegard …
Mehr
„Lommer jon!“, so beginnt die Geschichte von Hildegard, die in einem fiktiven Dorf im Rheinland im Nachkriegsdeutschland der 50er Jahre aufwächst. Die erzkatholische Enge, der Vater, der Schläge großzügiger verteilt als Liebe und die Großmutter, die Hildegard fortlaufend Teufelsbraten nennt und das auch ziemlich wörtlich meint, drohen Hildegard zu brechen. Wäre da nicht der Großvater, der Hildegard immer wieder kleine Inseln der Flucht ermöglicht und ihr mit seinen Geschichten die Welt der Wörter eröffnet, die Hildegard fortan Rückhalt und Trost geben. Als der Großvater stirbt bricht für Hildegard eine Welt zusammen. Jeglicher Lichtblick scheint verloren und noch mehr als vorher macht sich der bedrückende katholische Dorfmief in Hildegards Leben breit. Als ihr Volksschullehrer schließlich ihre große Intelligenz erfasst und den Eltern rät, sie aufs Gymnasium zu schicken, rastet der Vater aus. Er kann einfach nicht damit umgehen, dass sein Kind („das Kind eines Proleten“) etwas besseres sein soll. Ihr Leseeifer, ihre Bücher und ihre hochdeutsche Aussprache passen einfach nicht in sein Weltbild. Hart erkämpft sich Hildegard das Recht, wenigstens die Realschule besuchen zu dürfen. Als sie nach der Schulzeit eine Lehrstelle im Büro einer Fabrik annehmen muss (für ihres Vaters Verhältnisse das höchste der Gefühle), droht das Mädchen vollends zu zerbrechen und verfällt dem Alkohol. Wird Hildegard es schaffen sich zu befreien und endlich IHREN Weg zu gehen?<br />Der rheinische Dialekt wird dem ein oder anderen sicher zu Anfang ein bisschen zu schaffen machen, aber die Mühe lohnt in jedem Fall.
Lange schon hatte mich kein Buch mehr so berührt. Lange schon war kein Buch mehr so wahr.
Es ist ein Buch, das in erster Linie von Freiheit handelt. Von Freiheit und von dem, was der Wunsch nach Freiheit möglich macht.
Es handelt von einem freien Geist, der in Schranken gebracht wird, nur um unvermittelt und stärker als je zuvor auszubrechen.
Ich kann nur jedem raten es zu lesen. Ich habe keine Minute bereut und werde es sicher auch noch mal lesen. Kein anderes Buch hat ein, für mich, deutlicheres Zeitbild gezeichnet.
"Lommer jon!"
Weniger
Antworten 10 von 12 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 10 von 12 finden diese Rezension hilfreich
Erzählt wird die Kindheit und Jugend Hildegards, ein "Teufelsbraten" und ein "Traumtopf", phantasiereiches Kind, dessen Willensstärke von der eigenen Familie fast gebrochen wird. Von körperlichen und seelischen Misshandlungen gezeichnet, befreit sie sich …
Mehr
Erzählt wird die Kindheit und Jugend Hildegards, ein "Teufelsbraten" und ein "Traumtopf", phantasiereiches Kind, dessen Willensstärke von der eigenen Familie fast gebrochen wird. Von körperlichen und seelischen Misshandlungen gezeichnet, befreit sie sich schließlich aus ihrer bigotten Familie und den Fesseln ihrer Herkunft und findet ihren eigenen Weg.
Ein Werdegang der eindrucksvoll eine negative Sparte im katholischen Glauben aufzeigt, anhand dessen man sich als Leser und guter Christ fragt, wie viele junge Menschen wohl an einer solchen "Erziehung" gebrochen sind? Ein Drama mit wunderbaren Passagen, voller Emotionen und Hoffnungen, rasant, jedoch warmherzig erzählt und absolut lesenswert!
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Ein Buch, bei dem ich vollkommen hin und her gerissen bin. Hin und her gerissen zwischen der Faszination der Geschichte und den für mich nervigen Stilelementen der Autorin.
Hauptkritikpunkt ist: Der Gebrauch des für die meisten Ohren grauenhaften rheinischen Dialektes in der …
Mehr
Ein Buch, bei dem ich vollkommen hin und her gerissen bin. Hin und her gerissen zwischen der Faszination der Geschichte und den für mich nervigen Stilelementen der Autorin.
Hauptkritikpunkt ist: Der Gebrauch des für die meisten Ohren grauenhaften rheinischen Dialektes in der wörtlichen Rede. Ist dieser schon akustisch für das ungeübte Ohr schwer zu verstehen, wird es zur mühsamen Buchstabiererei, soll man solchen auch noch lesen. Die teilweisen Übersetzungen in den Fußnoten machen es nicht unbedingt besser, stören sie doch ebenso sehr den Lesefluss.
In aller Regel mag ich viel wörtliche Rede in Erzählungen, da diese die Geschichte lebendiger gestalten. Hier jedoch war ich froh um jeden Satz, der ohne auskommt.
Zweiter großer Kritikpunkt sind die ausschweifenden und langatmigen Beschreibungen, in denen sich die Autorin gerne ergeht. So schafft sie es z.B. einmal über eine halbe Seite im Detail die Einrichtung eines Wohnzimmers zu beschreiben. Möglicherweise ist es ja das, was man Ulla Hahn als großes lyrisches Talent zuspricht. Vielleicht habe ich einfach keinen Sinn für Lyrik, aber auf mich wirken Ulla Hahns Ausschweifungen einfach wie ein krampfhafter Versuch, lyrisch zu sein, was aber in zähes Geschwafel abdriftet. Auch das macht das Lesen des Buches nicht unbedingt kurzweiliger.
Weiterhin hat mich gestört, dass öfter mal der Satzbau schlicht und ergreifend falsch ist. Und hier kann man das nicht mal auf den Übersetzer schieben. Oft genug werden hierdurch Ulla Hahns Aussagen missverständlich und man weiß nicht so genau, was sie eigentlich will. Ich habe die Stellen dann immer wieder gelesen, in der Hoffnung den Sinn doch noch zu erfassen, aber manche Sätze bleiben auch nach dem 5. Lesen einfach falsch.
Die Geschichte, die Ulla Hahn erzählt, hat mir sehr gut gefallen, wenngleich mich die teilweise doch überzogen dargestellte Glorifizierung der Protagonistin etwas abgestoßen hat – umso mehr, da der Roman ja stark autobiografisch geprägt sein soll.
Ähnlich wie in „Tannöd“ wird übertriebener Katholizismus aufs Korn genommen und die Identifikation und Rechtfertigung der angeblichen Gutmenschen durch ihren Glauben kritisiert. Auch hier wird gezeigt, dass Glauben und Ein-guter-Mensch-sein nicht gleichzusetzen ist mit blindem Glaubenseifer, Festhalten und stumpfen Ausführen an und von festgelegten Ritualen und der Verurteilung Andersdenkender. Christliche Nächstenliebe und Toleranz vom Feinsten....
Hillas Verständnis von Sexualität ist für uns aufgeklärte Menschen heute nicht mehr vorstellbar. Unglaublich, dass man früher junge Menschen so sich selbst überlassen hat. Hillas Naivität in dieser Frage ruft ein verwundertes Kopfschütteln hervor. Ich fragte mich andauernd, ob sie wohl irgendwann wissen wird, worum es geht?
Ausgesprochen gut gefallen hat mir, wie die Autorin den Kreis schließt: „Lommer jonn“. Das hätte aber für meinen Geschmack an rheinischem Dialekt vollkommen ausgereicht.
Noch ringe ich mit mir, ob ich den zweiten Teil der Geschichte „Aufbruch“ lesen soll. Einerseits interessiert mich schon, wie es mit Hilla weitergeht, aber ein zweites Mal möchte ich mir diesen Mix aus Möchtegern-Lyrik und Gruseldialekt eigentlich nicht antun. Mal sehen....
Fazit:
Das wäre ein durchaus empfehlenswertes Buch, würde sich Ulla Hahn einfach auf die durchaus erzählenswerte Geschichte beschränken, ihre lyrischen Ausschweifungen auf ein Minimum reduzieren und auf diesen unverständlichen Dialekt verzichten.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
„Lommer jon!“, so beginnt die Geschichte von Hildegard, die in einem fiktiven Dorf im Rheinland im Nachkriegsdeutschland der 50er Jahre aufwächst. Die erzkatholische Enge, der Vater, der Schläge großzügiger verteilt als Liebe und die Großmutter, die Hildegard …
Mehr
„Lommer jon!“, so beginnt die Geschichte von Hildegard, die in einem fiktiven Dorf im Rheinland im Nachkriegsdeutschland der 50er Jahre aufwächst. Die erzkatholische Enge, der Vater, der Schläge großzügiger verteilt als Liebe und die Großmutter, die Hildegard fortlaufend Teufelsbraten nennt und das auch ziemlich wörtlich meint, drohen Hildegard zu brechen. Wäre da nicht der Großvater, der Hildegard immer wieder kleine Inseln der Flucht ermöglicht und ihr mit seinen Geschichten die Welt der Wörter eröffnet, die Hildegard fortan Rückhalt und Trost geben. Als der Großvater stirbt bricht für Hildegard eine Welt zusammen. Jeglicher Lichtblick scheint verloren und noch mehr als vorher macht sich der bedrückende katholische Dorfmief in Hildegards Leben breit. Als ihr Volksschullehrer schließlich ihre große Intelligenz erfasst und den Eltern rät, sie aufs Gymnasium zu schicken, rastet der Vater aus. Er kann einfach nicht damit umgehen, dass sein Kind („das Kind eines Proleten“) etwas besseres sein soll. Ihr Leseeifer, ihre Bücher und ihre hochdeutsche Aussprache passen einfach nicht in sein Weltbild. Hart erkämpft sich Hildegard das Recht, wenigstens die Realschule besuchen zu dürfen. Als sie nach der Schulzeit eine Lehrstelle im Büro einer Fabrik annehmen muss (für ihres Vaters Verhältnisse das höchste der Gefühle), droht das Mädchen vollends zu zerbrechen und verfällt dem Alkohol. Wird Hildegard es schaffen sich zu befreien und endlich IHREN Weg zu gehen?<br />Der rheinische Dialekt wird dem ein oder anderen sicher zu Anfang ein bisschen zu schaffen machen, aber die Mühe lohnt in jedem Fall. Lange schon hatte mich kein Buch mehr so berührt. Lange schon war kein Buch mehr so wahr. Es ist ein Buch, das in erster Linie von Freiheit handelt. Von Freiheit und von dem, was der Wunsch nach Freiheit möglich macht. Es handelt von einem freien Geist, der in Schranken gebracht wird, nur um unvermittelt und stärker als je zuvor auszubrechen. Ich kann nur jedem raten es zu lesen. Ich habe keine Minute bereut und werde es sicher auch noch mal lesen. Kein anderes Buch hat ein, für mich, deutlicheres Zeitbild gezeichnet. "Lommer jon!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Hildegard Palm wächst in der Adenauer-Ära in einer rheinischen Kleinstadt auf. Ihre ungebildeten Eltern und Großeltern reagieren bis auf einen Großvater verständnislos auf die Fantasie und den Wissensdurst des Mädchens. Zuflucht findet Hildegard in Geschichten und …
Mehr
Hildegard Palm wächst in der Adenauer-Ära in einer rheinischen Kleinstadt auf. Ihre ungebildeten Eltern und Großeltern reagieren bis auf einen Großvater verständnislos auf die Fantasie und den Wissensdurst des Mädchens. Zuflucht findet Hildegard in Geschichten und Büchern. Ein Lehrer überredet die Eltern, sie wenigstens die mittlere Reife machen zu lassen. Durch den Besuch der Realschule entfremdet Hildegard sich noch mehr von ihrer Familie ...<br />"Das verborgene Wort" ist ein bewegender Entwicklungsroman und zugleich eine detailreiche Milieustudie. Ulla Hahn schreibt aus der subjektiven Perspektive der Hauptfigur. Das wirkt authentisch und tragikomisch.
"Das verborgene Wort" wurde von Hermine Huntgeburth unter dem Titel "Der Teufelsbraten" verfilmt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Nachdem ich als ersten Roman "Unscharfe Bilder" der Lyrikerin gelesen hatte war ich gespannt auf das "Verborgene Wort". Ich bin von der Sprachmächtigkeit der Schriftstellerin begeistert.
Sie ist nicht nur eine sehr gute Lyrikerin sondern auch eine hervorragende …
Mehr
Nachdem ich als ersten Roman "Unscharfe Bilder" der Lyrikerin gelesen hatte war ich gespannt auf das "Verborgene Wort". Ich bin von der Sprachmächtigkeit der Schriftstellerin begeistert.
Sie ist nicht nur eine sehr gute Lyrikerin sondern auch eine hervorragende Romanschriftstellerin.
Das "Verborgene Wort" ist ein Bildungsroman erster Güte.
Weniger
Antworten 1 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für