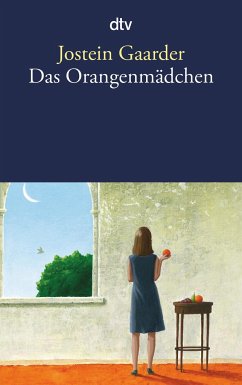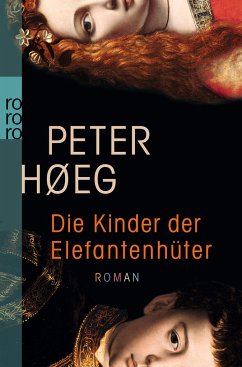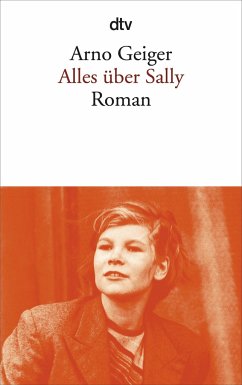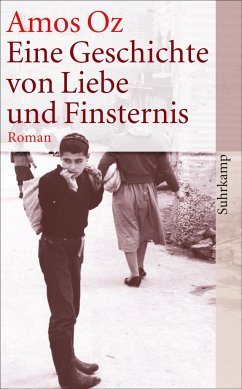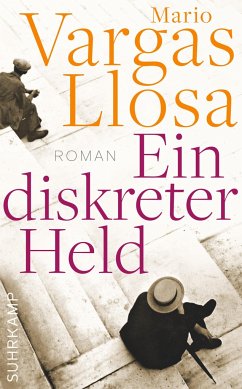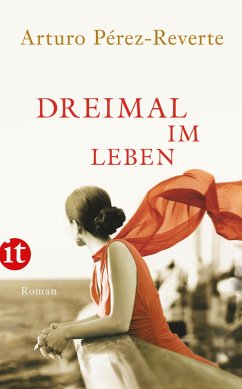Nicht lieferbar
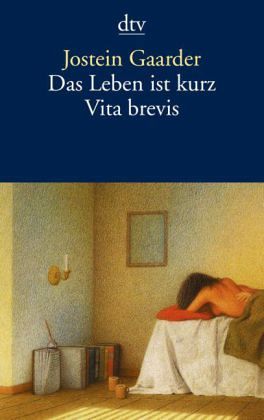
Das Leben ist kurz
Vita brevis. Nachw. v. Otto A. Böhmer
Übersetzung: Haefs, Gabriele
Was ist das für ein Brief, den Jostein Gaarder in einem Antiquariat in Buenos Aires entdeckt? Ist er tatsächlich von Augustinus?
Provokante Argumentationen gegen die kirchliche Moral
Was ist das für ein Brief, den Jostein Gaarder in einem Antiquariat in Buenos Aires entdeckt? Eine Fälschung? Oder eine Enthüllung? Wahr ist, daß der berühmte Kirchenvater Augustinus, an den der Brief gerichtet ist, viele Jahre lang eine Frau namens Floria liebte, einen Sohn mit ihr hatte und ihr dann plötzlich für seine Liebe zu Gott den Laufpaß gab. Wie mußte sich Floria da fühlen? Das erzählt der aufgefundene Brief, der ihren Namen als Absender trägt.
Floria fragt Augustinus: Warum ist alles, was zwischen uns war, plötzlich Sünde in deinen Augen? Warum ist die Frau diejenige, die verführt, und der Mann der Verführte? Warum schließt deine Liebe zu Gott jede Leidenschaft für eine Frau aus? In ihrer provokanten Argumentation rüttelt Floria an einer Moral, mit der sich die Männer bis heute - nicht nur in der Kirche - über die Frauen erheben.
Was ist das für ein Brief, den Jostein Gaarder in einem Antiquariat in Buenos Aires entdeckt? Eine Fälschung? Oder eine Enthüllung? Wahr ist, daß der berühmte Kirchenvater Augustinus, an den der Brief gerichtet ist, viele Jahre lang eine Frau namens Floria liebte, einen Sohn mit ihr hatte und ihr dann plötzlich für seine Liebe zu Gott den Laufpaß gab. Wie mußte sich Floria da fühlen? Das erzählt der aufgefundene Brief, der ihren Namen als Absender trägt.
Floria fragt Augustinus: Warum ist alles, was zwischen uns war, plötzlich Sünde in deinen Augen? Warum ist die Frau diejenige, die verführt, und der Mann der Verführte? Warum schließt deine Liebe zu Gott jede Leidenschaft für eine Frau aus? In ihrer provokanten Argumentation rüttelt Floria an einer Moral, mit der sich die Männer bis heute - nicht nur in der Kirche - über die Frauen erheben.