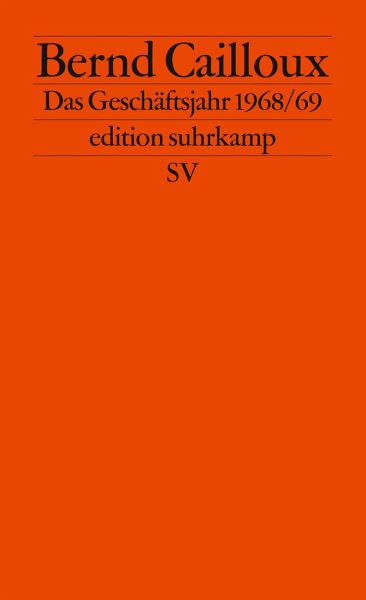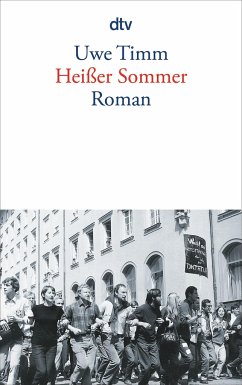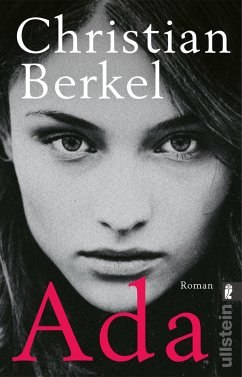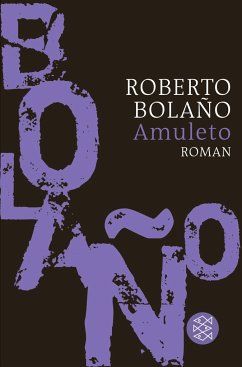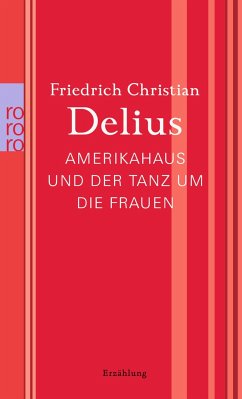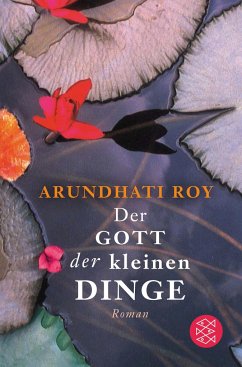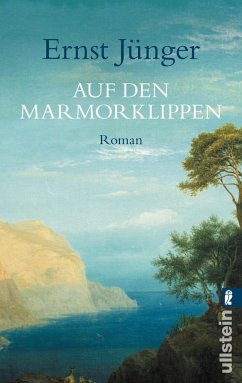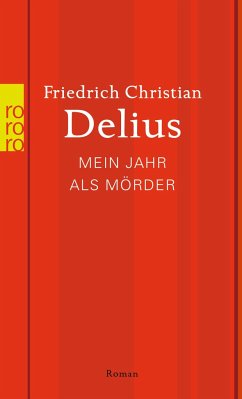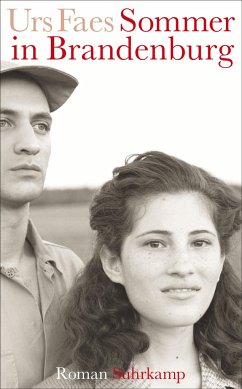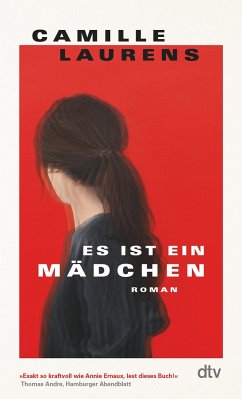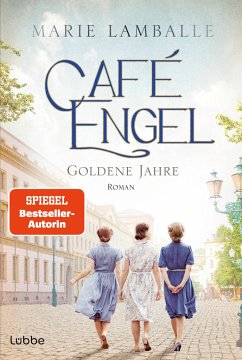Bernd Cailloux
Broschiertes Buch
Das Geschäftsjahr 1968/69
Roman. Originalausgabe. Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2005 (Longlist)
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





BRD, 1965. Auf einem Fortbildungslehrgang für Journalisten lernen sich zwei junge Männer kennen, die gleich spüren, daß sie Großes miteinander vorhaben. Doch noch bremst der Muff der Zeit: Die Schlammstrecke der allgemeinen Wehrpflicht will durchrobbt sein, der dahinter liegende Morast aus bürgerlicher Paarbeziehung und Provinzreporterdasein ebenso. Dann aber geht es Schlag auf Schlag: nach Düsseldorf, ins Beuys-Umfeld, die beiden Freunde gründen eine Hippie-Gartenlaubenfirma, in durchwachten Nächten wird das erste discoreife Stroboskop-Blitzlicht gebaut, Premiere in Hamburgs coolstem...
BRD, 1965. Auf einem Fortbildungslehrgang für Journalisten lernen sich zwei junge Männer kennen, die gleich spüren, daß sie Großes miteinander vorhaben. Doch noch bremst der Muff der Zeit: Die Schlammstrecke der allgemeinen Wehrpflicht will durchrobbt sein, der dahinter liegende Morast aus bürgerlicher Paarbeziehung und Provinzreporterdasein ebenso. Dann aber geht es Schlag auf Schlag: nach Düsseldorf, ins Beuys-Umfeld, die beiden Freunde gründen eine Hippie-Gartenlaubenfirma, in durchwachten Nächten wird das erste discoreife Stroboskop-Blitzlicht gebaut, Premiere in Hamburgs coolstem Psychedelic-Club, euphorische Verzückung, weiter zu den Essener Songtagen, Frank Zappa, Freakout-Pfingsten, fette Aufträge und der Traum vom antikapitalistischen Betrieb im Kapitalismus - das "Geschäftsjahr 1968/69" kommt in Fahrt.
Mit präziser Lakonie zeigt Bernd Cailloux die 68er in grellem, aber um so realistischerem Licht: nicht als Polit-, sondern als Start-up-Unternehmen, dessen Visionen, Illusionen, Drogen- und Finanzcrashs unvermutet an die Neunziger erinnern - wie das Technoflimmern an die Flickershows der Sixties.
Mit präziser Lakonie zeigt Bernd Cailloux die 68er in grellem, aber um so realistischerem Licht: nicht als Polit-, sondern als Start-up-Unternehmen, dessen Visionen, Illusionen, Drogen- und Finanzcrashs unvermutet an die Neunziger erinnern - wie das Technoflimmern an die Flickershows der Sixties.
Bernd Cailloux, Jahrgang 1945, lebt als freier Schriftsteller in Berlin.
Produktdetails
- edition suhrkamp 2408
- Verlag: SUHRKAMP
- Artikelnr. des Verlages: ES 2408
- 7. Aufl.
- Seitenzahl: 254
- Erscheinungstermin: Juni 2005
- Deutsch
- Abmessung: 177mm x 108mm x 17mm
- Gewicht: 234g
- ISBN-13: 9783518124086
- ISBN-10: 3518124080
- Artikelnr.: 13286738
Herstellerkennzeichnung
Suhrkamp Verlag
Torstraße 44
10119 Berlin
info@suhrkamp.de
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.10.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.10.2005Blitzchen der Subversion
Bernd Cailloux macht Geschäfte / Von Heinz Ludwig Arnold
Es hatte mit einer Spielerei begonnen. "Die Jungs aus der Werkstatt" hatten "aus purem Spaß . . . die Miniatur eines der starken Lichtblitzgeräte" gebaut, ein "Flashlight im Kleinstformat". Und drei junge Männer, Anfang Zwanzig und von unterschiedlichen Interessen geleitet, aber alle gemeinsam in der Aufbruchsstimmung, etwas ,machen' zu wollen, sind so fasziniert von dieser Maschine, die "rasante Wechsel von der Finsternis ins Überhelle" produziert und damit ins Zentrum der menschlichen Doppelnatur trifft, daß sie mit ihrer Herstellung das begründen, was man heute ein Start-up nennt: Andreas Büdinger organisiert das Ganze, Bekurz ist
Bernd Cailloux macht Geschäfte / Von Heinz Ludwig Arnold
Es hatte mit einer Spielerei begonnen. "Die Jungs aus der Werkstatt" hatten "aus purem Spaß . . . die Miniatur eines der starken Lichtblitzgeräte" gebaut, ein "Flashlight im Kleinstformat". Und drei junge Männer, Anfang Zwanzig und von unterschiedlichen Interessen geleitet, aber alle gemeinsam in der Aufbruchsstimmung, etwas ,machen' zu wollen, sind so fasziniert von dieser Maschine, die "rasante Wechsel von der Finsternis ins Überhelle" produziert und damit ins Zentrum der menschlichen Doppelnatur trifft, daß sie mit ihrer Herstellung das begründen, was man heute ein Start-up nennt: Andreas Büdinger organisiert das Ganze, Bekurz ist
Mehr anzeigen
der Elektrotechniker, und der namenlose Ich-Erzähler liefert den kritischen ideologischen Überbau - später wird er das so beschreiben: "Eigentlich hatten wir nichts Böses vor, nichts Kommerzielles wie Massenproduktion oder Werbeshows, wir wollten etwas völlig anderes, die radikale permanente Veränderung, jedenfalls keinen bürgerlich profitorientierten Laden, Teil von etwas Neuem sein, dafür wollten wir das passende Licht machen, ursprünglich war das Ganze revolutionär gedacht, nach außen und nach innen - eine Undergroundfirma, wenn du so willst."
Doch das liegt weit zurück, und aus der Undergroundfirma, die sie einst "Muße-Gesellschaft" nannten, wurde ein florierendes Unternehmen, das freilich den Gesetzen einer kapitalistisch organisierten Ökonomie nicht entkommen ist und alle abgestoßen hat, die diesen Gesetzen nicht folgen wollten oder konnten. So wurde aus der einstigen "Muße-Gesellschaft" gleichsam eine kapitalistische Muß-Gesellschaft.
Zu denen, die dabei auf der langen Strecke blieben, gehört auch ihr Erzähler. Aber mit der Bilanz, die er hinterläßt, ist seinem Autor, Bernd Cailloux, etwas Seltenes gelungen: die Geschichte einer ganzen Generation an Hand von ein paar Figuren mitzuteilen und ihren Realismus ins Bild einer großen Metapher zu fassen, die mit dem Titel "Das Geschäftsjahr 1968/69" präzise benannt ist.
Bilanziert wird ex post: der Erzähler, den sein Billigflieger von Ibiza nicht nach Hamburg, sondern nach Düsseldorf bringt, braucht Geld und ruft den alten Kumpel Büdinger an; in Düsseldorf hatte man sich an die vierzig Jahre zuvor auch erstmals getroffen, im Herbst 1965 bei einem Fortbildungslehrgang am Institut für Publizistik. So werden schon im Anfang mit ein paar Strichen die Positionen der Protagonisten eingezeichnet. Und drum herum malt Cailloux das Bild der sechziger Jahre farbig aus: Bundeswehrdienst, erste Liebe, Hippietime und Songs, und mit Beuys rückt auch jene künstlerische Szene ins Bild, die auf diese neue Bühne gehört.
Als dann das kleine Gerät mit den blitzartigen Leuchteffekten auftaucht, wird es unter der Hand zur Metapher für eine gesellschaftliche Erleuchtung, die damals durch viele junge Köpfe zuckte. Und seine drei Produzenten wollten mit ihrer Muße-Gesellschaft "ein unabhängiges, aus sich selbst heraus bestimmtes" Unternehmen schaffen, "jenseits hergebrachter Modelle, jenseits der Autoritäten" - es sollte so etwas wie eine "fünfte Kolonne in der Gesellschaft" werden, integriert und trotzdem den eigenen Vorsätzen treu, und jeder sollte denselben Lohn bekommen. Und: "Wir hatten über die Beuyssche Freiheitslehre nicht nur geredet, wir hatten sie als soziale Kleinplastik realisiert" - als Erleuchtungsmaschine. Mit ihr verbanden sie eine Botschaft, wollten "die Verhältnisse in jeder Hinsicht zum Tanzen bringen". Doch den Kunden, die sie damit beliefern, "fehlte jedes ästhetisch-politische, sozusagen muße-gesellschaftliche Bewußtsein" - der "Blitz zitterte als bloßer Effekt auf ihrer Netzhaut und schlug nicht bis ins Bewußtsein durch". Doch Büdinger kümmerte das nicht.
Und so wird mit der Zeit das, was da eben noch so lebendig zuckte, zum bloß noch plakativen Programm; und aus dem "Flashlight im Kleinstformat" macht die "Muße-Gesellschaft" eine profitable Maschine, die nicht nur Bühnen, Bars und Tanzsäle, sondern dann auch Bordellbetriebe und Werbeshows beflackert. "Offenbar bestätigte sich Swetis ironischer Kommentar, dem zufolge diejenigen am schnellsten vorankommen, die am erfolgreichsten so tun, als seien sie am Erfolg gar nicht interessiert."
Die Bilanz des Geschäftsjahres 1968/69, die Geschichte der Muße-Gesellschaft also, setzt sich - von Cailloux auch nahezu stroboskopisch erzählt - zusammen aus den Geschichten ihrer Teilhaber: Büdinger mit seinem im Grunde rein ökonomischen Interesse, der von seinem technischen Wissen besessene Bekurz, der Drogen-Spezi Sweti, Roland, Martin, Chris, die später hinzukommen, und mit ihnen ihre Mädchen und Frauen - und vor allem bindet der Erzähler die vielen Einzelbilder zusammen, er, der sie alle irgendwie repräsentiert, der seinen Idealismus billig verludern ließ, der mit seiner Liebe scheiterte und der den Drogen schließlich seine Hepatitis verdankt.
Der 1945 geborene Bernd Cailloux erzählt in den Geschichten seiner Figuren die Geschichte seiner Generation: von ihren Idealen und deren Vergehen und Verkommen; von ihren Abenteuern in der Liebe, mit der Sexualität, mit Drogen; vom Mißlingen ihrer Solidarität, auf die sie sich immer nur beriefen, ohne für sie zu kämpfen. Sein Erzähler resümiert schließlich selbstkritisch die Gründe für ihr gemeinsames Versagen: "Nicht Büdinger, sondern ich war der Konfrontation ausgewichen, ich war es, der einknickte und die Dinge weiterlaufen ließ, anstatt die Gesellschaft dorthin zu steuern, wo sie hingehörte. Ein schrecklicher Moment, in den Rumpelkammern des Bewußtseins die eigene Korruptheit zu entdecken, unversehens in die verschwiegenen Grenzbereiche einer Abgezocktheit vorzustoßen, die nur Heuchler als gesunden Selbsterhaltungstrieb ausgaben."
Der Traum vom "dritten Weg, niemanden beherrschen zu wollen und selbst nicht beherrscht zu werden", war schließlich ausgeträumt. Das Unternehmen, das mit einem künstlerischen und darin gesellschaftlichen Erleuchtungsprogramm begonnen hatte, war jedenfalls damit gescheitert, einen "dritten Raum zwischen Kunst und Kommerz zu schaffen". Es wurde aber erfolgreich auf dem Markt, und Büdinger bootet die alten Kompagnons schließlich aus, die in ihren Geschichten verlorengehen.
Der Erzähler erinnert sich ihrer in den zwei Stunden seines Düsseldorfer Treffens mit Büdinger. Als er wieder zu Hause ist, nachts am Schreibtisch, "saust" ihm noch immer "die Geschichte der Muße-Gesellschaft durch den Kopf . . . Damals hatten wir es in der Hand, das Bessere, das Richtige zu machen: Wir haben es vermasselt. Und trotzdem gab es nichts zu bedauern - denn letztlich war etwas Brauchbares dabei herausgekommen" -, ebenjener kleine Würfel "mit dem proustschen Blitzchen der Subversion". Und sein Licht "erinnerte an die unvergängliche Sehnsucht nach der großen gemeinschaftlichen Tat", also doch nur wieder an die längst vergangene Zeit, da das Wünschen noch geholfen hatte - aber ebenjener Würfel war ja schon am Anfang da, ein spielerisches Produkt, entstanden aus reinem Jux, er war ja der Beginn von allem gewesen, und wurde zum Katalysator, der das Scheitern der mit ihm verbundenen Idee dokumentiert.
Im Grunde ist Cailloux' Erzählen selbst dieser Katalysator: und sein Ergebnis die skeptische, weil unbestechliche Bilanz des mit der Jahreszahl 1968/69 verbundenen Unternehmens, diese große Metapher einer Rebellion, die sich in Geschichte und Gesellschaft nicht verloren, sondern darin aufgelöst und beide gesäuert hat.
Bernd Cailloux: "Das Geschäftsjahr 1968/69". Roman. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005. 254 S., br., 10,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Doch das liegt weit zurück, und aus der Undergroundfirma, die sie einst "Muße-Gesellschaft" nannten, wurde ein florierendes Unternehmen, das freilich den Gesetzen einer kapitalistisch organisierten Ökonomie nicht entkommen ist und alle abgestoßen hat, die diesen Gesetzen nicht folgen wollten oder konnten. So wurde aus der einstigen "Muße-Gesellschaft" gleichsam eine kapitalistische Muß-Gesellschaft.
Zu denen, die dabei auf der langen Strecke blieben, gehört auch ihr Erzähler. Aber mit der Bilanz, die er hinterläßt, ist seinem Autor, Bernd Cailloux, etwas Seltenes gelungen: die Geschichte einer ganzen Generation an Hand von ein paar Figuren mitzuteilen und ihren Realismus ins Bild einer großen Metapher zu fassen, die mit dem Titel "Das Geschäftsjahr 1968/69" präzise benannt ist.
Bilanziert wird ex post: der Erzähler, den sein Billigflieger von Ibiza nicht nach Hamburg, sondern nach Düsseldorf bringt, braucht Geld und ruft den alten Kumpel Büdinger an; in Düsseldorf hatte man sich an die vierzig Jahre zuvor auch erstmals getroffen, im Herbst 1965 bei einem Fortbildungslehrgang am Institut für Publizistik. So werden schon im Anfang mit ein paar Strichen die Positionen der Protagonisten eingezeichnet. Und drum herum malt Cailloux das Bild der sechziger Jahre farbig aus: Bundeswehrdienst, erste Liebe, Hippietime und Songs, und mit Beuys rückt auch jene künstlerische Szene ins Bild, die auf diese neue Bühne gehört.
Als dann das kleine Gerät mit den blitzartigen Leuchteffekten auftaucht, wird es unter der Hand zur Metapher für eine gesellschaftliche Erleuchtung, die damals durch viele junge Köpfe zuckte. Und seine drei Produzenten wollten mit ihrer Muße-Gesellschaft "ein unabhängiges, aus sich selbst heraus bestimmtes" Unternehmen schaffen, "jenseits hergebrachter Modelle, jenseits der Autoritäten" - es sollte so etwas wie eine "fünfte Kolonne in der Gesellschaft" werden, integriert und trotzdem den eigenen Vorsätzen treu, und jeder sollte denselben Lohn bekommen. Und: "Wir hatten über die Beuyssche Freiheitslehre nicht nur geredet, wir hatten sie als soziale Kleinplastik realisiert" - als Erleuchtungsmaschine. Mit ihr verbanden sie eine Botschaft, wollten "die Verhältnisse in jeder Hinsicht zum Tanzen bringen". Doch den Kunden, die sie damit beliefern, "fehlte jedes ästhetisch-politische, sozusagen muße-gesellschaftliche Bewußtsein" - der "Blitz zitterte als bloßer Effekt auf ihrer Netzhaut und schlug nicht bis ins Bewußtsein durch". Doch Büdinger kümmerte das nicht.
Und so wird mit der Zeit das, was da eben noch so lebendig zuckte, zum bloß noch plakativen Programm; und aus dem "Flashlight im Kleinstformat" macht die "Muße-Gesellschaft" eine profitable Maschine, die nicht nur Bühnen, Bars und Tanzsäle, sondern dann auch Bordellbetriebe und Werbeshows beflackert. "Offenbar bestätigte sich Swetis ironischer Kommentar, dem zufolge diejenigen am schnellsten vorankommen, die am erfolgreichsten so tun, als seien sie am Erfolg gar nicht interessiert."
Die Bilanz des Geschäftsjahres 1968/69, die Geschichte der Muße-Gesellschaft also, setzt sich - von Cailloux auch nahezu stroboskopisch erzählt - zusammen aus den Geschichten ihrer Teilhaber: Büdinger mit seinem im Grunde rein ökonomischen Interesse, der von seinem technischen Wissen besessene Bekurz, der Drogen-Spezi Sweti, Roland, Martin, Chris, die später hinzukommen, und mit ihnen ihre Mädchen und Frauen - und vor allem bindet der Erzähler die vielen Einzelbilder zusammen, er, der sie alle irgendwie repräsentiert, der seinen Idealismus billig verludern ließ, der mit seiner Liebe scheiterte und der den Drogen schließlich seine Hepatitis verdankt.
Der 1945 geborene Bernd Cailloux erzählt in den Geschichten seiner Figuren die Geschichte seiner Generation: von ihren Idealen und deren Vergehen und Verkommen; von ihren Abenteuern in der Liebe, mit der Sexualität, mit Drogen; vom Mißlingen ihrer Solidarität, auf die sie sich immer nur beriefen, ohne für sie zu kämpfen. Sein Erzähler resümiert schließlich selbstkritisch die Gründe für ihr gemeinsames Versagen: "Nicht Büdinger, sondern ich war der Konfrontation ausgewichen, ich war es, der einknickte und die Dinge weiterlaufen ließ, anstatt die Gesellschaft dorthin zu steuern, wo sie hingehörte. Ein schrecklicher Moment, in den Rumpelkammern des Bewußtseins die eigene Korruptheit zu entdecken, unversehens in die verschwiegenen Grenzbereiche einer Abgezocktheit vorzustoßen, die nur Heuchler als gesunden Selbsterhaltungstrieb ausgaben."
Der Traum vom "dritten Weg, niemanden beherrschen zu wollen und selbst nicht beherrscht zu werden", war schließlich ausgeträumt. Das Unternehmen, das mit einem künstlerischen und darin gesellschaftlichen Erleuchtungsprogramm begonnen hatte, war jedenfalls damit gescheitert, einen "dritten Raum zwischen Kunst und Kommerz zu schaffen". Es wurde aber erfolgreich auf dem Markt, und Büdinger bootet die alten Kompagnons schließlich aus, die in ihren Geschichten verlorengehen.
Der Erzähler erinnert sich ihrer in den zwei Stunden seines Düsseldorfer Treffens mit Büdinger. Als er wieder zu Hause ist, nachts am Schreibtisch, "saust" ihm noch immer "die Geschichte der Muße-Gesellschaft durch den Kopf . . . Damals hatten wir es in der Hand, das Bessere, das Richtige zu machen: Wir haben es vermasselt. Und trotzdem gab es nichts zu bedauern - denn letztlich war etwas Brauchbares dabei herausgekommen" -, ebenjener kleine Würfel "mit dem proustschen Blitzchen der Subversion". Und sein Licht "erinnerte an die unvergängliche Sehnsucht nach der großen gemeinschaftlichen Tat", also doch nur wieder an die längst vergangene Zeit, da das Wünschen noch geholfen hatte - aber ebenjener Würfel war ja schon am Anfang da, ein spielerisches Produkt, entstanden aus reinem Jux, er war ja der Beginn von allem gewesen, und wurde zum Katalysator, der das Scheitern der mit ihm verbundenen Idee dokumentiert.
Im Grunde ist Cailloux' Erzählen selbst dieser Katalysator: und sein Ergebnis die skeptische, weil unbestechliche Bilanz des mit der Jahreszahl 1968/69 verbundenen Unternehmens, diese große Metapher einer Rebellion, die sich in Geschichte und Gesellschaft nicht verloren, sondern darin aufgelöst und beide gesäuert hat.
Bernd Cailloux: "Das Geschäftsjahr 1968/69". Roman. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005. 254 S., br., 10,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
"Ohne jeden Zorn" blickt Bernd Cailloux zurück auf die 68er-Generation, stellt Joseph von Westphalen fest. Wunderbar sei die Sprache des Romans "Das Geschäftsjahr 1968/69", "komisch und liebenswert" die Zeit, von der berichtet wird, und wenn von den "linken Hoffnungen" heute auch nichts übrig geblieben ist: wie Cailloux mit der "Stupidität" der Bundeswehr und der "niederträchtigen Psychologie des Gehorchens" abrechnet - das entlockt dem Rezensenten ein leises Jauchzen der Begeisterung, auch weil es so "schön trocken" erzählt wird. Ein großes Aufräumen stellt in Westphalens Perspektive dieser Roman dar, keine Abrechnung, aber eine Relativierung - denn es gab ja, stellt der Rezensent fest, unter den 68ern auch "schräge und großspurige Vögel", die lieber Drogen nahmen als Marx lasen. Wie es diesen "Hippie-Businessmen" erging, dass stelle Cailloux gekonnt dar, in dem er die Illusionen aller Seiten auf die Wirklichkeiten prallen lässt. Ein "intellektueller Roman", so das Fazit des Rezensenten, der gleichwohl "Anteilnahme" erweckt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Die Mär der 68er-Generation
Der Debütroman mit dem ironischen Titel «Das Geschäftsjahr 1968/69» war für den Schriftsteller Bernd Cailloux gleich der große Erfolg, er wurde vom Feuilleton als literarische Entdeckung gefeiert. Mit der Nominierung für den …
Mehr
Die Mär der 68er-Generation
Der Debütroman mit dem ironischen Titel «Das Geschäftsjahr 1968/69» war für den Schriftsteller Bernd Cailloux gleich der große Erfolg, er wurde vom Feuilleton als literarische Entdeckung gefeiert. Mit der Nominierung für den Deutschen Buchpreis 2005 stellte sich für den damals bereits über sechzigjährigen und bis dato weitgehend unbekannten Suhrkamp-Autor auch ein erfreulicher Anstieg der Auflagen ein. Sein Roman wurde als hochwillkommene, nüchterne Schilderung dieser im Buchtitel genannten, historisch völlig überschätzten und ideologisch überhöhten Epoche der deutschen Nachkriegsgeschichte, von der Kritik äußerst positiv kommentiert.
Auf einem Fortbildungs-Lehrgang für Journalisten lernen sich 1965 zwei junge Männer kennen, die beide der Wunsch vereint, Großes zu vollbringen und nicht im profanen bürgerlichen Alltag zu versauern. Nach dem Wehrdienst des namenlosen Ich-Erzählers ziehen sie voller Tatendrang nach Düsseldorf und beginnen, zusammen mit einem begnadeten Tüftler als Entwickler, in einer Gartenlaube ein Stroboskop zu entwickeln. Ihre Idee, die von dem Gerät erzeugten Lichtblitze als die Musik ergänzende Stimulanz für ein tanzwütiges Publikum in Clubs und Diskotheken einzusetzen, erweist sich als Glücksfall. Bereits das erste Gerät der «Muße-Gesellschaft», wie sie sich nennen, installiert in einer neuen Location auf der Hamburger Reeperbahn, ist ein sensationeller Erfolg, der sich schnell herumspricht. Fortan reißen sich die Kunden geradezu um diese Geräte und zahlen umstandslos fast jeden Preis, wenn sie ihr eigenes Stroboskop nur möglichst bald bekommen. Naiv und ökonomisch unbedarft träumen die Gründer davon, in erster Linie mit ihrer Idee die Welt zu beglücken. Sie wollen sich und ihre Mitstreiter ohne Profitstreben, geradezu familiär, solidarisch aus der gemeinsamen Kasse entlohnen, also eine Art ökonomische Hippie-Kommune selbstloser, gleichberechtigter Idealisten bilden. Um in Stimmung zu kommen wird natürlich Rauschgift in verschiedenster Form konsumiert, auch darin sind sich alle gleich in der schnell wachsenden Belegschaft. Irgendwann fordert die Realität ihr Recht, der Mitbegründer meldet die bis dahin nicht im Handelsregister eingetragene Firma auf seinen Namen an, ganz ohne Formalitäten geht es halt doch nicht. Enttäuscht zieht der Romanheld sich zurück, lässt sich dann aber doch überreden, wenigstens die Hamburger Filiale zu übernehmen. Bis ihn dort schließlich eine Hepatitis-Infektion bös erwischt.
Ohne Larmoyanz wird in diesem Roman das Zeitgefühl der berühmten 68er weitgehend klischeefrei geschildert. Dabei entwickeln sich die Gründer, die sich als «Enthemmungs-Assistenten» definieren und auch reichlich Dope dafür einsetzen, als Antipoden ihrer Geschäftsidee. Während der Ich-Erzähler als Alt-Hippie seinen geplatzten Träumen von der Bedürfnislosigkeit nachtrauert, ist sein Kompagnon schon in der ökonomischen Realität angekommen und nutzt die sprudelnde Geldquelle zu seinem eigenen Vorteil. Bernd Cailloux erzählt seine Geschichte lakonisch mit viel Sinn für Details, auch wenn sowohl technisch als auch ökonomisch manches daran dann doch ins Spekulative, Märchenhafte abgleitet. Dazu zählen vor allem die viel zu lang geratenen Passagen über den unbekümmerten Rauschgift-Konsum der psychedelischen Stroboskop-Truppe. Das wird in unzähligen Details immer wieder neu beschrieben, dürfte aber allenfalls die Junkies in der Leserschaft erfreuen, die große Mehrheit jedoch erbarmungslos langweilen.
Erzählt wird diese desillusionierende Geschichte der ungleichen «Hippie-Businessmen», wie die Freundin des Protagonisten sie spöttisch bezeichnet, in einer angenehm lesbaren, dem Alltag entsprechenden Diktion, nüchtern und völlig unprätentiös. Dass ihre «Suche nach besseren Lebenszwecken» scheitern muss, ist von vornherein klar. Aber wie kläglich sie scheitert, das ist durchaus vergnüglich zu lesen, vor allem, weil es gnadenlos einen scheinbar unausrottbaren Mythos entlarvt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für