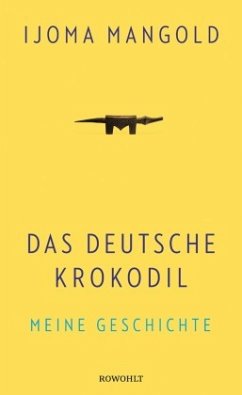Ijoma Alexander Mangold lautet sein vollständiger Name; er hat dunkle Haut, dunkle Locken. In den siebziger Jahren wächst er in Heidelberg auf. Seine Mutter stammt aus Schlesien, sein Vater ist aus Nigeria nach Deutschland gekommen, um sich zum Facharzt für Kinderchirurgie ausbilden zu lassen. Weil es so verabredet war, geht er nach kurzer Zeit nach Afrika zurück und gründet dort eine neue Familie. Erst zweiundzwanzig Jahre später meldet er sich wieder und bringt Unruhe in die Verhältnisse.
Ijoma Mangold, heute einer unserer besten Literaturkritiker, erinnert sich an seine Kindheits- und Jugendjahre. Wie wuchs man als «Mischlingskind» und «Mulatte» in der Bundesrepublik auf? Wie geht man um mit einem abwesenden Vater? Wie verhalten sich Rasse und Klasse zueinander? Und womit fällt man in Deutschland mehr aus dem Rahmen, mit einer dunklen Haut oder mit einer Leidenschaft für Thomas Mann und Richard Wagner?
Erzählend beantwortet Mangold diese Lebensfragen, hält er seine Geschichte und deren dramatische Wendungen fest, die Erlebnisse mit seiner deutschen und mit seiner afrikanischen Familie. Und nicht zuletzt seine überraschenden Erfahrungen mit sich selbst.
Ijoma Mangold, heute einer unserer besten Literaturkritiker, erinnert sich an seine Kindheits- und Jugendjahre. Wie wuchs man als «Mischlingskind» und «Mulatte» in der Bundesrepublik auf? Wie geht man um mit einem abwesenden Vater? Wie verhalten sich Rasse und Klasse zueinander? Und womit fällt man in Deutschland mehr aus dem Rahmen, mit einer dunklen Haut oder mit einer Leidenschaft für Thomas Mann und Richard Wagner?
Erzählend beantwortet Mangold diese Lebensfragen, hält er seine Geschichte und deren dramatische Wendungen fest, die Erlebnisse mit seiner deutschen und mit seiner afrikanischen Familie. Und nicht zuletzt seine überraschenden Erfahrungen mit sich selbst.

© BÜCHERmagazin, Björn Hayer

Mutter aus Schlesien, Vater aus Nigeria: Der Literaturkritiker
Ijoma Alexander Mangold erkundet seine Kindheitsmuster
VON KRISTINA MAIDT-ZINKE
Wenn das literarische Genre des „Memoirs“ weiter so boomt, werden bald immer mehr Menschen in immer jüngeren Jahren ihre vorläufige Autobiografie verfassen. Im Prinzip ist natürlich jedes Leben, sogar jeder Lebensabschnitt erzählenswert; es kommt auf die Perspektive und auf die Art der Darstellung an. Wer von Berufs wegen die Kunst des Schreibens pflegt, hat hier die besseren Karten. Unter jenen, auf die das zutrifft, dürften indes nur wenige über einen so ungewöhnlichen Lebensstoff verfügen wie Ijoma Mangold, einer der bekanntesten deutschen Literaturkritiker, früher bei der SZ, heute bei der Zeit, der 1971 in Heidelberg geboren wurde, bei seiner Mutter aufwuchs und erst als Erwachsener seinen nigerianischen Vater, dessen Familie und die Hintergründe seiner eigenen Herkunft kennenlernte.
Wenn Mangold diese Konstellation, vor allem aber deren Auswirkungen auf seine Weltsicht und seinen Werdegang, jetzt in einer Erzählung öffentlich macht, entspricht das einem Bedürfnis nach Rückschau, Klärung und Selbstvergewisserung, das er mit vielen Generationsgenossen teilt. Das Individuelle, Besondere seiner Biografie verknüpft er jedoch, immer wieder ins Essayistische ausgreifend, so geschickt mit Fragen und Reflexionen von allgemeinem Interesse, dass das Buch mit dem charmanten Titel „Das deutsche Krokodil“ viel mehr geworden ist als eine persönliche Geschichte: Es ist zugleich ein Gesellschafts- und Epochenporträt en miniature, und es kann Themen für anregende Debatten liefern.
Das Titeltier prägt die Jugend des Autors in zwei Gestalten. Als E-Lok der Märklin-Baureihe 194 ist das „deutsche Krokodil“ für den jungen Eisenbahnfreund ein Objekt der Begierde, bis er es eines Tages unter dem Christbaum findet. Eigentlich hätte er, qualitätsbewusst von Kindesbeinen an, den schweizerischen Typ bevorzugt, der länger und stärker ist, doch beim Wunschzettelschreiben schont er rücksichtsvoll den Geldbeutel der Mutter. Das andere, problematischere Krokodil steht als Ebenholzskulptur auf dem Fenstersims im Dossenheimer Wohnzimmer: „Als wäre es seine Pflicht, jeden daran zu erinnern, dass dieser Haushalt eine besondere Verbindung zu Afrika pflegt.“
Was „der Junge“, wie der Protagonist anfangs genannt wird, als beklemmend und peinlich empfindet, ist darin doch die Erinnerung an sein Anderssein enthalten, das er am liebsten verdrängen würde. Dem Verdrängen aber wird in diesem Haushalt professionell entgegengewirkt: Die Mutter ist „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin“, ein Wortungetüm, das der Junge bei manchen Gelegenheiten ebenfalls als ausgrenzend erlebt, genau wie den unkonventionellen Lebensstil der Mama. Obwohl er wegen seiner dunkleren Hautfarbe so gut wie nie ernsthaft benachteiligt oder bloßgestellt wird, ist sein Gespür für potenzielle Diskriminierung so ausgeprägt, dass er schon früh auf bekennende Zugehörigkeit setzt: zu dem Land, in dem er lebt, zu gesellschaftlichen Gruppen oder Milieus, die er mit feinem Instinkt als erstrebenswert deutet.
Der Autor tut hier etwas ziemlich Mutiges: Ohne Rücksicht auf Sympathieverluste beschreibt er sich selbst als Kind und Jugendlichen so, dass die halb selbstironische, halb provokante Kernfrage, um die sein Buch kreist, den Leser von Anfang an beschäftigt. Sie steht auf dem Umschlagrücken und lautet: „War ich überassimiliert, deutscher als jeder Deutsche? Ein Opportunist, der die Anpassung so weit trieb, bis die konservativen Väter meiner Freunde überzeugt waren, dass das deutsche Kulturerbe einzig in meinen Händen noch eine Chance auf ein Weiterleben hatte?“ Wer so fragt, geht couragiert das Risiko ein, dass irgendeiner mit „Ja“ antwortet.
Vieles an Mangolds Kindheitserinnerungen ist mühelos übertragbar auf andere Lebensläufe, aber es gibt einen Unterschied: Der Junge, der da in behüteten Verhältnissen heranwächst, zeigt bereits so deutliche Symptome von Überanpassung, dass er einem manchmal nicht ganz geheuer ist. Und man beginnt, Indizien zu sammeln, die im anekdotischen Kontext eine gewisse Komik entfalten.
So erlebt der Knabe sein einjähriges Gastspiel in einem antiautoritären Kindergarten als äußerst unangenehm. Faszinieren lässt er sich hingegen vom Beamtentum: Er legt sich eine große Stempelsammlung zu, und beim Anblick einer „Drucksache“ durchrieselt ihn ein wohliger Schauer – nicht etwa, weil er sie mit der Druckerpresse in Verbindung brächte, sondern weil er sie mit „Amtsverkehr“ assoziiert. Er wird später zeitweise Geschmack daran finden, sich als „Gesinnungspreuße“ zu fühlen; seine Mutter wiederum nennt ihn einen „Distinktionsneurotiker“.
Die entschiedene Abneigung des Jungen gegen alles Afrikanische ist frei von Groll gegen den abwesenden Erzeuger. Dass dieser, in Deutschland zum Facharzt für Kinderchirurgie ausgebildet, bald nach der Geburt des Sohnes in sein nigerianisches Heimatdorf zurückkehrte, um dort sein Wissen zum Wohl seiner Landsleute anzuwenden und eine neue Familie zu gründen, entsprach einer Verabredung: Man hatte sich im Guten getrennt.
Der Junge vermisst den Erzeuger nicht, ist vielmehr froh, dass er nicht auftaucht, weil er ihn als Störfaktor für die perfekte Assimilation empfände. Wenn der erwachsene Erzähler, nunmehr in der Ich-Form, sich mit der schlesischen Herkunft der Mutter und dem Vertreibungsschicksal ihrer Vorfahren zu identifizieren beginnt, bis hin zum koketten Spiel mit dem Satz: „ich bin Schlesier“, fügt das der Dialektik von Anpassung und Distinktion eine weitere, leicht kuriose Facette hinzu.
Ein USA-Aufenthalt und Freundschaften mit African Americans erweitern die Perspektive, bevor die Begegnung mit dem Vater das Leben des jungen Mannes gründlich durcheinanderbringt. Da ist er schon 22 Jahre alt, hat ein Elite-Gymnasium absolviert, eine marxistische Phase durchlaufen und sich von einem schrägen intellektuellen Guru inspirieren lassen; er hat Thomas Mann und Richard Wagner für sich entdeckt und mit dem Studium der Literaturwissenschaft und Philosophie begonnen. Die Reise nach Nigeria, das Ankommen und Zurechtfinden bei der afrikanischen Verwandtschaft, die ihren eigenen Konservatismus pflegt, sind einschneidende Erfahrungen, deren Zwiespältigkeit sich in Mangolds Schilderung wunderbar vermittelt. Am Ende stehen Entscheidungen, Enthüllungen und Abschiede. Der Verlust der Eltern muss bewältigt werden, dafür festigen sich die neuen Geschwisterbande. Und schließlich mündet, wie es sich bei einer vorgezogenen Autobiografie gehört, alles ins Offene.
Der Leser aber begreift nach und nach, warum diese wie beiläufig erzählte, von Ambivalenzen und Widersprüchen durchsetzte Geschichte, diese Mischung aus Tatsachenbericht und Bildungsroman, unbedingt aufgeschrieben werden musste. Man darf Ijoma Mangold bescheinigen, dass er hier auf überzeugende Weise sich selbst „historisch“ geworden ist, um eine Formulierung Goethes zu benutzen, und dass er bei aller Freimütigkeit klug zu trennen weiß zwischen dem, was er preisgibt, und dem, was er für sich behält. Das schützt seine Privatsphäre und macht den Leser weder zum Voyeur noch zum Komplizen, sondern zum Mitdenker. Schade nur, dass Verlage sich heute oft nicht mehr die Zeit nehmen, kleine Flüchtigkeiten wegzulektorieren: Auch ein Literaturkritiker und Redakteur sollte, wenn er als Schriftsteller debütiert, damit nicht allein gelassen werden.
Diese Mischung aus Bericht und
Bildungsroman musste
unbedingt aufgeschrieben werden
Ijoma Mangold: Das deutsche Krokodil. Meine Geschichte. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2017. 352 Seiten, 19,95 Euro.
E-Book 16,99 Euro.
„War ich überassimiliert, deutscher als jeder Deutsche? “ – Aber was heißt schon Assimilation, wenn man ohne den Vater in den späten Jahren der Bundesrepublik aufwächst? Der Kritiker Ijoma Mangold, Jahrgang 1971.
Foto: Sebastian Hänel
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Es bleibt ein Stück Dossenheim zurück: Ijoma Mangolds beeindruckende Lebensgeschichte "Das deutsche Krokodil"
Mit dem Trauma ist es so eine Sache: Allzu leicht wird heute jemandem eines angedichtet. Aber andererseits möchte man bloß nicht derjenige sein, der ein tatsächliches Trauma unterschätzt, am wenigsten ein eigenes. Ijoma Mangold spricht in seinem Buch diesen Umstand offensiv kritisch an: Jeder suche sich heute ein Trauma, das ihn unverwechselbar mache. Womöglich aber sei das "Seelenkitsch", uns eingeredet von Analytikern.
Seine Abneigung gegen ständiges Psychologisieren ist biographisch motiviert. Aufgewachsen als Sohn einer Therapeutin, erzählt Mangold: "Ich hasste es, wenn meine Mutter ein Verhalten, das sie nicht billigte, eine ,völlig normale Abwehrreaktion' nannte oder wenn sie in meiner Unlust, über etwas zu reden, einen Akt der Verdrängung sah. Als ich älter wurde, genoss ich Nabokovs Spott über Freud. Ich sorgte für eine theoretische Fundierung meiner Ablehnung der Psychoanalyse, wohl wissend, dass ich damit die zentrale freudsche Kategorie der Abwehr natürlich nur bestätigte."
Im Zeichen dieser Paradoxie steht das ganze Buch, dessen Witz es ist, dass der Autor sich letztlich selbst analysiert. Es geht darin um zwei Grunderfahrungen: nämlich ohne Vater aufzuwachsen und mit dunklerer Haut, als die meisten anderen in Deutschland. Liegt darin also die tiefe Wunde?
Wenn man dem Erzähler glaubt, nicht unbedingt. Denn er betont mehrfach, dass er sich zeitlebens selten benachteiligt oder diskriminiert gefühlt habe, auch wenn ihm als Kind Kommentare zu seinen krausen Haaren auf die Nerven gingen und es ihn als Jugendlichen manchmal störte, für eine Exotik "gefeiert zu werden", die "allen anderen mehr Freude bereitet" habe als ihm selbst.
Aber trotzdem meint man zumeist keine Klage zu lesen; der Autor schildert vielmehr die Auseinandersetzung mit seiner Lebenssituation als Grundlage für seinen Erfolg - nämlich den, ein kritisch denkender und in besonderem Maße an deutscher Kultur interessierter Mensch zu werden. Und vor allem auch: ein Mensch zu werden, der seine Identität weniger über seine Hautfarbe definiert (das Abgrenzungsangebot sogenannter "Afro-Deutscher" lehnt er rigoros ab), sondern über die kulturelle Prägung. Heute ist Mangold Literaturchef der "Zeit".
So wird man Zeuge einer erfüllten Bildungsgeschichte, angetrieben zuallererst von der Mutter, fundiert in einer privilegierten Schulzeit an einem altsprachlichen Gymnasium in Heidelberg, ausgebaut durch früh entwickeltes, faustisches Interesse, mit dem Virus des Widerständigen infiziert durch eine Art Variation des George-Kreises bei einem altlinken Journalisten. Der lehrt seine Schüler, alles in Frage zu stellen, so dass der Autor bald auch den Mentor selbst in Frage stellt und sich neue Inspirationen sucht, aufbricht zu Reisen in die Welt und ins Studium nach München.
Also alles in allem die Geschichte eines Aufsteigers, die sagt: Jeder kann alles erreichen, wenn er will? Nicht nur, denn das wäre zu einfach. Und an diesem Punkt muss man auf die literarisch-hintersinnige Schreibweise des Buches zu sprechen kommen, das man durchaus auch als Roman bezeichnen könnte. Es beginnt mit einem gut sechzigseitigen Kapitel über die Kindheit im Ort Dossenheim bei Heidelberg, das auf berührende Weise die Perspektive des Erwachsenen in die des Jungen zurückführt und außerdem ein lebendig-witziges Bild von Deutschland in den siebziger Jahren malt. Abgesehen vom manchmal melancholisch durchscheinenden Verschwinden des Vaters und von Erfahrungen mit Einsamkeit und Langeweile, ist es eine Idylle, wenn auch gespickt mit Ironie: "Zum Glück gibt es Dossenheim", sagt der Erzähler da einmal, und man könnte aus einem solchen Satz leicht eine ziemliche Verachtung der Provinz heraushören, doch dann geht es weiter: "Die Kraft der Wohlgeordnetheit ist dort so groß, dass sie den Jungen und seine ungewöhnlichen Verhältnisse mühelos umhüllt."
Die Ursache der besagten Verhältnisse wird dann auch wie in einem Roman aus der Tiefe her aufgerollt: Es folgen Kapitel über die Lebensgeschichte der Mutter, die als Kind aus Schlesien vertrieben wurde. Der Großvater mütterlicherseits war bei der Wehrmacht, womöglich auch am Judenmord beteiligt. Da er bei der Reichsbahn arbeitete, darf seine Witwe ihr Leben lang kostenlos Zug fahren, was den Enkel schwer beeindruckt, der begeistert von Modelleisenbahnen ist. Mittels solcher prekären historischen Zusammenhänge spannt Mangold ein feines Motivnetz auf, das sich noch im Titel widerspiegelt. Das dafür gefundene Emblem, das "deutsche Krokodil", ist schlicht genial gewählt: Einerseits ist dies der Spitzname für eine Lokomotive der Deutschen Bahn, die der aufwachsende Junge für ihre Zugkraft bewundert, andererseits steht später in der Wohnung der Mangolds auf dem Fenstersims ein Krokodil aus Ebenholz, das dem Jungen wie ein Inbegriff Afrikas erscheint und somit bei Besuchern ihm unliebsame Fragen aufwirft. Es kommt in diesem Krokodil somit die Familiengeschichte der Mutter mit der des Vaters bildlich zusammen.
Über seinen Vater, der als Medizinstudent aus Nigeria nach Heidelberg kam, weiß der Junge lange nicht viel. Er ist angeblich kurz nach der Geburt des Sohnes nach Afrika zurückgegangen, weil dort eine Ehefrau für ihn ausgewählt worden war. Erst als junger Mann wird Ijoma Mangold Kontakt zu ihm erhalten und eine längere Reise nach Nigeria antreten, die dann noch einmal die grundsätzliche Auseinandersetzung mit seiner Identität erfordert.
Bei der Schilderung dieser Erfahrung gewinnt das Buch große Reportagequalität. Das fast schon übermäßige Interesse Mangolds an "konservativen" deutschen Themen wie Preußen, Thomas Mann und Richard Strauss, dem bis dorthin im Buch auch etwas leicht Kokettes anhaftete, gewinnt in dieser Konfrontation mit Nigeria - wo der Sohn von pfingstchristlichen Familienangehörigen des Vaters wiedergetauft werden soll, die zu seiner Empörung empfehlen, er solle den mütterlichen Namen Mangold vergessen - eine dramatische Triftigkeit: Er singt mitten im Urwald eine Arie aus dem "Rosenkavalier".
In Ijoma Mangolds Heimatdialekt, dem Kurpfälzischen, gibt es eine ulkige Frage nach jemandes Herkunft, die lautgetreu aufgeschrieben noch weitaus exotischer klingt als sein Name: Wemmgherschndu? ("Wem gehörst denn du?"), Wenn man so will, hat Mangold mit seinem Buch die sehr ausführliche Antwort auf diese Frage gegeben. Die Kurzform steht in der Widmung: "Meiner Mutter". Es ist, neben vielem anderen, das schönste und bewegendste Mutterbuch, das man sich denken kann.
JAN WIELE
Ijoma Mangold:
"Das deutsche Krokodil".
Meine Geschichte.
Rowohlt Verlag, Reinbek 2017. 352 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
Mit Vergnügen hat Rezensent Tilman Krause Ijoma Mangolds Erinnerungen "Das deutsche Krokodil" gelesen. Wenn ihm der ihn Heidelberg aufgewachsene Sohn einer Schlesierin und eines Nigerianers, der die Familie bald verließ, erzählt, wie seine nigerianische Familie ihn lediglich als dynastischen Erben betrachtete und erklärt, weshalb er liebe Jude wäre, denn für die würde "nicht so sahelzonenmäßig Brot für die Welt gesammelt", meint der Kritiker begeistert: So politisch inkorrekt geht es selten in der deutschen Publizistik zu. Gelegentlich erinnert ihn das "pointenreiche" Buch an den Kongolesen Alain Mabanckou.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Jeder, der einmal Kind gewesen ist, wird sich in Ijoma Mangolds aufregender Erzählung wiederfinden. NDR Kultur
Diese Mischung aus Bericht und Bildungsroman musste unbedingt aufgeschrieben werden. Süddeutsche Zeitung