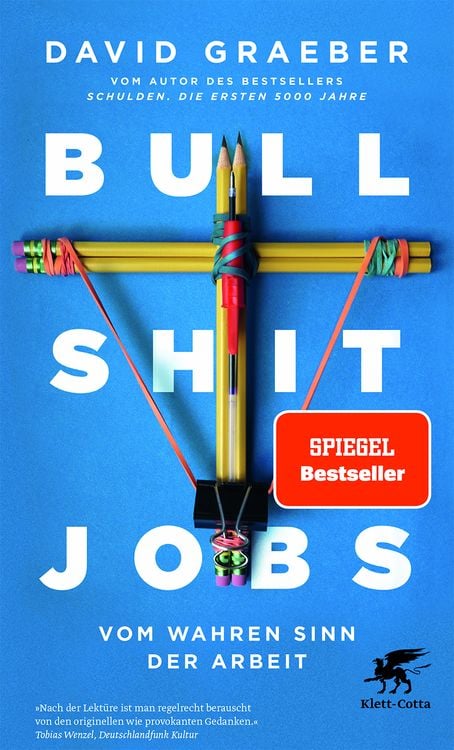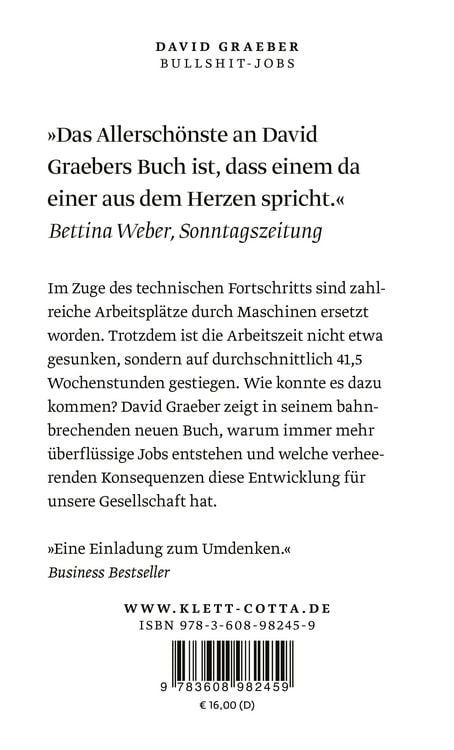Bullshit Jobs Vom wahren Sinn der Arbeit
7-
- Taschenbuch ausgewählt
- eBook
- Hörbuch
-
Sprache:Deutsch
- Deutsch 16,00 € ausgewählt
- Englisch 14,39 €
- Italienisch 24,99 €
16,00 €
inkl. MwSt,
Lieferung nach Hause
Beschreibung
Details
Verkaufsrang
3491
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
18.06.2020
Verlag
Klett CottaSeitenzahl
464
Maße (L/B/H)
18,8/11,6/3,2 cm
Gewicht
314 g
Farbe
Blau
Auflage
8. Auflage
Übersetzt von
Sebastian Vogel
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-608-98245-9
Im Jahr 1930 prophezeite der britische Ökonom John Maynard Keynes, dass durch den technischen Fortschritt heute niemand mehr als 15 Stunden pro Woche arbeiten müsse. Die Gegenwart sieht anders aus: Immer mehr überflüssige Jobs entstehen, Freizeit und Kreativität haben keinen Raum – und das, obwohl die Wirtschaft immer produktiver wird. Wie konnte es dazu kommen?
Stimmen zum Buch
»Eine Einladung zum Umdenken.«
Business Bestseller
»Drastische Ideen, spannend zu lesen!«
P. M.
»Nach der Lektüre ist man regelrecht berauscht von den originellen wie provokanten Gedanken«
Tobias Wenzel, Deutschlandfunk Kultur
»Das Allerschönste an David Graebers Buch ist, dass einem da einer aus dem Herzen spricht.«
Bettina Weber, Sonntagszeitung
Unsere Kundinnen und Kunden meinen
Arbeiten - gegen die Freiheit aller!
Bewertung am 28.02.2024
Bewertungsnummer: 2142007
Bewertet: Buch (Taschenbuch)
Bull Shit Buch über Bull Shit…
Juti aus HD am 12.08.2022
Bewertungsnummer: 2777750
Bewertet: Buch (Taschenbuch)
Kurze Frage zu unserer Seite
Vielen Dank für dein Feedback
Wir nutzen dein Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte habe Verständnis, dass wir dir keine Rückmeldung geben können. Falls du Kontakt mit uns aufnehmen möchtest, kannst du dich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.
zum Kundenservice