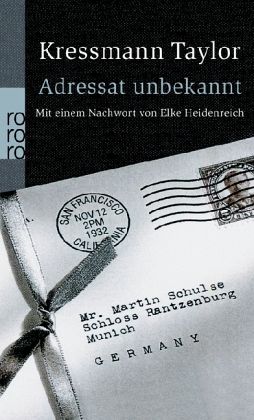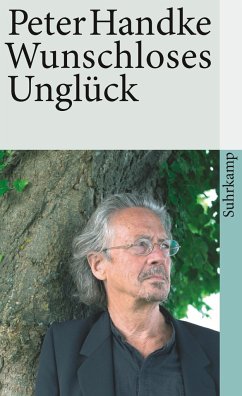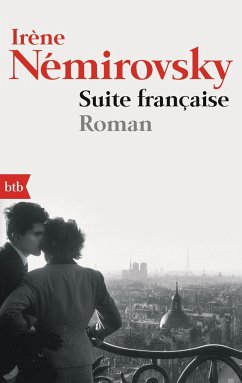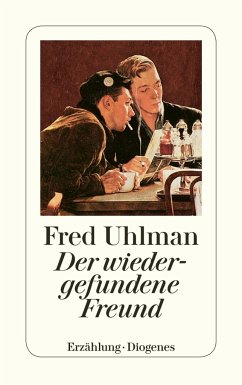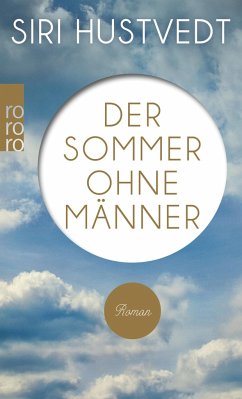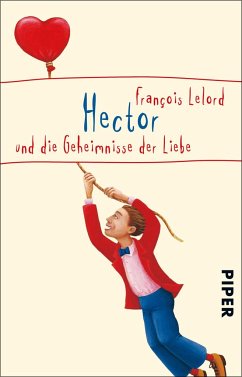Kathrine Kressmann Taylor
Broschiertes Buch
Adressat unbekannt
Vorw. v. Elke Heidenreich
Übersetzung: Böhm, Dorothee
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





"Ein widerständiges Dokument von bestechender Kunstfertigkeit." -- FAZ
"Adressat unbekannt", erstmals 1938
veröffentlicht, ist ein literarisches Meisterwerk von beklemmender Aktualität. Gestaltet als
Briefwechsel zwischen einem Deutschen und einem amerikanischen Juden in den Monaten um Hitlers Machtergreifung, zeichnet dieser Roman in bewegender Schlichtheit die dramatische Entwicklung einer Freundschaft. "Selten ist so viel in solcher Dichte ausgedrückt worden", heißt es in einer Rezension. "Welche Hellsichtigkeit! Und welche Kraft!" Der Text wurde 1938 als Fortsetzung in einer Zeitschrift veröffentlicht, geriet dann über sechzig Jahre lang in Vergessenheit.
veröffentlicht, ist ein literarisches Meisterwerk von beklemmender Aktualität. Gestaltet als
Briefwechsel zwischen einem Deutschen und einem amerikanischen Juden in den Monaten um Hitlers Machtergreifung, zeichnet dieser Roman in bewegender Schlichtheit die dramatische Entwicklung einer Freundschaft. "Selten ist so viel in solcher Dichte ausgedrückt worden", heißt es in einer Rezension. "Welche Hellsichtigkeit! Und welche Kraft!" Der Text wurde 1938 als Fortsetzung in einer Zeitschrift veröffentlicht, geriet dann über sechzig Jahre lang in Vergessenheit.
1903 in Portland geboren und von Beruf Werbetexterin, lehrte seit den 40er Jahren am Gettysburg College. Ihr bekanntestes Werk "Adressat unbekannt" erschien bereits 1938, wurde aber erst Jahrzehnte später in Europa bekannt. Die Mutter von drei Kindern verstarb 1997.
Produktdetails
- rororo Taschenbücher Nr.23093
- Verlag: Rowohlt TB.
- Originaltitel: Address Unknown
- 16. Aufl.
- Seitenzahl: 64
- Erscheinungstermin: Mai 2007
- Deutsch
- Abmessung: 190mm
- Gewicht: 62g
- ISBN-13: 9783499230936
- ISBN-10: 3499230933
- Artikelnr.: 09933228
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.11.2000
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.11.2000Verfolgter Giotto, mehr grün als weiß
Wiederentdeckt: Ein fiktiver deutsch-jüdischer Briefroman / Von Volker Breidecker
Allein der Anblick des schmalen Bändchens mit dem lakonischen Titel "Adressat unbekannt" und dem Faksimile eines frankierten und gestempelten Briefumschlags auf schwarzgrauem Einband erweckt unheimliche Gefühle. Jeder Briefschreiber, der einmal eine persönliche Sendung ungeöffnet wieder zurückerhalten hat, kennt die bedrückende Wirkung jener gespenstischen, durch Dienststempel und Unterschrift beglaubigten Formel, die dem Absender von Amts wegen mitteilt, daß er einen Wettlauf mit der Zeit verloren hat.
Ein amerikanischer Jude schreibt im November 1933 nach Deutschland und bittet einen
Wiederentdeckt: Ein fiktiver deutsch-jüdischer Briefroman / Von Volker Breidecker
Allein der Anblick des schmalen Bändchens mit dem lakonischen Titel "Adressat unbekannt" und dem Faksimile eines frankierten und gestempelten Briefumschlags auf schwarzgrauem Einband erweckt unheimliche Gefühle. Jeder Briefschreiber, der einmal eine persönliche Sendung ungeöffnet wieder zurückerhalten hat, kennt die bedrückende Wirkung jener gespenstischen, durch Dienststempel und Unterschrift beglaubigten Formel, die dem Absender von Amts wegen mitteilt, daß er einen Wettlauf mit der Zeit verloren hat.
Ein amerikanischer Jude schreibt im November 1933 nach Deutschland und bittet einen
Mehr anzeigen
langjährigen Freund und Geschäftspartner um Hilfe bei der Aufklärung des Schicksals seiner dort verschwundenen Schwester. Die letzten Briefe an sie waren ungeöffnet und mit jenem beängstigenden Stempel versehen zurückgekommen. Dem Deutschen, der seine vormals brüderliche Freundschaft zu dem Juden vor kurzem erst aufgekündigt hatte, bekennt der Schreiber ein letztes Mal seine Gefühle: "Welche Dunkelheit diese Worte bergen! Wie kann sie unbekannt sein? Es handelt sich bestimmt um die Mitteilung, daß ihr etwas zugestoßen ist. Sie wissen, was mit ihr geschehen ist, das sagen diese gestempelten Briefe, nur ich soll es nicht erfahren. Sie hat sich in eine Art Leere aufgelöst, und es ist sinnlos, sie zu suchen. All das sagen sie mir mit zwei Worten: ,Adressat unbekannt'."
Diese Sätze, die bereits die anonyme Gewalt der noch kommenden Vernichtungsmaschinerie antizipierten, waren im Oktober 1938 in der amerikanischen Literaturzeitschrift "Story" erschienen. Die dort abgedruckten achtzehn fiktiven Briefe, das eine Telegramm und der täuschend echt faksimilierte Briefumschlag wurden von den Lesern bald von Hand zu Hand und sogar in handkopierter Form weitergereicht, bevor sie im "Reader's Digest" nachgedruckt und im Jahr darauf als selbständige Buchpublikation in hoher Auflage erschienen. Erst als die Realität die Fiktion eingeholt hatte, geriet dieses Meisterwerk einer aufs äußerste verknappten dramatischen Erzählkunst wieder in Vergessenheit. Oder verbot es sich von selbst, fortan von einer fiktiven Schilderung in Form eines kleinen Briefromans zu sprechen? Auch ist der Name seiner Autorin Kathrine Kressmann Taylor, einer ehemaligen Werbetexterin, in keinem Nachschlagewerk der amerikanischen Literaturgeschichte zu finden. Nach einer amerikanischen Neuausgabe vor wenigen Jahren in ist das kaum siebzig Seiten umfassende Buch jetzt in deutscher Übersetzung auch am einstigen Schauplatz seiner Handlung angekommen.
Zum fiktiven Eindruck des Authentischen tragen das Fehlen eines Untertitels, eines Vorworts und jeder Kommentierung von Briefen bei, die scheinbar getreu nach ihren originalen Vorlagen wiedergegeben sind. Sie folgen den Anfechtungen und dem Niedergang einer intimen Freundschaft und datieren allesamt aus der kurzen und doch Welten und Zivilisationen voneinander trennenden Zeitspanne zwischen Ende 1932 und Anfang 1934. In San Francisco hatten Max Eisenstein und sein deutscher Partner Martin Schulse gemeinsam eine florierende Kunstgalerie betrieben, bis der Deutsche kurz vor Hitlers Machtantritt in seine Heimat zurückkehrt. Den neuen Verhältnissen steht er anfangs skeptisch gegenüber, bis er sich aus geschäftstüchtigem Opportunismus, der bald in flammende Begeisterung übergeht, den Nationalsozialisten anschließt und zu Ämtern und Würden gelangt. Auf den Hilferuf Eisensteins, mit dessen Schwester er durch eine leidenschaftliche Liebesbeziehung verbunden war, antwortet Schulse mit der Anrede "Heil Hitler!" und dem kalten Bedauern darüber, "schlechte Nachrichten überbringen zu müssen": Griselle, die als Schauspielerin in Berlin gastiert hatte, wo sie wegen ihres jüdischen Aussehens von der Bühne verjagt worden sei, habe sich verängstigt nach München durchgeschlagen. Dort habe sie die Unvorsichtigkeit besessen, ausgerechnet ihn um Schutz und Obdach zu ersuchen. Von SA-Leuten verfolgt, sei sie bis an seine Haustür gelangt, wo er sie abgewiesen habe: "Ich gehe ins Haus, und nach wenigen Minuten hört sie auf zu schreien." Der Brief endet mit der Aufforderung, von jedem weiteren Kontakt und brieflichem Verkehr Abstand zu nehmen.
Diese Geschichte klingt einfach, beinahe zu einfach und scheint keinem Klischee aus dem Wege zu gehen. Doch der Eindruck täuscht, denn die mit den subtilen Techniken eines Briefromans, dessen Figuren sich wechselseitig selbst erzählen, in dichter Folge aufgebauten Klischees werden durch ihre plötzliche Umkehrung von Grund auf demaskiert. Unmittelbar nach der überbrachten Todesnachricht bricht in den brieflichen Dialog eine zweite Fiktionsebene ein. Indem er im Rollenspiel sämtliche stereotypen Eigenschaften annimmt, die ihm der antisemitischen Logik gemäß anhaften sollen, schlägt und desavouiert Eisenstein die sprachlichen Codierungen des Rassismus mit dessen eigenen Waffen: Da er weiß, daß die Zensur mitliest, schreibt er neue Briefe an Schulse, in denen er unter dem Deckmantel künstlerischer Händel die Rolle eines Verschwörers und Agenten mimt, der sich einer Geheimsprache bedient, um dessen Schlüssel offenbar nur die vermeintlichen Briefpartner wissen. Den Empfänger spricht er jetzt nicht mehr als "Mein lieber Martin" an, sondern als Angehörigen eines Kollektivs, als "Martin, unser lieber Bruder", und informiert ihn über die Wertigkeiten von Ölfarben, über "Rubens, 12 auf 77, blau" und "Giotto, 1 auf 317, grün und weiß", bevor er ihn dem "Gott Mosis" anempfiehlt. Schulse antwortet ein einziges Mal mit einem verzweifelten, über einen Mittelsmann versandten Brief und bittet um Mitleid. Bald darauf geht wieder ein Brief ungeöffnet und mit dem unheimlichen Stempel "Adressat unbekannt" versehen an seinen Absender zurück.
Sobald man dieses kleine Büchlein nicht mehr von der ersten bis zur letzten Seite liest, sondern darin blättert wie in einem Bündel alter Briefe, entpuppt es sich als ein widerständiges Dokument von bestechender Kunstfertigkeit.
Kressmann Taylor: "Adressat unbekannt". Aus dem Amerikanischen übersetzt von Dorothee Böhm. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2000. 69 S., geb., 24,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Diese Sätze, die bereits die anonyme Gewalt der noch kommenden Vernichtungsmaschinerie antizipierten, waren im Oktober 1938 in der amerikanischen Literaturzeitschrift "Story" erschienen. Die dort abgedruckten achtzehn fiktiven Briefe, das eine Telegramm und der täuschend echt faksimilierte Briefumschlag wurden von den Lesern bald von Hand zu Hand und sogar in handkopierter Form weitergereicht, bevor sie im "Reader's Digest" nachgedruckt und im Jahr darauf als selbständige Buchpublikation in hoher Auflage erschienen. Erst als die Realität die Fiktion eingeholt hatte, geriet dieses Meisterwerk einer aufs äußerste verknappten dramatischen Erzählkunst wieder in Vergessenheit. Oder verbot es sich von selbst, fortan von einer fiktiven Schilderung in Form eines kleinen Briefromans zu sprechen? Auch ist der Name seiner Autorin Kathrine Kressmann Taylor, einer ehemaligen Werbetexterin, in keinem Nachschlagewerk der amerikanischen Literaturgeschichte zu finden. Nach einer amerikanischen Neuausgabe vor wenigen Jahren in ist das kaum siebzig Seiten umfassende Buch jetzt in deutscher Übersetzung auch am einstigen Schauplatz seiner Handlung angekommen.
Zum fiktiven Eindruck des Authentischen tragen das Fehlen eines Untertitels, eines Vorworts und jeder Kommentierung von Briefen bei, die scheinbar getreu nach ihren originalen Vorlagen wiedergegeben sind. Sie folgen den Anfechtungen und dem Niedergang einer intimen Freundschaft und datieren allesamt aus der kurzen und doch Welten und Zivilisationen voneinander trennenden Zeitspanne zwischen Ende 1932 und Anfang 1934. In San Francisco hatten Max Eisenstein und sein deutscher Partner Martin Schulse gemeinsam eine florierende Kunstgalerie betrieben, bis der Deutsche kurz vor Hitlers Machtantritt in seine Heimat zurückkehrt. Den neuen Verhältnissen steht er anfangs skeptisch gegenüber, bis er sich aus geschäftstüchtigem Opportunismus, der bald in flammende Begeisterung übergeht, den Nationalsozialisten anschließt und zu Ämtern und Würden gelangt. Auf den Hilferuf Eisensteins, mit dessen Schwester er durch eine leidenschaftliche Liebesbeziehung verbunden war, antwortet Schulse mit der Anrede "Heil Hitler!" und dem kalten Bedauern darüber, "schlechte Nachrichten überbringen zu müssen": Griselle, die als Schauspielerin in Berlin gastiert hatte, wo sie wegen ihres jüdischen Aussehens von der Bühne verjagt worden sei, habe sich verängstigt nach München durchgeschlagen. Dort habe sie die Unvorsichtigkeit besessen, ausgerechnet ihn um Schutz und Obdach zu ersuchen. Von SA-Leuten verfolgt, sei sie bis an seine Haustür gelangt, wo er sie abgewiesen habe: "Ich gehe ins Haus, und nach wenigen Minuten hört sie auf zu schreien." Der Brief endet mit der Aufforderung, von jedem weiteren Kontakt und brieflichem Verkehr Abstand zu nehmen.
Diese Geschichte klingt einfach, beinahe zu einfach und scheint keinem Klischee aus dem Wege zu gehen. Doch der Eindruck täuscht, denn die mit den subtilen Techniken eines Briefromans, dessen Figuren sich wechselseitig selbst erzählen, in dichter Folge aufgebauten Klischees werden durch ihre plötzliche Umkehrung von Grund auf demaskiert. Unmittelbar nach der überbrachten Todesnachricht bricht in den brieflichen Dialog eine zweite Fiktionsebene ein. Indem er im Rollenspiel sämtliche stereotypen Eigenschaften annimmt, die ihm der antisemitischen Logik gemäß anhaften sollen, schlägt und desavouiert Eisenstein die sprachlichen Codierungen des Rassismus mit dessen eigenen Waffen: Da er weiß, daß die Zensur mitliest, schreibt er neue Briefe an Schulse, in denen er unter dem Deckmantel künstlerischer Händel die Rolle eines Verschwörers und Agenten mimt, der sich einer Geheimsprache bedient, um dessen Schlüssel offenbar nur die vermeintlichen Briefpartner wissen. Den Empfänger spricht er jetzt nicht mehr als "Mein lieber Martin" an, sondern als Angehörigen eines Kollektivs, als "Martin, unser lieber Bruder", und informiert ihn über die Wertigkeiten von Ölfarben, über "Rubens, 12 auf 77, blau" und "Giotto, 1 auf 317, grün und weiß", bevor er ihn dem "Gott Mosis" anempfiehlt. Schulse antwortet ein einziges Mal mit einem verzweifelten, über einen Mittelsmann versandten Brief und bittet um Mitleid. Bald darauf geht wieder ein Brief ungeöffnet und mit dem unheimlichen Stempel "Adressat unbekannt" versehen an seinen Absender zurück.
Sobald man dieses kleine Büchlein nicht mehr von der ersten bis zur letzten Seite liest, sondern darin blättert wie in einem Bündel alter Briefe, entpuppt es sich als ein widerständiges Dokument von bestechender Kunstfertigkeit.
Kressmann Taylor: "Adressat unbekannt". Aus dem Amerikanischen übersetzt von Dorothee Böhm. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2000. 69 S., geb., 24,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
»eines der Bücher, das genau das sagt, was es zu sagen hat, in einer Knappheit, in der jedes Wort wichtig ist. Und es fährt ein.« Neue Luzerner Zeitung 20130124
30 Seiten. Nur 30 Seiten, die unter die Haut gehen. Nur 30 Seiten, die die Ausmaße des deutschen Nationalsozialismus zeigen. Es sind nur wenige Briefe zwischen zwei einstigen Geschäftspartnern und auch Freunden. Innerhalb weniger Monate zerbricht das Band einer innigen Freundschaft, um …
Mehr
30 Seiten. Nur 30 Seiten, die unter die Haut gehen. Nur 30 Seiten, die die Ausmaße des deutschen Nationalsozialismus zeigen. Es sind nur wenige Briefe zwischen zwei einstigen Geschäftspartnern und auch Freunden. Innerhalb weniger Monate zerbricht das Band einer innigen Freundschaft, um sich der Gewalt der Diktatur zu beugen. Allerdings nicht ganz ohne Folgen. Plötzlich beginnen die Geschehnisse eine tragische Wendung anzunehmen, bis das Unfassbare passiert.<br />"Adressat unbekannt" schildert innerhalb von wenigen Seiten und Briefen die tragischen Ausmaße eines menschenverachteten Systems. Ich bekam eine Gänsehaut beim Lesen der letzten Seiten. Ich finde dieses Buch eignet sich ideal, um Schülern im Geschichts- oder Deutschunterricht die Schrecken unter Hitlers Regime nahe zu bringen, denn so bekommt man einen persönlicheren Eindruck der damaligen Zeit.
Weniger
Warum bewertest du das Buch nur mit einem Stern, und schreibst gleichzeitig nur Positiv darüber? Leicht verwirrend!
am 17.09.2012
Warum wurde das Buch schlecht bewertet? Die Rezension ist doch positiv.
Broschiertes Buch Sehr beeindruckend! Es ist nur ein relativ kurzer Briefwechsel, aber er gibt diese schlimme Zeit und vor allem, was sie aus den Menschen macht, wunderbar wieder! Ich habe am Ende insgeheim mit Max triumphiert..
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Adressat unbekannt
Zur Vorgeschichte: Die beiden Freunde Martin Schulse und der Jude Max Eisenstein studierten gemeinsam in Deutschland. Nach ihrem Studium wandern sie als mittellose Künstler nach Amerika aus, wo sie gemeinsam eine gut laufende Galerie aufbauen. Martin ist verheiratet und …
Mehr
Adressat unbekannt
Zur Vorgeschichte: Die beiden Freunde Martin Schulse und der Jude Max Eisenstein studierten gemeinsam in Deutschland. Nach ihrem Studium wandern sie als mittellose Künstler nach Amerika aus, wo sie gemeinsam eine gut laufende Galerie aufbauen. Martin ist verheiratet und hat Familie. 1932 kehrt er nach München zurück, weil er möchte, dass seine Kinder in Deutschland aufwachsen. Max führt derweil die Galerie weiter und überweist Martin regelmäßig seine Anteile am Gewinn. Zum Kundenstamm gehören vorwiegend ältere „jüdische Matronen“.
Der Briefroman setzt ein, als Martin Schulse 1932 bereits wieder in München lebt, wo er mit seinem erworbenen Reichtum ein Schloss erwerben kann. Die Bevölkerung in Deutschland leidet zu dieser Zeit unter einer Wirtschaftskrise, es herrscht viel Arbeitslosigkeit, Armut und Unzufriedenheit.
Im ersten Brief, der datiert auf den 12. November 1932 erkundigt sich Max bei Martin wie er sich in München eingelebt hat. Anhand der danach alle 3-6 Wochen folgenden Briefe, kann man mitverfolgen, wie sich in Deutschland die Stimmung ändert. Der Nationalsozialismus verbreitet sich und die skeptische und anfänglich „nur“ opportunistische Haltung von Martin Schulse wandelt sich in einen Fanatismus, der darin gipfelt, dass Martin zwar gerne das Geld aus der Galerie annimmt, aber sonst den Kontakt zu Max abbrechen möchte, weil er sich in seiner Position keinen Briefkontakt zu einem Juden leisten kann. Max darf, wenn es denn nötig ist, die Briefe nur noch mit der Geschäftspost an die Bank richten.
Max Eisensteins Schwester Griselle ist Schauspielerin und nimmt ein Engagement an einem Berliner Theater an. Bald ist der Antisemitismus so verbreitet, dass sie in Bedrängnis gerät. Ein Brief, den Max an Griselle richtet, kommt zurück mit dem Vermerk „Adressat unbekannt“. Max fürchtet das Schlimmste und bittet Martin um Hilfe
Der Briefkontakt geht weiter bis zum 3. März 1934. Für das Verständnis des Romans ist es von Vorteil, wenn man mit den wichtigsten Eckdaten der Geschichte wie der Machtergreifung Hitlers und der Judenverfolgung etwas vertraut ist. Im zweiten Teil des Briefromans nimmt die Handlung eine unerwartete Wendung. Der von seinem Freund schwer enttäuschte Max wechselt in seinen Briefen, die er wieder an die Privatadresse von Martin schickt, zu einem auffallend freundlichen Ton und lässt die Gefahr zwischen den Zeilen lauern.
Eine Geschichte, die zur Zeit des Nationalsozialismus spielt, wie es recht viele gibt, könnte man im ersten Moment meinen. Doch weit gefehlt! Die Qualität dieses Werks liegt nicht mur im originellen Format des Briefromans. Die amerikanische Autorin Katherine Kressmann Taylor hat dieses Buch im Jahre 1938 veröffentlicht, im Jahr der Reichsprogromnacht. Zu einer Zeit also, wo in Deutschland angeblich noch viele Leute „nicht wussten“ was mit der jüdischen Bevölkerung geschah und was es mit Konzentrationslagern auf sich hatte.
Das Hörbuch ist gesprochen von Matthias Brandt und Stephan Schad. Ich war beeindruckt von der Eiseskälte, die Stephan Schad Martin Schulse in den Mund zu legen vermag. Auch Matthias Brandt interpretiert die Briefe aus Eisensteins Feder mit sehr warmem, freundschaftlichem Ton, aber auch die panische Angst um seine Schwester kann man förmlich spüren.
Ich habe dieses relativ kurze Hörbuch von 60 Minuten Dauer mehrmals sehr aufmerksam gehört und konnte jedes mal wieder einen neuen Aspekt entdecken, der mir bislang entgangen war. Es gibt noch immer ein paar Punkte, die ich noch nicht bis ins letzte Detail verstanden habe. Aber ich denke ich habe den Sinn zwischen den Zeilen von Eisensteins letzten Briefen richtig interpretiert und am Ende stockte mir echt der Atem.
Ein kurzes Buch in einer meisterhaften Hörbuch Umsetzung, das mich sehr berührt hat. Von mir 5 Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für