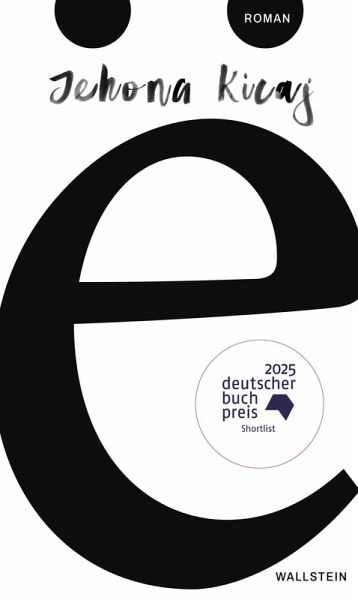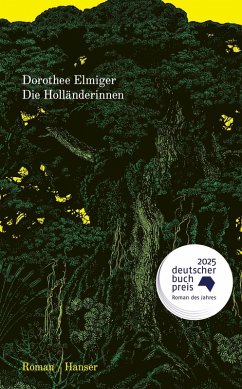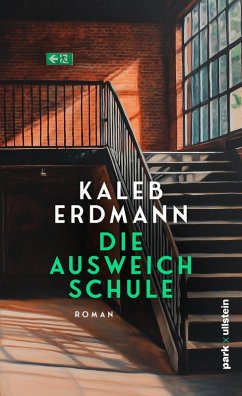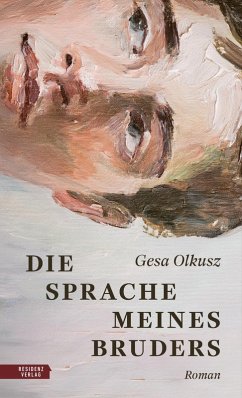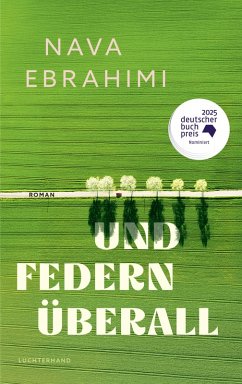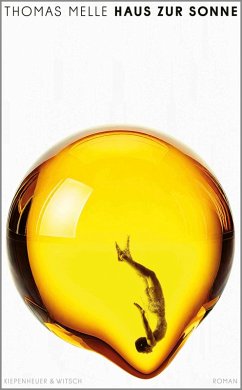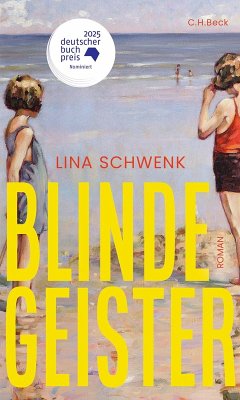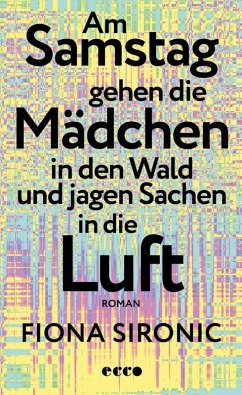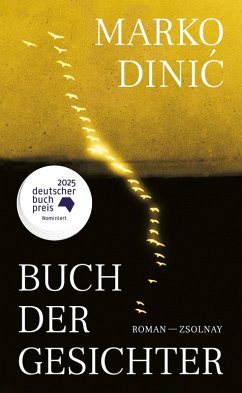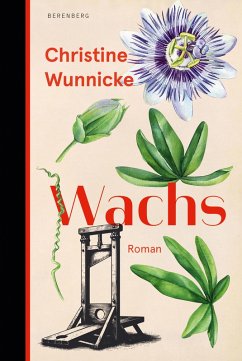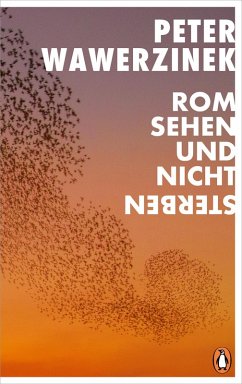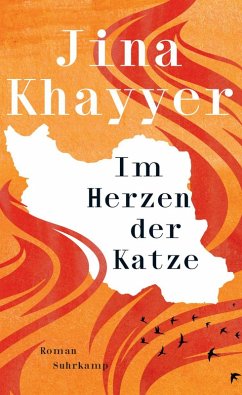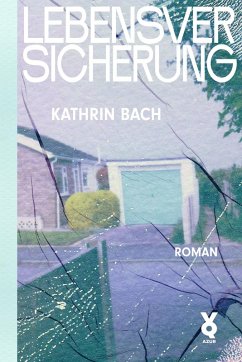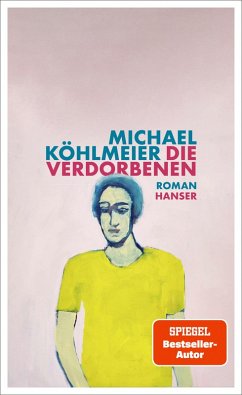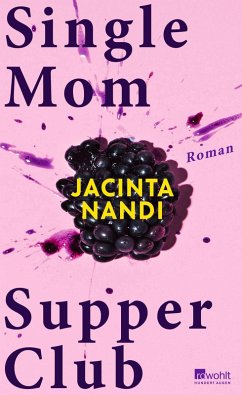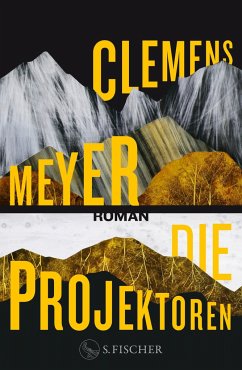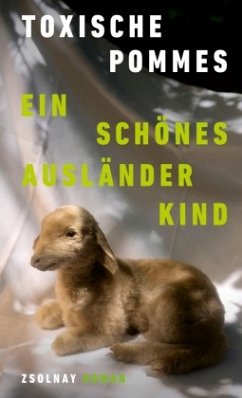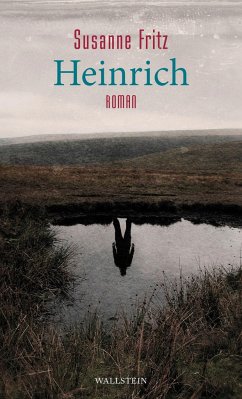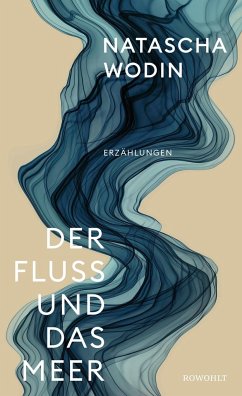Versandkostenfrei!
Versandfertig in ca. 2 Wochen
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Ein stilles und zugleich sprachmächtiges Buch, das vom Verlust der Heimat durch Krieg, von Schmerz und Sprachverlust erzählt. In diesem ergreifenden Debüt findet die Autorin eine großartige eigene Sprache.Der ungewöhnliche Titel »ë« steht für einen Buchstaben, der in der albanischen Sprache eine wichtige Funktion hat, obwohl er meist gar nicht ausgesprochen wird. Als Kind von Geflüchteten aus dem Kosovo ist die Erzählerin auf der Suche nach Sprache und Stimme. Sie wächst in Deutschland auf, geht in den Kindergarten, zur Schule und auf die Universität, sucht nach Verständnis, aber...
Ein stilles und zugleich sprachmächtiges Buch, das vom Verlust der Heimat durch Krieg, von Schmerz und Sprachverlust erzählt. In diesem ergreifenden Debüt findet die Autorin eine großartige eigene Sprache.Der ungewöhnliche Titel »ë« steht für einen Buchstaben, der in der albanischen Sprache eine wichtige Funktion hat, obwohl er meist gar nicht ausgesprochen wird. Als Kind von Geflüchteten aus dem Kosovo ist die Erzählerin auf der Suche nach Sprache und Stimme. Sie wächst in Deutschland auf, geht in den Kindergarten, zur Schule und auf die Universität, sucht nach Verständnis, aber stößt immer wieder auf Zuschreibungen, Ahnungslosigkeit und Ignoranz.Als der Kosovokrieg Ende der 90er-Jahre wütet, erlebt sie ihn aus sicherer Entfernung. Doch auch in der Diaspora sind Krieg und Tod präsent - sie werden nur anders erlebt als vor Ort.Der Roman »ë« erzählt von dem in Deutschland kaum bekannten Kosovokrieg und erinnert an das Leid von Familien, die ihre Heimat verloren haben, deren ermordete Angehörige anonym verscharrt wurden und bis heute verschollen oder nicht identifiziert sind. Eine Vergangenheit, die nicht vergehen kann, weil sie buchstäblich in jeder Faser des Körpers steckt, wird von Jehona Kicaj im wahrsten Wortsinn zur Sprache gebracht.
Jehona Kicaj, geb. 1991 in Kosovo und aufgewachsen in Göttingen, studierte Philosophie, Germanistik und Neuere Deutsche Literaturwissenschaft in Hannover. Nach wissenschaftlichen Publikationen erscheinen von ihr seit 2020 auch literarische Texte. Sie ist Mitherausgeberin der Anthologie »"Und so blieb man eben für immer". Gastarbeiter:innen und ihre Kinder« (2023). Der Roman »ë« ist ihr Debüt.
Produktdetails
- Verlag: Wallstein
- Seitenzahl: 169
- Erscheinungstermin: 23. Juli 2025
- Deutsch
- Abmessung: 204mm x 128mm x 20mm
- Gewicht: 279g
- ISBN-13: 9783835359499
- ISBN-10: 3835359495
- Artikelnr.: 73962353
Herstellerkennzeichnung
Wallstein Verlag GmbH
Geiststraße 11
37073 Göttingen
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Laut Rezensent Tilman Spreckelsen fügt die aus dem Kosovo stammende Jehona Kicaj mit ihrem Roman dem Bild vom Ankommen und Aufwachsen in Deutschland eine Farbe hinzu, indem sie über Heimat und Heimatsuche erzählt und das Schicksal ihrer auf ihre Kindheit zurückblickende Protagonistin transzendiert. Es geht um Leben und Tod in diesem Text, um Verdrängung und um eine Realität, die durch Sprache entsteht, erklärt Spreckelsen. Wie in Deutschland mit den Geschehnissen im Kosovo umgegangen wurde, ist für die kindliche Protagonistin irritierend, für den Leser nicht minder, ahnen wir.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ein Text, der komplett von der Sprache und all ihren Aspekten her konstruiert und gedacht ist. (...) Dieser Text ist wirklich sehr fein, hochpoetisch erzählt.« (Lara Sielmann, Deutschlandfunk Kultur, 11.08.2025) »Der Roman steht verdientermaßen auf der Longlist zum den Deutschen Buchpreis (...). Jehona Kicaj hat Worte für das Unsagbare gefunden.« (Bernd Melichar, Kleine Zeitung, 23.08.2025) »Den vielen Büchern (...), die zuletzt vom Ankommen und Aufwachsen in Deutschland berichtet haben, fügt dieses eine Farbe hinzu, die bislang gefehlt hat.« (Tilman Spreckelsen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05.09.2025) »Kicaj (...) hat das eindringlichste Debüt dieses Herbstes geschrieben, einen Roman, der schon mit seinen ersten Szenen klarmacht, was er kann.« (Marc Reichwein, Welt am Sonntag, 08.09.2025) »Jehona Kicaj ist ein atemberaubendes Romandebüt gelungen, das einen in der deutschsprachigen Literatur noch kaum beleuchteten Krieg mitten in Europa ins Licht rückt.« (Cornelius Hell, Die Presse, 20.09.2025)
Romane, die das Leben von Geflüchteten oder Migranten in Deutschland literarisch verarbeiten, haben sich längst als fester Bestandteil des deutschsprachigen Buchmarktes etabliert. Sie erzählen von der Suche nach einer neuen Heimat, während die alte Herkunft und Geschichte …
Mehr
Romane, die das Leben von Geflüchteten oder Migranten in Deutschland literarisch verarbeiten, haben sich längst als fester Bestandteil des deutschsprachigen Buchmarktes etabliert. Sie erzählen von der Suche nach einer neuen Heimat, während die alte Herkunft und Geschichte weiterhin präsent bleibt. Auch 2025 wird dieser Trend mit neuen Stimmen fortgeführt. Unter den aktuellen Veröffentlichungen hat es Jehona Kicaj mit ihrem Roman „ë“ sogar auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Kicaj selbst kam als Kind mit ihrer Familie aus dem Kosovo nach Deutschland, und diese Erfahrung bildet den Kern ihres literarischen Debüts.
Auf vergleichsweise engem Raum schildert sie ihre Ankunft, die ersten Schritte der Eingliederung und vor allem den mühsamen Zugang zur deutschen Sprache. Anfangs noch mit hörbarem Akzent gesprochen – besonders das rollende „r“ bleibt ein Hindernis – wird Deutsch nach und nach zur eigentlichen Muttersprache, während das Albanische immer fremder erscheint. Kicaj zeigt, wie Sprache Identität verschieben und Zugehörigkeit verändern kann. Zugleich beschreibt sie das Leben ihrer Familie in der neuen Umgebung, das geprägt ist von Anpassungsversuchen, aber auch von Missverständnissen, Rückschlägen und der Erfahrung offener wie subtiler Fremdenfeindlichkeit.
Doch so sehr „ë“ von Migrationserfahrungen handelt, so auffällig ist auch die Distanz, die der Roman zum eigentlichen Ursprungsgeschehen wahrt. Kicaj hat den Kosovo-Krieg nicht unmittelbar miterlebt. Sie kennt ihn lediglich durch Erzählungen von Angehörigen oder durch mediale Berichterstattung. Diese Entfernung, die für viele vergleichbare Bücher untypisch ist, macht „ë“ zwar eigen, zugleich aber auch angreifbar. Der Roman bleibt häufig an der Oberfläche, wiederholt bekannte Muster des Genres und bietet nur selten Perspektiven, die Leser ohne persönlichen Bezug zum Kosovo überraschen oder bereichern könnten.
Gerade im Vergleich zu anderen Werken wirkt Kicajs Buch dadurch schwach. Es mangelt an prägnanten Details, die neue Einsichten eröffnen, und an erzählerischem Raffinement. Statt einer klaren Dramaturgie reiht die Autorin Erinnerungen, Eindrücke und Gedanken lose aneinander. Der Text springt durch Zeiten und Themen, ohne dass daraus eine zwingende Entwicklung entsteht. Ein Beispiel ist die ausgedehnte Episode über eine Zahnbehandlung. Anfangs sorgt sie für Irritation, doch sobald klar wird, dass es sich um ein Symbol handelt, breitet Kicaj die metaphorische Bedeutung derart ausführlich aus, dass der Leserschaft keine eigene Deutung mehr bleibt.
So bleibt am Ende der Eindruck, dass nicht jede persönliche Erinnerung automatisch literarische Kraft entfaltet. „ë“ wirkt trotz autobiografischer Grundlage eher wie ein Konstrukt, das Distanz wahrt, statt emotionale Nähe aufzubauen. Das Buch ist kurz, detailarm und berührt nur bedingt. Für Leser mit eigenen Migrationserfahrungen oder mit direktem Bezug zum Kosovo mag es ansprechend sein. Für ein breiteres Publikum aber reiht es sich eher unscheinbar zwischen zahlreichen anderen Migrationsromanen ein und vermag kaum, eine nachhaltige Wirkung zu hinterlassen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Dieses Buch habe ich im Rahmen des #Longlistenlesens für den deutschen Buchpreis 2025 gelesen. Es hat mich sehr berührt. Die Geschichte der jungen Frau, die aus dem Kosovo flieht und mit so vielen Dingen konfrontiert wird, hat mich bewegt und beschäftigt mich immer noch.
Dieses Buch …
Mehr
Dieses Buch habe ich im Rahmen des #Longlistenlesens für den deutschen Buchpreis 2025 gelesen. Es hat mich sehr berührt. Die Geschichte der jungen Frau, die aus dem Kosovo flieht und mit so vielen Dingen konfrontiert wird, hat mich bewegt und beschäftigt mich immer noch.
Dieses Buch ist nicht nur absolut richtig notiert (und definitiv ein Kandidat für die Shortlist), sondern es bewegt und beschäftigt. Es ist stilistisch gut geschrieben, fesselt und beeindruckt gleichermaßen. Es konfrontiert und zwingt hinzusehen. Zu Gewalt und Verletzungen, zu Trauma und Erinnerungen. Kriegserleben findet nicht erst seit gestern statt, aber der Ukraine Krieg hat eine Menge Erinnerungen hochgeholt. Ein echtes und authentisches Buch, ein Buch das keine Geschichte erzählt, sondern die Wirklichkeit. Ein Buch das so wichtig ist!
Die junge Frau lebt bereits eine Weile in Deutschland und wird, ausgelöst durch den Ukraine Krieg, gedanklich in die Kriegsgeschehnisse in den Kosovo katapultiert. Sie berichtet von einer Zerrissenheit und einem Herz, dass in zwei Richtungen schlägt. Die Frage, die ich mir immer stelle ist, ob es das muss. Ob man sich entscheiden muss. Ob man nicht beides kann - ganz gleich wo man ist. Vergangenheit und Heimat. Oder Heimat und Heimat. Im Herzen! Sehr zu empfehlen! (gern auch für alle blauen Wähler)
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
So viele vergiftete Erinnerungen
Jehona Kicaj ist eine junge albanischsprachige Kosovarin, die seit ihrer Kindheit in Deutschland lebt. Als ich im Herbst 1989 das erste Mal im damaligen Jugoslawien, in Dubrovnik, Urlaub machte, erfuhr ich auch zum ersten Mal vom Kosovo, von Kosovoalbanern, die …
Mehr
So viele vergiftete Erinnerungen
Jehona Kicaj ist eine junge albanischsprachige Kosovarin, die seit ihrer Kindheit in Deutschland lebt. Als ich im Herbst 1989 das erste Mal im damaligen Jugoslawien, in Dubrovnik, Urlaub machte, erfuhr ich auch zum ersten Mal vom Kosovo, von Kosovoalbanern, die ihre Identität nicht öffentlich machen wollten. Danach – in Deutschland war man gefühlt nur noch mit Mauerfall und Wende beschäftigt – begannen die Kriege, die auch das Kosovo und seine Bewohner zerstörten. Eine Flut von Flüchtlingen wurde in Deutschland aufgenommen, aber das wurde nicht so thematisiert wie jetzt, rund 34 Jahre später, der Ukrainekrieg. Für die Deutschen sind diese Kriege weit weg (gewesen). Aber die psychischen Traumata der Opfer und Vertriebenen, der Flüchtlinge klingen lange nach, werden uns noch lange begleiten. So, wie die Autorin heute davon berichtet, werden es später die Ukrainer oder Syrer sein, die ihre Erlebnisse und Wunden erst noch verarbeiten müssen.
Der Roman „ë“ hat wohl den kürzesten Titel, den ein Buch überhaupt haben kann, wenn man bedenkt, dass es teilweise in der albanischen Sprache auch noch ein stummer Laut ist, verschwindet er fast hinter der Geschichte. Und die spielt in der heutigen Zeit, man bemerkt es leider an der etwas aufgesetzt wirkenden geschlechtergerechten Sprache. Dabei ist es das Deutsch, dass offenbar in seiner Härte und Schwierigkeit der Ich-Erzählerin, vielleicht heißt auch sie Jehona, ein a am Ende des Namens ist sicher, einer Studentin, die sich einerseits mit der Heilung ihres verkrampften Kiefergelenks und andererseits mit den Erinnerungen an ihre Kindheit und die traurige Geschichte des Kosovo befasst, so sehr zu schaffen macht. Die auf Stress zurückgeführten Kiefergelenksbeschwerden lässt sie abwechselnd von einem Zahnarzt und einer Osteopathin behandeln, mit wenig Erfolg. Jehona will sich durchbeißen, sie ist und bleibt in der Diaspora, entkommt dabei weder ihren Gedanken noch ihren Gefühlen.
Der Leser erfährt Unbekanntes oder Vergessenes über den Kosovokrieg, der auch vor kleinen Kindern und Schulkindern nicht halt machte. Die Szenen sind bedrückend, lassen mich oft an die Ukraine denken, aber auch an den Zweiten Weltkrieg und seine Auswirkungen. Sehr anschaulich wird das besonders in den Seminaren der anthropologischen Forensikerin Dr. Joana Korner, die Jehona besucht. Hier geht es sehr ins Detail der mörderischen Verbrechen, die im Kosovo geschehen sind und von denen bei Weitem noch nicht alle aufgeklärt wurden. In einem der Seminare kommt auch der ehemalige Wohnort von Jehona, Suhareka, zur Sprache, seine etymologische Herkunft: „Der Ort, an dem die Sprache versiegt“, denkt Jehona, „daher komme ich also.“ Sie begreift ihre Schweigsamkeit, ihr Zurückgezogensein, ihre Introvertiertheit als Ergebnis ihrer Herkunft und ihres Schicksals. Aber sie wird dessen nicht Herr, nicht in diesem Buch.
Denn das Fremdsein hat immer zwei Seiten, zwei Richtungen, die eigene, die das Zentrum bildet, und die andere, alles Äußere Einschließende. Man kann von Jehonas Einzelflüchtlingsschicksal auf Geflüchtete und Schutz in anderen Ländern oder Regionen Suchende verallgemeinern, dass die Fremdheit sich auf Generationen ausdehnt, dass sie nie ganz verschwindet. Das betrifft in Deutschland die nach dem Zweiten Weltkrieg Vertriebenen und Geflüchteten ebenso wie jetzt die Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, der Ukraine oder anderen Ländern. Oft schlagen ihnen Vorurteile, Unwillen oder Abneigung entgegen. Aber diese Menschen kommen auch mit eigenen Vorurteilen, oft einer gegensätzlichen Kultur oder Religion ins Land.
Sehr berührend sind die Szenen, in denen Jehonas Verwandte von Erlebnissen und Ereignissen während des Kosovokrieges erzählen, ihre Cousine Shpresa war auch noch ein Kind, als sie das alles erlebte. Jehona aber war mit ihren Eltern noch vor Ausbruch der schlimmsten Gewalt nach Deutschland geflohen. Alles, was sie weiß, erfährt sie aus zweiter Hand. Vielleicht liegt auch hier ein psychologisches Problem, die Schuld, dass ihr selbst nichts passiert ist. „Nur“ das Haus und die Heimat waren verloren. Daran beißt sie sich möglicherweise immer weiter die Zähne aus.
Für Jehona scheint die Zeit noch nicht reif, ihr Wissen, ihre Hintergrundgedanken, ihre Beweggründe für ihr Handeln und Denken mit anderen zu teilen. Selbst mit ihrem Freund Elias findet sie nicht immer eine Basis für ihre Gespräche, das stumme ë ist nicht nur ein Buchstabe, es ist Synonym ihrer im Mund gefrorenen Worte. Zerbeißen kann sie sie nicht.
...
Fazit: Ein sehr nachdenklich stimmendes Buch, dass ich aufmerksam gelesen habe. Jehona Kicaj verwendet eine Sprache, die versucht klar und rein zu klingen, so wie sie als Kind versuchte, hundertprozentig gutes Deutsch zu sprechen. Und doch bleiben die Gedanken im Roman poetisch, wenn auch nicht immer nachvollziehbar.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Authentisch und lesenswert;
Dieses Buch hat mir sehr gut gefallen und ich finde, dass es die Nominierung für den Deutschen Buchpreis wirklich verdient hat. Die Erzählerin ist eine junge Frau, die in verschiedenen Erzählszenarien wiederkehrende Erzählstränge schildert. Die …
Mehr
Authentisch und lesenswert;
Dieses Buch hat mir sehr gut gefallen und ich finde, dass es die Nominierung für den Deutschen Buchpreis wirklich verdient hat. Die Erzählerin ist eine junge Frau, die in verschiedenen Erzählszenarien wiederkehrende Erzählstränge schildert. Die Episoden beim Zahnarzt zeigen eindringlich, dass sie etwas Unbenanntes zu verarbeiten hat. Gleichzeitig gibt es Erinnerungen an die erste Zeit in Deutschland, prägende Begegnungen, Studium, Treffen mit der Familie und deren Erinnerungen. Dazu kommt eine Vortragsreihe über den Kosovo und grausame Details über den Krieg. Als Leser pendelt man mit der Erzählerin zwischen Distanz und Betroffenheit. Der Schreibstil ist sachlich und fast neutral, nie belehrend, aber doch auch eindringlich und die junge Erzählerin wirkte auf mich alt, entwurzelt und auch ein bisschen desillusioniert. Sehr gut beschreiben fand ich den Spagat zwischen Sprachlosigkeit und Assimilation in der neuen Heimat. Durch die Stimmen und Erinnerungen der Familie werden Fluchterinnerungen geteilt und die Ängste der Älteren, die fürchten, dass die Kinder das Wesentliche ihrer Kultur vergessen. Auf mich wirkte das Buch sehr authentisch und ich finde die Darstellungen der verschiedenen Erlebnisse und Gefühle sehr feinfühlig und reflektiert.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Gemeinsam mit ihren Eltern floh sie vor vielen Jahren nach Deutschland. Das Ankommen gestaltete sich schwierig und schon in Kindergarten begann für sie die Erfahrung des „Andersseins“. Stets war sie darauf bedacht, niemals aufzufallen und möglichst angepasst zu sein. Oft …
Mehr
Gemeinsam mit ihren Eltern floh sie vor vielen Jahren nach Deutschland. Das Ankommen gestaltete sich schwierig und schon in Kindergarten begann für sie die Erfahrung des „Andersseins“. Stets war sie darauf bedacht, niemals aufzufallen und möglichst angepasst zu sein. Oft schweifen ihre Gedanken ab in die Vergangenheit. Denn ihre Heimat kann sie nicht vergessen.
Welch grausames Schicksal mussten die Menschen erleben, die im schrecklichen Krieg gegen Serbien angegriffen wurden. Realistisch und sehr emotional schildert die Autorin Jehona Kicaj in „ë“ die Erlebnisse ihrer Verwandten, die in Albanien geblieben sind. Neben den Ereignissen der Gegenwart berichtet die Ich-Erzählerin immer wieder auch Erfahrungen aus der Vergangenheit. Während des „Kosovo-Krieges“.
Ein Buch, das mich berührte und beschämte. Zu wenig interessierte mich damals das Schicksal der Betroffenen des Krieges. Aus dem Grund bin ich der Autorin sehr dankbar, dass sie mir auf diese Weise die Augen öffnete. Ich nehme das Buch als Anlass für das Lesen weitergehender Literatur. Für dieses Werk gebe ich sehr gerne eine Sternenregen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für