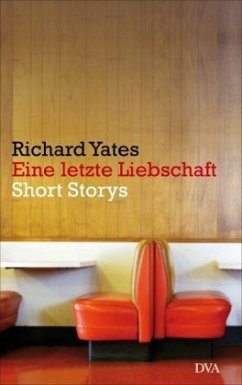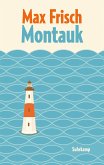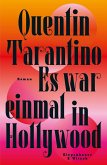Kein Wort zu viel und trotzdem alles gesagt: Die letzten Erzählungen vom Meister der kurzen Form
Richard Yates gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller der US-amerikanischen Nachkriegsgeneration, für manche ist er der »missing link« zwischen Tennessee Williams und Raymond Carver. Der Band Eine letzte Liebschaft versammelt die neun letzten noch nicht auf Deutsch veröffentlichten Erzählungen des Autors. Ganz gleich, ob er das unterdrückte Begehren einer Hausfrau in der Vorstadt thematisiert, die Verzweiflung eines Büroangestellten in Manhattan oder das gebrochene Herz einer alleinerziehenden Mutter - niemand porträtiert die Alltagshoffnungen und -enttäuschungen seiner Figuren so schonungslos, doch mitfühlend wie Richard Yates.
Richard Yates gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller der US-amerikanischen Nachkriegsgeneration, für manche ist er der »missing link« zwischen Tennessee Williams und Raymond Carver. Der Band Eine letzte Liebschaft versammelt die neun letzten noch nicht auf Deutsch veröffentlichten Erzählungen des Autors. Ganz gleich, ob er das unterdrückte Begehren einer Hausfrau in der Vorstadt thematisiert, die Verzweiflung eines Büroangestellten in Manhattan oder das gebrochene Herz einer alleinerziehenden Mutter - niemand porträtiert die Alltagshoffnungen und -enttäuschungen seiner Figuren so schonungslos, doch mitfühlend wie Richard Yates.

Er war der illusionslose Porträtist Amerikas. Nun erscheinen die letzten auf Deutsch noch unpublizierten Geschichten von Richard Yates.
Von Verena Lueken
Es ist immer dasselbe. Nach ein paar Seiten von Richard Yates denkt man, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn jedes Buch mit dieser Sorgfalt fürs Detail, für jedes Motiv geschrieben wäre, für die Wörter und Sätze, aus denen schließlich Figuren werden, und in Szenen und Geschichten kumulieren, mal wie ein Sketch, mal in Essig und Öl.
Um nicht missverstanden zu werden: Einige dieser Geschichten sind zum Heulen. Weil sie von Menschen handeln, die zwar immer noch die letzte Hoffnung auf etwas Glück im Leben nicht aufgegeben haben, deren Scheitern selbst an den schon heruntergedimmten Träumen wir aber von den ersten Sätzen an ahnen. "An dem Tag, nachdem ihn seine Frau verlassen hatte, ging George Pollock, Rechnungsprüfer der American Bearing Company, zum ersten Mal seit zwanzig Jahren im Restaurant frühstücken. Bei dem Versuch, eine Papierserviette unversehrt aus dem festen Griff des Spenders zu ziehen, zerfetzte er die ersten drei, und als er verhindern wollte, dass ihm die Aktentasche im Schoß rutschte, hätte er fast ein Glas Wasser umgestoßen." So beginnt "Der Rechnungsprüfer und der wilde Wind". Jeder Anflug von Komik verlässt die Phantasie, wenn man weiterliest, von dem schlabberigen Frühstücksei und später dem unbeholfenen Versuch, mit der Kellnerin anzubandeln. Was bleibt, ist eine düstere Traurigkeit. Nicht nur darüber, wie die Welt diesen George Pollock behandelt, sondern auch darüber, dass sie Männer wie ihn hervorbringt.
In dem Band "Eine letzte Liebschaft" sind jene Geschichten von Richard Yates (der von 1926 bis 1992 lebte) versammelt, die zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlicht wurden. Jedenfalls nicht in Buchform. Zwei der Geschichten erschienen in den siebziger Jahren im Literaturmagazin "Ploughshares" und wurden mit den anderen "uncollected stories" 2001 als letzter Teil des großen Geschichtenbands "The Collected Stories of Richard Yates" beim amerikanischen Henry Holt Verlag herausgebracht. In Deutschland kümmert sich die DVA um das Werk von Yates und legt nach zwei früheren Erzählbänden und den Romane nun diesen mit den neun letzten Geschichten vor.
Wer ein wenig mit dem Leben des Autors vertraut ist, kann sich vorstellen, in welchem Zustand er sie geschrieben hat. Sein Werk fand kaum Resonanz, sein Verlag interessierte sich nicht für ihn. Yates war seit langem krank. Alkoholiker. Geplagt von mehreren Hernien und einem Emphysem. Arm, Kettenraucher, der Verwahrlosung nah. Abhängig von Menschen, die ihm auf die Straße halfen, seinen Rollstuhl schoben, aufpassten, dass er mit seiner Zigarette nicht den Sauerstofftank explodieren ließ, den er hinter sich her zog oder neben sich stehen hatte.
Und dieser Mann setzt sich täglich an seinen Schreibtisch, um zu schreiben - von Frauen, die an die falschen Männer geraten, weil die eigenen langweilig oder nicht da sind; von Partys, auf denen Ehepaare, die voneinander kaum etwas wissen, beieinander stehen, zu viele Martinis trinken und mit fragwürdigen Heldentaten aus dem Krieg prahlen, dem sie entkommen sind; von Veteranen, die kriegsversehrt in Lazaretten liegen und sich nachts durch die hintere Latrinentür in die nächste Dorfkneipe schleichen oder vom Eheglück mit einer der Schwestern träumen oder immer wieder, während sie sich an den Rand des Erstickungstods husten, Geschichten aus Kämpfen erzählen, die sie einst noch kämpfen konnten.
Yates widmet diesen Menschen seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Der Beschreibung ihrer zerschundenen Körper und Seelen gibt er alles, was er sprachlich aufzubieten hat. In der Geschichte "Diebe" klingt das so: "Nach dem Wegbringen der Tabletts, wenn die Sonne lange gelbe Streifen auf den Fußboden unter den westlichen Fenstern warf und auf ihrem Weg die silbernen Speichen der Rollstühle erglänzen ließ, entstand auf der Tuberkulosestation stets eine Pause; in dieser Zeit versammelten sich die meisten der dreißig Männer, die auf der Station lebten, in kleinen Gruppen, um sich zu unterhalten oder Karten zu spielen." Yates schreibt "after the wheeling-out of supper trays", da ist "nach dem Wegbringen" in der ansonsten fast immer sicheren Übersetzung von Thomas Gunkel eine der weniger gelungenen Formulierungen, und auch die "Pause" könnte, da Yates sie "a lull" (was eher eine Flaute ist, sinnlicher vorstellbar), etwas weniger nüchtern daherkommen. Aber die Szene behält auch so ihre Poesie, weil man spürt, wie die Männer, die gerade weder essen noch behandelt werden noch sprechen, ihren Gedanken nachhängen und dabei im Augenblick nicht verzweifelt sind.
Yates kannte Veteranenkrankenhäuser wie das, von dem er hier erzählt. Er wurde selbst viele Male dort behandelt, so dass er verfügte, seinen letzten Roman, den er nicht mehr vollenden konnte ("Uncertain Times"), den Frauen und Männern aus der Veteranenbetreuung zu widmen, "in Dankbarkeit für ihre Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit sowie ihre medizinische Versorgung".
Zwei der letzten neun Geschichten ereignen sich in Hospitälern für Soldaten, in zwei weiteren spielt der Krieg eine Rolle, und in der allerletzten geht es um einen Mann, der sich nach einem Krankenhausaufenthalt zu Hause erholen soll. In all diesen Geschichten ist der Autor in einer Weise präsent, in der die Zeit, in der er schrieb und in der die Geschichten spielen, zusammenschnurrt zu einer Raum der spezifisch amerikanischen Einsamkeit - voller Selbsttäuschungen, aber ohne Hoffnung.
Bis auf den Schluss. Da kommt zwischen Bill, einem kranken Mann, und seiner Frau Jean ein glückliches Ende zustande. Bill hat eine Tasse zerschlagen, und während er auf seine Frau wartet, gibt er sich Phantasien darüber hin, wie er das wiedergutmachen könnte. Wie er als ganzer Mann aus dieser Situation herauskäme. Wie er, statt schwach und krank, attraktiv und selbstbewusst die Szene, die er erwartet, meistern würde. Das ist brillant komponiert, jedes Szenario in Bills Phantasie ein eigener Kurzgeschichtenentwurf, jede Figur, zu der Bill sich in seiner Vorstellung macht, ein typischer Yates-Held. Und dann das Ende: in einer Szene, die weder Bill noch der Leser sich je hätte träumen lassen.
Richard Yates: "Eine letzte Liebschaft". Short Storys.
Aus dem Englischen von Thomas Gunkel. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2016. 208 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

grauen Flanell
Warum man nach Trumps Wahlsieg die neu
entdeckten Storys von Richard Yates lesen muss
VON CHRISTOPHER SCHMIDT
Jonathan Franzen schrieb einmal, es seien die Fünfzigerjahre gewesen, die den Sechzigern ihren Idealismus gaben, „ihren Idealismus – und ihre Wut“. Er meinte damit den Idealismus, von dem die sozialen Umwälzungen getragen waren, die Amerika in den Sechzigerjahren erlösen wollten vom puritanischen Erbe und vom Druck des Konformismus. Und er meinte die aufgestaute Wut der Fünfziger, aus der sich diese Befreiungsbewegungen speisten.
Ein Mann, der beides in sich vereinte, war der amerikanische Schriftsteller Richard Yates (1926 bis 1992). Wut und Idealismus bilden in seinem Werk die Grundspannung des Erzählens. Yates war ein Vorreiter jener Umbrüche, die Amerika veränderten wie nichts zuvor, ein erbitterter Beobachter der Inkubationszeit von sexueller Revolution und Studentenprotesten, Counter Culture und Beat Generation. Sein bevorzugtes Forschungsgebiet hieß Suburbia, und sein Anschauungsobjekt war der damalige Durchschnittsamerikaner, der dem gesellschaftlichen Wandel mit Unbehagen und Verständnislosigkeit begegnete. Ein Amerikaner wie George Pollock aus einer von Yates’ Geschichten. Den ganzen unerlösten Widerspruch der Fünfzigerjahre trägt diese Geschichte bereits in ihrem Titel: „Der Rechnungsprüfer und der wilde Wind“, heißt sie.
Die ersten Sätze dieser Geschichte gehen so: „An dem Tag, nachdem ihn seine Frau verlassen hatte, ging George Pollock, Rechnungsprüfer der American Bearing Company, zum ersten Mal seit zwanzig Jahren im Restaurant frühstücken. Bei dem Versuch, eine Papierserviette unversehrt aus dem festen Griff des Spenders zu ziehen, zerfetzte er die ersten drei, und als er verhindern wollte, dass ihm die Aktentasche vom Schoß rutschte, hätte er fast ein Glas Wasser umgestoßen.“ Stummer Zeuge dieser unfreiwilligen Slapstick-Szene ist ein „grobgesichtiger Mann, dessen Lippen von einem Marmeladendonut weiß gepudert“ sind, eine Art höhnischer Clown.
Solche Missgeschicke werden Pollock weiterverfolgen an diesem Tag, an dem er aus der Bahn geworfen wurde. Ein Flirt mit einer hübschen irischen Kellnerin soll ihm als eine Art Papierserviette für die Seele dienen, mit der er die Demütigungen und Niederlagen wegzuwischen versucht. Doch als er nach Büroschluss und ein paar Martinis endlich den Mut findet, sie anzusprechen, erregt Pollock sofort ihren Widerwillen, weil er dabei den Arm der jungen Frau festhält. Sie reißt sich los und stürmt auf die Straße; er folgt ihr bis zum Eingang der U-Bahn und packt sie erneut. Kein Pussy-Grab, aber ein klarer Übergriff, eine Grenzverletzung auch damals in den Fünfzigerjahren.
Diese Geschichte und acht weitere finden sich in einem gerade auf Deutsch erschienenen Band, der die zu Lebzeiten des Autors unveröffentlichten Short Storys aus seinem Nachlass versammelt (Richard Yates: Eine letzte Liebschaft. Short Storys. Aus dem Englischen von Thomas Gunkel. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2016. 208 Seiten, 19,99 Euro). Richard Yates zu lesen, diesen unversöhnlichen Chronisten der amerikanischen Mentalitätsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, ist immer ein Gewinn. Aber jetzt, nach der Wahl von Donald Trump, liest man sie noch einmal anders, diese Geschichten über ein scheinbar besseres Amerika der Vergangenheit, zu dem Trump zurückwill und unter dem Yates zu seiner Zeit litt.
Mit kaltem Grimm schrieb er an gegen die Dämonen der Fünfzigerjahre: den Konformismus und den naiven Glauben an den sozialen Aufstieg, die politische Apathie und die Vergötzung der family values, die Selbstverständlichkeit von Rassen- und Klassenprivilegien und das Diktat des positiven Denkens, das sich leicht in ein selbstzerstörerisches Ungeheuer verwandelt und dann nur noch mit der akzeptierten Droge Alkohol besänftigt werden kann. Yates hielt Amerika den Spiegel vor und zeigte es als ein Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten, und er protokollierte genau, wie sich Wut und Enttäuschung, statt sich nach außen zu wenden und politischer Protest zu werden, gegen die Schwächeren kehren, und sei es auch nur als ein zu fester Griff am Arm. Frauen sind bei Yates oft die Opfer der frustrierten weißen Männer, die Entlastung vom Anpassungsdruck in einer Affäre suchen.
Immer wieder geht es bei Richard Yates um die kleinen Fluchten in Untreue und Ehebruch. In der Titelgeschichte sagt eine junge Frau kurz vor der Hochzeit zu ihrem Verlobten, auch er würde „jede Gelegenheit für eine letzte Liebschaft ergreifen“, wenn er das Geld dazu hätte. Der Titel von Sloan Wilsons 1955 erschienenem Roman „Der Mann im grauen Flanell“ ist geradezu zum Synonym geworden für jenen Typus, den Yates immer wieder beschrieb: Männer mittleren Alters in Anzügen von Brooks Brothers, die morgens mit leeren Gesichtern die Pendelzüge nach Manhattan besteigen. Männer, die zeternde Ehefrauen mit den Worten „Halt einfach den Mund“ zum Schweigen bringen, während dieselben Frauen ihnen noch schnell das Abendessen aufwärmen, bevor sie den Koffer nehmen und sich für immer aus dem Staub machen. Männer, die Bürojobs nachgehen, die sie hassen und doch nicht aufgeben, weil sie glauben, dass der Wohlstand noch vor ihnen liegt, verlässlich wie der Flugzeugträger der US-Navy, den Betty in einer von Yates’ Geschichten vom Fenster aus sehen kann und dessen Existenz sie als Beruhigung empfindet, „als sei er da, um über sie zu wachen“.
Sloan Wilsons zu seiner Zeit viel gelesener Mittelstands-Roman „Der Mann im grauen Flanell“ kippt im zweiten Teil überraschend in ein klebriges Aufstiegsmärchen à la Frank Capra, als hätte der Autor Angst bekommen vor dem sozialen Sprengstoff, den er im ersten Teil des Buches angehäuft hatte. Einer, der diese Angst nicht kannte, war John Cheever, auch wenn er über dasselbe Milieu schrieb. In seinen bösen Romanen erschießt sich schon mal ein Familienvater im Garten, nachdem er das Esszimmer frisch gestrichen hat. Oder ein gestandener Geschäftsmann lässt sich wortlos von einem älteren Fahrstuhlführer mitnehmen in dessen Kabuff, wo beide liebeshungrig übereinander herfallen.
Cheever war ein schreibender Satyr von Suburbia und ein Brunnenvergifter des amerikanischen Idylls, einer, der sich, wie er selbst sagt, als Spion in die Mittelschicht eingeschlichen hatte. In seinem Roman „Bullet Park“ benennt er den Preis, den es kostet, auf dieselbe Art individuell sein zu wollen wie alle anderen: Depression oder Amoklauf. Das eine ist nur die Kehrseite des anderen. Gleich zu Beginn beschimpft er die „Legionen von partnertauschenden, judenhetzerischen, trunksüchtigen geistigen Bankrotteuren in ihren weißen Häusern, die bis zur Dachrinne mit Hypotheken belastet sind. (…) Verflucht sei ihre Scheinheiligkeit, verflucht ihre Heuchelei, verflucht ihre Kreditkarten.“
Die Ironie des Schicksals wollte es, dass John Cheever Nachmieter wurde von Richard Yates. Er übernahm dessen Cottage in Westchester, einem dieser typischen Pendelorte in der New Yorker Peripherie, über deren Milieu und Moral beide schrieben. Lesen wollte damals kaum jemand, was diese zwei Autoren über das Pandämonium der Fünfzigerjahre zu sagen hatten. In der letzten Geschichte aus Richard Yates’ Band „Eine letzte Liebschaft“ wird eine zerbrochene Tasse zum Menetekel für die Illusion, man könne die Uhren zurückdrehen. Die Geschichte trägt den Titel „Ein genesendes Selbstbewusstsein“.
Nach längerer Krankheit versucht ein junger Familienvater, zu Hause wieder zu Kräften zu kommen. Die Untätigkeit und das knappe Geld machen ihm zu schaffen. Dass er sich auf keine andere Weise nützlich machen kann als im Haushalt, empfindet er als entwürdigend. Als ihm bei Spülen eine Teetasse zerbricht, macht er sich solche Vorwürfe, dass er beschließt, noch am selben Tag wieder arbeiten zu gehen. Die Geschichte nimmt eine erstaunliche Wendung, als seine heimgekehrte Frau alle Schuld auf sich nimmt und ihn tröstend in die Arme schließt. Auf den ersten Blick wirkt das wie ein Happy End, doch der Schein trügt, beschämt ihn doch die Großherzigkeit seiner Frau tiefer als alles andere. Erst jetzt, da ihm verziehen wird, ist es nicht mehr nur eine Teetasse, die in Scherben liegt, sondern sein ganzes Leben. Denn er muss sich eingestehen, dass es für ihn kein Zurück gibt zu alter Größe. Gebrochener könnte er nicht enden, der amerikanische Traum vom „Great Again“.
Zuerst streicht Vater das
Esszimmer. Danach erschießt
er sich im Garten
Richard Yates auf der Motorhaube seines alten Mazda.
Foto: Gina Yates
Geschichten von Frauen, die ihren Männern erst das Abendessen aufwärmen, bevor sie ihren Koffer packen und ihre Familie für immer verlassen. New York, um 1962.
Foto: Wayne Miller/Magnum Photos
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensentin Verena Lueken könnte heulen angesichts der Geschichten von Richard Yates. Auch wenn darin immer nur Verlierer und Verlorene vorkommen, Yates gibt ihr doch das Gefühl, die Welt sei ein guter Ort, solange nur jemand so sorgfältig erzählt wie dieser Autor. Die nie zuvor in Buchform erschienenen vorliegenden neun Texte gemahnen Lueken auch an das Schicksal dieses geschmähten Autors, der seine letzten Tage in Veteranenkliniken rumbrachte. Das Personal und die Geschichten, die er dort vorfand, lernt Lueken jetzt kennen und staunt, wie viel Aufmerksamkeit der Autor ihnen widmet und ihren geschundenen Seelen und welche Poesie er ihnen abgewinnt. Nie wurde von der amerikanischen Einsamkeit brillanter erzählt als hier, meint Lueken.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
«Richard Yates zu lesen, diesen unversöhnlichen Chronisten der amerikanischen Mentalitätsgeschichte nachdem Zweiten Weltkrieg, ist immer ein Gewinn.» Süddeutsche Zeitung, Christopher Schmidt
»Yates zu lesen ist immer ein Gewinn.« Süddeutsche Zeitung