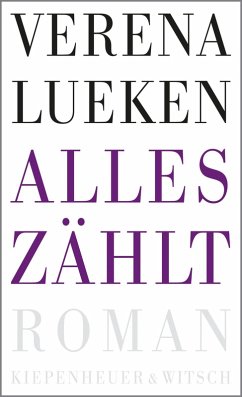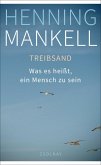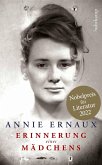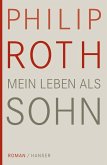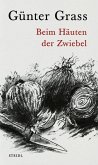"New York im Sommer. Beißendes Licht, brüllende Hitze, eine erbärmliche Zeit, um zu sterben. Sie las diese Sätze in einem Roman von James Salter, dessen Bücher sie in diesen Wochen kennenlernte, schaute sich um und dachte, er hat recht."
So beginnt der Roman "Alles zählt" von Verena Lueken. Ich
wollte eigentlich nur kurz hineinlesen - doch mit den ersten Sätzen bin ich sogleich gebannte…mehr"New York im Sommer. Beißendes Licht, brüllende Hitze, eine erbärmliche Zeit, um zu sterben. Sie las diese Sätze in einem Roman von James Salter, dessen Bücher sie in diesen Wochen kennenlernte, schaute sich um und dachte, er hat recht."
So beginnt der Roman "Alles zählt" von Verena Lueken. Ich wollte eigentlich nur kurz hineinlesen - doch mit den ersten Sätzen bin ich sogleich gebannte Leserin!
Denn die namenlose Protagonistin beschäftigt sich gleich in den ersten Tagen ihrer Ankunft in New York mit dem Roman "Alles was ist" von James Salter und ist ebenso angetan davon wie ich.
Überhaupt ist es ein Buch über Literatur, übers Schreiben, übers Lesen. Es ist aber vor allem auch ein Buch, dass sich mit der Krankheit Krebs und dem Sterben auseinandersetzt und gleichzeitig ein Rückblick und eine Annäherung an die Mutter. Und irgendwie ist es noch so vieles mehr...
Verena Luekens Buch hat mich ziemlich "mitgenommen" in vielerlei Hinsicht. Es ist eine sehr intensive Leseerfahrung gewesen, die mich aufgrund der Thematik und der Herangehensweise der Autorin nicht loslässt. Ich finde es wirklich außergewöhnlich.
Die Protagonistin kommt nach New York, um zu schreiben, zu recherchieren, nachzudenken über neue Projekte. Sie liebt New York, lebt aber die meiste Zeit in Frankfurt am Main. Sie wohnt in der Wohnung von Bekannten, flaniert durch Haarlem, springt in Kindheitserinnerungen. Die Mutter, immer auf Reisen, oft mit dem Geliebten, ließ die Tochter oft allein, der Vater war kaum sichtbar. Die Mutter bleibt wichtigste Person, auch nach deren Tod.
"Sie hatte, auch weil ihre Mutter ihr keine Wahl gelassen hatte, immer mit der Möglichkeit des Sterbens gelebt, fast solange sie denken konnte. Nicht mit dem eigenen zunächst, aber um sie herum starben die Menschen oder drohten damit. Sie selbst hatte sich eine Weile danach gesehnt und dann nicht mehr."
Der Krebs kommt in New York wieder, bereits vor 15 Jahren war sie in ihrer Zeit in der Stadt an Lungenkrebs erkrankt. Damals war sie geheilt worden. Nun unterzieht sie sich erneut dort einer OP. An ihrer Seite der Gefährte S., der aus Frankfurt anreist. Begleitet wird sie in dieser Zeit auch von einer Freundin, der Witwe Harold Brodkeys. Auch Brodkey hatte ein Buch im Angesicht seines nahen Todes geschrieben.
Doch an schreiben ist für sie nicht zu denken. Die OP gelingt, doch das Martyrium der Schmerzen, durch dass sie danach geht, lässt sie monatelang zwischen Tod und Leben wandeln. Medikamente, die lindern sollen, helfen nicht, schließlich setzt sie sie ab.
"Es kam eine Zeit, da schaute sie sich beim Totsein zu. Sie hatte den Teufel angefleht, das Stück, das er sich genommen hatte, wieder herauszurücken. Aber er hatte nur den Arm gehoben, als wolle er sie grüßen, und sich dann umgedreht. Er hatte alles bekommen, ihr Leben."
Nach Wochen, Monaten mit Rückfällen findet sie sich wieder im Leben. "Ich bin hier".
Kurz darauf bricht sie auf nach Myanmar, allein, wo sie bereits vor Jahren war und wo sie einem besonderen Menschen begegnet war, einem, der sie seltsam berührte. Sie findet ihn nicht mehr, Doch findet sie dort einen, der ihr gleich vertraut ist und der ihr vorbehaltlos von sich erzählt. Sie taucht ein in ein andere Lebensgeschichte. Etwas kann neu beginnen...
Verena Luekens Roman ist ein gelungenes Beispiel, wie gut Autobiografisches zu Literatur werden kann, was bei diesem Thema umso erstaunlicher ist.