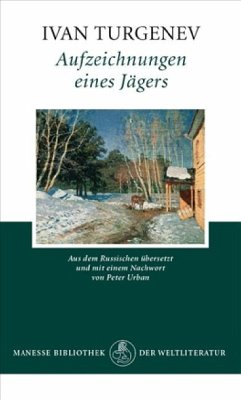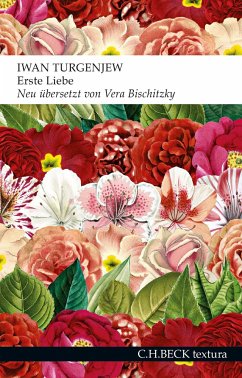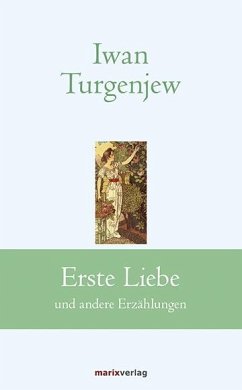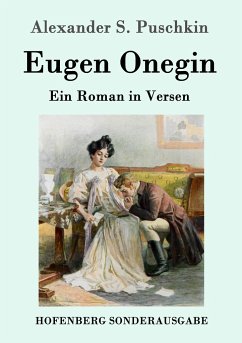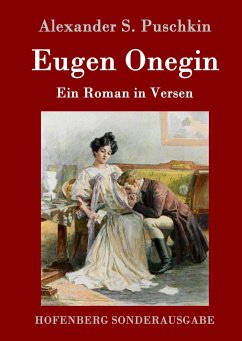Iwan Aleksandrowitsch Gontscharow
Buch mit Leinen-Einband
Oblomow
Roman. Nachw. v. Fritz Ernst
Übersetzung: Brauner, Clara
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





Mit tatenloser Träumerei hat Ilja Oblomow sprichwörtliche Berühmtheit erlangt: als russischer Don Quijote, als zwar begabter, doch tragisch fauler und lethargischer Romanheld, der auf der Suche nach dem verlorenen Paradies scheitert.Für den gebildeten jungen Oblomow hält die Zukunft genau zwei Lebenswege bereit, die beide auf ihre Art unbefriedigend sind: die Karriere im Staatsdienst oder die Arbeit als Gutsherr. Der junge Adelige entscheidet sich für sein Landgut und versinkt fortan in Träumerei, Schlaf und grenzenlose Faulheit. Zwar entwickelt der phantasievolle Idealist ständig neue...
Mit tatenloser Träumerei hat Ilja Oblomow sprichwörtliche Berühmtheit erlangt: als russischer Don Quijote, als zwar begabter, doch tragisch fauler und lethargischer Romanheld, der auf der Suche nach dem verlorenen Paradies scheitert.
Für den gebildeten jungen Oblomow hält die Zukunft genau zwei Lebenswege bereit, die beide auf ihre Art unbefriedigend sind: die Karriere im Staatsdienst oder die Arbeit als Gutsherr. Der junge Adelige entscheidet sich für sein Landgut und versinkt fortan in Träumerei, Schlaf und grenzenlose Faulheit. Zwar entwickelt der phantasievolle Idealist ständig neue Pläne, beispielsweise darüber, wie das Leben seiner Landarbeiter grundlegend zu verbessern sei. Doch tatsächlich gelingt es ihm nicht einmal, tagsüber das Bett zu verlassen. Auch die Liebe Olgas kann ihn nur kurz von seiner Antriebslosigkeit befreien. Als die tatkräftige junge Frau sich enttäuscht von ihm abwendet, heiratet Oblomow die einfältige Wirtin Agafja und verzichtet so endgültig darauf, sein Leben von Grund auf zu ändern.
Iwan Gontscharow (1812-1891) eroberte sich mit diesem seinem wichtigsten Roman einen festen Platz neben den großen Realisten der russischen Literatur, neben Dostojewski, Tolstoi und Turgenev. Seine Prosa zeichnet die äußerst genaue Charakterisierung seiner Figuren aus und eine weise Zurückhaltung, wenn es darum geht, Urteile über sie zu fällen. Natürlich ist Oblomow ein beispielloser Faulpelz. Doch seine Untüchtigkeit hat, wie Fritz Ernst in seinem Nachwort schreibt, auch etwas Zartes, Vornehmes, für viele Menschen Unerreichbares.
Für den gebildeten jungen Oblomow hält die Zukunft genau zwei Lebenswege bereit, die beide auf ihre Art unbefriedigend sind: die Karriere im Staatsdienst oder die Arbeit als Gutsherr. Der junge Adelige entscheidet sich für sein Landgut und versinkt fortan in Träumerei, Schlaf und grenzenlose Faulheit. Zwar entwickelt der phantasievolle Idealist ständig neue Pläne, beispielsweise darüber, wie das Leben seiner Landarbeiter grundlegend zu verbessern sei. Doch tatsächlich gelingt es ihm nicht einmal, tagsüber das Bett zu verlassen. Auch die Liebe Olgas kann ihn nur kurz von seiner Antriebslosigkeit befreien. Als die tatkräftige junge Frau sich enttäuscht von ihm abwendet, heiratet Oblomow die einfältige Wirtin Agafja und verzichtet so endgültig darauf, sein Leben von Grund auf zu ändern.
Iwan Gontscharow (1812-1891) eroberte sich mit diesem seinem wichtigsten Roman einen festen Platz neben den großen Realisten der russischen Literatur, neben Dostojewski, Tolstoi und Turgenev. Seine Prosa zeichnet die äußerst genaue Charakterisierung seiner Figuren aus und eine weise Zurückhaltung, wenn es darum geht, Urteile über sie zu fällen. Natürlich ist Oblomow ein beispielloser Faulpelz. Doch seine Untüchtigkeit hat, wie Fritz Ernst in seinem Nachwort schreibt, auch etwas Zartes, Vornehmes, für viele Menschen Unerreichbares.
Iwan Aleksandrowitsch Gontscharow wurde am 18. 6. 1812 in Simbirsk als Sohn eines Kaufmanns geboren. Nach dem Studium der Literatur war er einige Jahre im Staatsdienst tätig. Seine Karriere als gefeierter Romancier des russischen Realismus begann 1847 mit dem ersten Roman 'Eine alltägliche Geschichte' und erreichte ihren Höhepunkt mit 'Oblomow' (1859). Gontscharow starb am 27. 9. 1891 in St. Petersburg.
Produktdetails
- Manesse Bibliothek der Weltliteratur
- Verlag: Manesse
- Originaltitel: Oblomow
- 1980.
- Seitenzahl: 685
- Deutsch
- Abmessung: 155mm
- Gewicht: 322g
- ISBN-13: 9783717515784
- ISBN-10: 3717515780
- Artikelnr.: 01660197
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.03.2012
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.03.2012Das große Fressen für Weltverweigerer
Vera Bischitzkys Neuübersetzung von Iwan Gontscharows Wunderroman "Oblomow"
Von Andreas Platthaus
Es ist ein Teufelskreislauf, den Iwan Gontscharow in seinem 1859 erschienenen Roman "Oblomow" den Titelhelden abschreiten lässt. Dabei ist dieser dreißigjährige Ilja Iljitsch Oblomow nicht nur von Dämonen, sondern auch von einigen Engeln umgeben. Und das Leben könnte so angenehm für ihn sein: Als in Sankt Petersburg wohnender Gutsbesitzer gebietet er über ein Dorf mit dreihundert Seelen, also Leibeigenen, und bezieht von dort regelmäßige Einkünfte und Abgaben. Doch da ist die Unentschiedenheit von Oblomow, die ihn aus Sorge vor den Unwägbarkeiten des Schicksals zu einem
Vera Bischitzkys Neuübersetzung von Iwan Gontscharows Wunderroman "Oblomow"
Von Andreas Platthaus
Es ist ein Teufelskreislauf, den Iwan Gontscharow in seinem 1859 erschienenen Roman "Oblomow" den Titelhelden abschreiten lässt. Dabei ist dieser dreißigjährige Ilja Iljitsch Oblomow nicht nur von Dämonen, sondern auch von einigen Engeln umgeben. Und das Leben könnte so angenehm für ihn sein: Als in Sankt Petersburg wohnender Gutsbesitzer gebietet er über ein Dorf mit dreihundert Seelen, also Leibeigenen, und bezieht von dort regelmäßige Einkünfte und Abgaben. Doch da ist die Unentschiedenheit von Oblomow, die ihn aus Sorge vor den Unwägbarkeiten des Schicksals zu einem
Mehr anzeigen
gänzlich passiven Menschen werden lässt, einem Anti-Odysseus. Nennt Homer seinen fahrenden Helden einen "edlen Dulder", der umso berechtigter Ruhm und Ehre beanspruchen darf, weil er sich dem Schicksal stellt, so charakterisiert Gontscharow seine unbewegliche Hauptfigur als ängstlichen Zauderer, der das Fatum flieht. Da jede Handlung Konsequenzen hat, kann aus seiner Sicht nur völlige Apathie das Böse zuverlässig bannen. Das Gute indes bannt sie auch.
"Oblomow" ist aber nicht nur moralisch ein Schwellenbuch, sondern auch literaturgeschichtlich: der erste der großen russischen Romane aus der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Tolstoi hat ihn geliebt, und wenn man liest, was für ein Frauenbild Gontscharow in seinem Roman inszeniert, dann sieht man sofort, dass sich die Figur der Anna Karenina nicht nur dem Vorbild von Nikolai Tschernyschewskis "Was tun" verdankt (der vier Jahre nach "Oblomow" erschien, als es zum guten Ton der russischen Intelligenz gehörte, aus Gontscharows Roman zu zitieren).
Und das Buch ist ein Welterfolg. Allein acht Mal wurde der Roman ins Deutsche übertragen; die jüngste, gerade bei Hanser erschienene Fassung stammt von Vera Bischitzky, die 2010 mit ihrer fulminanten Übersetzung von Gogols "Toten Seelen" Anspruch auf den Platz anmeldete, den die im selben Jahr verstorbene großartige Svetlana Geier innehatte. Sie hatte mit ihren Neuübersetzungen der Romane Dostojewskis seit Ende der achtziger Jahre jene Welle von Publikationen ausgelöst, die uns die Hauptwerke der russischen Literatur neu geschenkt hat. Auch "Oblomow", seit 1960 nicht mehr neu ins Deutsche übertragen, ist einer ihrer Ausläufer. Hoffentlich strandet noch viel mehr an.
Vera Bischitzky übersetzt den Roman mit leichter Hand, ihre Dialoge lesen sich wunderbar, die beschreibenden Passagen sind mustergültig präzise und poetisch. In ihren reichen Anmerkungen preist sie jedoch die eigene Leistung selbst ein wenig zu sehr an, und es hat schon eine komische Komponente, dass ausgerechnet in Oblomows Brief an die von ihm geliebte Olga, der zu seiner vollsten rhetorischen Zufriedenheit ausfällt, folgende Passage in der deutschen Fassung zu lesen ist: "In meinem tiefen Kummer tröste ich mich ein wenig damit, dass mir diese kurze Episode in unserem Leben für immer eine reine, duftige Erinnerung hinterlassen wird, die allein schon bewirkt, dass ich nicht wieder in meinen früheren Dämmerzustand zurückfalle . . ." Komisch nicht, weil genau das später doch wieder geschieht, sondern weil sich Oblomow zuvor an seiner stilistischen Geschicklichkeit bei der Niederschrift erfreut hatte: "Kein einziges Mal kam es zu einer dichten, unangenehmen Begegnung zweier welcher und zweier dass." Doch genau das unterläuft Bischitzky.
Nun hat Reinhold von Walter diese Passage in seiner noch heute greifbaren klassischen Übersetzung von 1926, die Bischitzky bisweilen als (negativer) Vergleichsmaßstab dient, nicht besser gemeistert. Aber wie steht es etwa hiermit: "Ebenso vorsichtig und sachte wie mit der Phantasie ging er auch mit seinem Herzen um. Da er häufig strauchelte, musste er sich eingestehen, dass die Sphäre der Herzensdinger noch eine terra incognita war." So weit Bischitzky. Von Walter übersetzt umständlicher: "Nicht minder fein und vorsichtig wie die Phantasie beobachtete er auch das Erlebnis seines Herzens. Hier ging er freilich des öfteren in die Irre und musste bekennen, dass die Sphäre der Führungen des Herzens noch unbekanntes Land sei." Bischitzky rettet den lateinischen Terminus des Originals, lässt aber die Zuordnung ihres "Strauchelns" unklar werden. Ein simples "dabei" oder "hierbei" hätte gereicht.
Doch das Leitprinzip ihrer neuen Übersetzung ist erkennbar Entschlackung. Und das ist gut so, denn dadurch wird erkennbar, dass "Oblomow" nicht nur ein Virtuosenstück der Sprache darstellt. Es ist nun leichter, Gontscharows Roman als große Allegorie auf das zaristische Russland zu lesen - als Riesenreich, das angesichts der Herausforderungen durch Moderne und Weltpolitik in gespenstische Starre verfiel. Nicht umsonst schrieb Gontscharow am "Oblomow" während und unmittelbar nach dem Krimkrieg und siedelte das Geschehen im Buch kurz davor an. Das Verhalten seines Helden wurde denn auch sprichwörtlich, nicht nur in Russland. Im Roman prägt der deutschstämmige Freund Oblomows mit dem sprechenden Namen Andrej Stolz den berühmten Begriff für sein verhängnisvolles Zögern: oblomowschtschina - die Oblomowerei (auch Bischitzky bewahrt das eingeführte Wort). Lieber ein Schrecken ohne Ende als ein etwaiges Ende mit Schrecken.
Das entsprach zeitweise Gontscharows eigenen Erfahrungen bei der Niederschrift des Romans. Zehn Jahre mussten die russischen Leser nach der Einzelpublikation des berühmten neunten Kapitels mit dem Namen "Oblomows Traum" noch auf den fertigen "Oblomow" warten, weil Gontscharow sich immer wieder außerstande fühlte, die unterlassenen Handlungen dieses Weltverweigerers im Dienste einer Schlaraffenlandutopie, die aus nichts als Schlafen, Essen, Reden und Spazierengehen bestehen sollte, mit der nötigen Konsequenz auszumalen.
Nach Don Quijote ist Oblomow der zweite große Antiheld der Literaturgeschichte, aber sein Buch treibt ihn bis in den Tod. Man weiß es (oder spürt es sonst), und doch wünscht man ihm 750 Seiten lang nur einmal jenen Funken Initiative, der ihn gerettet hätte. Und der das Buch verdorben hätte. Denn es ist ja, wie Oblomows Freund Stolz, der am Ende des Romans zum wahren Helden (und zum am positivsten gezeichneten Deutschen in der russischen Literatur) wird, feststellt: "Das wäre eine andere Geschichte gewesen und ein anderer Held, der uns nichts angeht."
Ein Ende mit Schrecken, das wir als Leser fürchten, ist der Schlusssatz eines guten Romans. Der von "Oblomow" lädt sofort zum Wiedereinstieg am Anfang ein - zum literarischen Engelskreislauf.
Iwan Gontscharow: "Oblomow". Roman in vier Teilen.
Aus dem Russischen von Vera Bischitzky. Hanser Verlag, München 2012. 840 S., geb., 34,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Oblomow" ist aber nicht nur moralisch ein Schwellenbuch, sondern auch literaturgeschichtlich: der erste der großen russischen Romane aus der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Tolstoi hat ihn geliebt, und wenn man liest, was für ein Frauenbild Gontscharow in seinem Roman inszeniert, dann sieht man sofort, dass sich die Figur der Anna Karenina nicht nur dem Vorbild von Nikolai Tschernyschewskis "Was tun" verdankt (der vier Jahre nach "Oblomow" erschien, als es zum guten Ton der russischen Intelligenz gehörte, aus Gontscharows Roman zu zitieren).
Und das Buch ist ein Welterfolg. Allein acht Mal wurde der Roman ins Deutsche übertragen; die jüngste, gerade bei Hanser erschienene Fassung stammt von Vera Bischitzky, die 2010 mit ihrer fulminanten Übersetzung von Gogols "Toten Seelen" Anspruch auf den Platz anmeldete, den die im selben Jahr verstorbene großartige Svetlana Geier innehatte. Sie hatte mit ihren Neuübersetzungen der Romane Dostojewskis seit Ende der achtziger Jahre jene Welle von Publikationen ausgelöst, die uns die Hauptwerke der russischen Literatur neu geschenkt hat. Auch "Oblomow", seit 1960 nicht mehr neu ins Deutsche übertragen, ist einer ihrer Ausläufer. Hoffentlich strandet noch viel mehr an.
Vera Bischitzky übersetzt den Roman mit leichter Hand, ihre Dialoge lesen sich wunderbar, die beschreibenden Passagen sind mustergültig präzise und poetisch. In ihren reichen Anmerkungen preist sie jedoch die eigene Leistung selbst ein wenig zu sehr an, und es hat schon eine komische Komponente, dass ausgerechnet in Oblomows Brief an die von ihm geliebte Olga, der zu seiner vollsten rhetorischen Zufriedenheit ausfällt, folgende Passage in der deutschen Fassung zu lesen ist: "In meinem tiefen Kummer tröste ich mich ein wenig damit, dass mir diese kurze Episode in unserem Leben für immer eine reine, duftige Erinnerung hinterlassen wird, die allein schon bewirkt, dass ich nicht wieder in meinen früheren Dämmerzustand zurückfalle . . ." Komisch nicht, weil genau das später doch wieder geschieht, sondern weil sich Oblomow zuvor an seiner stilistischen Geschicklichkeit bei der Niederschrift erfreut hatte: "Kein einziges Mal kam es zu einer dichten, unangenehmen Begegnung zweier welcher und zweier dass." Doch genau das unterläuft Bischitzky.
Nun hat Reinhold von Walter diese Passage in seiner noch heute greifbaren klassischen Übersetzung von 1926, die Bischitzky bisweilen als (negativer) Vergleichsmaßstab dient, nicht besser gemeistert. Aber wie steht es etwa hiermit: "Ebenso vorsichtig und sachte wie mit der Phantasie ging er auch mit seinem Herzen um. Da er häufig strauchelte, musste er sich eingestehen, dass die Sphäre der Herzensdinger noch eine terra incognita war." So weit Bischitzky. Von Walter übersetzt umständlicher: "Nicht minder fein und vorsichtig wie die Phantasie beobachtete er auch das Erlebnis seines Herzens. Hier ging er freilich des öfteren in die Irre und musste bekennen, dass die Sphäre der Führungen des Herzens noch unbekanntes Land sei." Bischitzky rettet den lateinischen Terminus des Originals, lässt aber die Zuordnung ihres "Strauchelns" unklar werden. Ein simples "dabei" oder "hierbei" hätte gereicht.
Doch das Leitprinzip ihrer neuen Übersetzung ist erkennbar Entschlackung. Und das ist gut so, denn dadurch wird erkennbar, dass "Oblomow" nicht nur ein Virtuosenstück der Sprache darstellt. Es ist nun leichter, Gontscharows Roman als große Allegorie auf das zaristische Russland zu lesen - als Riesenreich, das angesichts der Herausforderungen durch Moderne und Weltpolitik in gespenstische Starre verfiel. Nicht umsonst schrieb Gontscharow am "Oblomow" während und unmittelbar nach dem Krimkrieg und siedelte das Geschehen im Buch kurz davor an. Das Verhalten seines Helden wurde denn auch sprichwörtlich, nicht nur in Russland. Im Roman prägt der deutschstämmige Freund Oblomows mit dem sprechenden Namen Andrej Stolz den berühmten Begriff für sein verhängnisvolles Zögern: oblomowschtschina - die Oblomowerei (auch Bischitzky bewahrt das eingeführte Wort). Lieber ein Schrecken ohne Ende als ein etwaiges Ende mit Schrecken.
Das entsprach zeitweise Gontscharows eigenen Erfahrungen bei der Niederschrift des Romans. Zehn Jahre mussten die russischen Leser nach der Einzelpublikation des berühmten neunten Kapitels mit dem Namen "Oblomows Traum" noch auf den fertigen "Oblomow" warten, weil Gontscharow sich immer wieder außerstande fühlte, die unterlassenen Handlungen dieses Weltverweigerers im Dienste einer Schlaraffenlandutopie, die aus nichts als Schlafen, Essen, Reden und Spazierengehen bestehen sollte, mit der nötigen Konsequenz auszumalen.
Nach Don Quijote ist Oblomow der zweite große Antiheld der Literaturgeschichte, aber sein Buch treibt ihn bis in den Tod. Man weiß es (oder spürt es sonst), und doch wünscht man ihm 750 Seiten lang nur einmal jenen Funken Initiative, der ihn gerettet hätte. Und der das Buch verdorben hätte. Denn es ist ja, wie Oblomows Freund Stolz, der am Ende des Romans zum wahren Helden (und zum am positivsten gezeichneten Deutschen in der russischen Literatur) wird, feststellt: "Das wäre eine andere Geschichte gewesen und ein anderer Held, der uns nichts angeht."
Ein Ende mit Schrecken, das wir als Leser fürchten, ist der Schlusssatz eines guten Romans. Der von "Oblomow" lädt sofort zum Wiedereinstieg am Anfang ein - zum literarischen Engelskreislauf.
Iwan Gontscharow: "Oblomow". Roman in vier Teilen.
Aus dem Russischen von Vera Bischitzky. Hanser Verlag, München 2012. 840 S., geb., 34,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Lothar Müller kitzelt in seiner Rezension das Unkomische, Unmelancholische, das ganz und gar Abgründige dieser Figur, dieses Helden der Untätigkeit, heraus. Zwar rät er dem Leser, etwa zur sagenhaften Liebesgeschichte zwischen Oblomow und Olga schön Bellini zu hören. Doch die Kunst, mit der Iwan Gontscharow seine Gestalt über die Langeweile nach der dunklen Seite hin aufschließt, flößt ihm noch mehr Respekt ein. Einen Vorläufer der späteren Beckett-Helden meint er in Oblomow zu erkennen. Sodann zur Neuübertragung: Dankbar zeigt sich Müller, ja sogar überzeugt von der Lebendigkeit und Stilsicherheit Vera Bischitzkys und ihren nützlichen Anmerkungen. Nur geht ihm die Übersetzerin mitunter zu weit, wenn sie ältere Übersetzungen regelrecht hinrichtet, wie Müller erklärt. Reinhold von Walters Oblomow von 1925 jedenfalls möchte der Rezensent gerne auch weiterhin gelten lassen. Die Aufträge für die Neuübersetzung und für das Nachwort, rät Müller schließlich, seien doch des möglichen höheren Niveaus wegen bitte getrennt zu vergeben, nicht als Rundum-Sorglos-Paket. Dieses Nachwort, da ist Müller sich sicher, unterschreitet die Qualität der Übertragung leider deutlich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Vera Bischitzky übersetzt den Roman mit leichter Hand, ihre Dialoge lesen sich wunderbar, die beschreibenden Passagen sind mustergültig präzise und poetisch." Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.03.12 "Jetzt wurde das Buch endlich neu übersetzt. Eine Meisterleistung.[...] Nach sieben Übertragungen ins Deutsche [...] hat sich die Slawistin Vera Bischitzky der großen Sache angenommen, und sie präsentiert einen Roman, dessen ruhiger Fluss, dessen Innehalten und Mäandern in jeder Passage, in jedem einzelnen Satz im Deutschen fühlbar wird. Die versunkene Welt, die sie wiederauferstehen lässt, kann wieder besichtigt, gehört, ertastet, geschmeckt und gerochen werden." Elke Schmitter, Der Spiegel, 15/2012 "Ein völlig entstaubter,
Mehr anzeigen
ganz heutiger ,Oblomow'." Karlheiz Kasper, Neues Deutschland, 17.06.12 "Bischitzky arbeitet mit dem Florett, treffsicher und elegant, alles fließt, pulsiert, verbindet sich logisch und wirkt nie forciert modern, was ja manchmal schlimmer schmerzt als Holperigkeit. Leiden und die Lethargie Oblomows haben hier sprachlich die optimale Therapie erfahren: So überlebt auch ein Lebensuntüchtiger die nächsten 100 Jahre." Werner Theurich, Spiegel Online, 18.06.12 "Ein Jahrhundertwerk. In der neuen Übersetzung von Vera Bischitzky überzeugt es mehr denn je - sowohl durch seinen Witz wie durch seine Tiefe. Ist dieser Roman wirklich schon gut 150 Jahre alt?" Manfred Papst, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 24.06.12 "Eine exquisite Neuübersetzung: Vera Bischitzky hat es nun im Rahmen der verdienstvollen Reihe von Klassiker-Neuübersetzungen im Hanser-Verlag unternommen, ,Oblomow' eine neue sprachliche Gestalt zu geben. Dabei geht es ihr gerade nicht um Modernisierung, sondern sie versucht, das Zeitkolorit des Romans auch im Deutschen zu bewahren." Ulrich M. Schmid, Neue Zürcher Zeitung,16.06.12 "Diese Fassung liest sich vorzüglich und leichthändig; macht den feinen Witz des Romans deutlicher, bringt die einfache, aber rhythmischversierte Prosa Gontscharows zur Geltung, frischt den Roman auf, ohne sich willkürliche Modernisierungen zuschulden kommen zu lassen. Ein Lektürevergnügen." Wolfgang Schneider, DeutschlandradioKultur, 06.06.12 "Die Neuübersetzung des Romans "Oblomow" lädt dazu ein, die Abgründe der Untätigkeit zu erkunden." Lothar Müller, Süddeutsche Zeitung, 18.06.12 "Jetzt kann man die Urgestalt all dieser Zuschreibungen neu entdecken: in der poetisch-rhythmischen "Oblomow"-Übersetzung von Vera Bischitzky ... Bischitzkys Übersetzung legt vor allem Energien und Dynamiken des Originaltexts frei, die die Zeitgenossen von Gontscharow so begeisterten, etwa, wenn sie das Dekor von Oblomows Wohnung zu Beginn des Romans in einer Form entfaltet, dass sich der Leser in den Text betten möchte." Gerald Heidegger, ORF.at, 18.03.12 "Vera Bischitzky [...] verleiht dem Text einen neuen Glanz, indem sie, anders als ihre Vorgänger, die sprachliche Struktur des russischen Originals mit all ihren stilistischenEigentümlichkeiten zu erhalten sucht. Gleichsam Archäologin der Sprache gräbt sie sich durch die Sprachschichten und hebt so manchen Wortschatz, den sie im eindrucksvollen Anmerkungsapparat begeisternd dem Leser von heute näher bringt. Man liest die Anmerkungen der Übersetzerin mit größtem Vergnügen und Gewinn." Ursula Keller, rbb Kulturradio, 02.03.12
Schließen
Broschiertes Buch
Russischer Klassiker ***
Oblomow ist so destruktiv, dass er die ganze Zeit im Bett liegt. Er grübelt über seine Probleme. Seine Wohnung in Petersburg soll er verlassen und aufs Land ziehen, wo er dank des Besitzes seiner Familie ein Gut hat, von dessen Geld er lebt. Seine Einnahmen werden …
Mehr
Russischer Klassiker ***
Oblomow ist so destruktiv, dass er die ganze Zeit im Bett liegt. Er grübelt über seine Probleme. Seine Wohnung in Petersburg soll er verlassen und aufs Land ziehen, wo er dank des Besitzes seiner Familie ein Gut hat, von dessen Geld er lebt. Seine Einnahmen werden aber immer weniger und so hat er überall Schulden, auch beim Metzger und beim Bäcker. Doch all das verdrängt er: „Weder über seine Einkünfte noch über seine Ausgaben wusste er genau Bescheid, auch hatte er nie ein Budget aufgestellt – nichts von alledem.“ (95)***
Sein Diener Sachar liebt seinen Herrn auch nicht. Er hintergeht ihn, wo er nur kann. Dennoch ist er der Einzige neben einem Deutschen, der noch richtigen Kontakt mit ihm hat. Ein anderer Besucher, dessen Name Tarantjew ich vergessen hatte, kommt nur wegen seiner Karriere und leiht sich Sachen aus, die er nicht zurückbringt. Von ihm wird berichtet, dass er es fertigbringt, „Bestechungsgelder von seinen Kollegen und Bekannten anzunehmen.“ (59) ***
Trotz seiner Handlungsarmut ist es ein interessanter Roman. Nur Oblomows Traum gefiel mir nicht so. Deswegen 4 Sterne.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Unser Protagonist Oblomow ist Großgrundbesitzer, lebt seit 12 Jahren in St. Petersburg und seither besuchte er sein Gut nicht mehr. Obwohl ihn sein Verwalter hintergeht, den die Zahlungen werden immer geringer und unregelmäßiger, kann er sich nicht aufraffen nach den Rechten zu …
Mehr
Unser Protagonist Oblomow ist Großgrundbesitzer, lebt seit 12 Jahren in St. Petersburg und seither besuchte er sein Gut nicht mehr. Obwohl ihn sein Verwalter hintergeht, den die Zahlungen werden immer geringer und unregelmäßiger, kann er sich nicht aufraffen nach den Rechten zu sehen. Viel lieber schmiedet er hochtrabende Pläne in seinem Boudoir, macht ausgedehnte Mittagschläfchen, verbringt den ganzen Tag im Schlafrock und empfängt gar seine Besucher in diesem. Obwohl ihn seine Freunde immer wieder zur Tat drängen, kann ihn keiner aus der eingefleischten Lethargie reißen. Bis auf sein Jugendfreund Stolz,
der schafft es sogar Oblomow mit der jungen Olga bekannt zu machen, aber selbst diese Liebe ist ihm zu anstrengend.
Obwohl Oblomow der faulste und apathischste Romanheld ist den ich je kennenlernen durfte, hat er sofort meine Sympathie gewonnen. Sein Müßiggang ist wohl exemplarisch für den russischen Landadel, in keiner Zeit davor und danach wurden so viele Besuche und Gegenbesuche vereinbart wie damals und dennoch hatten Sie alle viel übrige Zeit. Alle Charaktere sind besonders gut ausgearbeitet, jeder erhält seinen unfehlbaren Platz in der Geschichte, jeder hat seinen Sinn und trägt zum Aufbau der Erzählung bei. Für mich ein ganz besonderes Buch, das ich sicherlich nicht das letzte mal gelesen habe.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Der russische Gutsbesitzer Oblomow verlässt nur ungern seine Liegestatt. Dort empfängt er seine Besucher, dort verbringt er den Tag, dort schmiedet er große Pläne, die er aber nie umsetzt. Der Schlafrock ist sein liebstes Kleidungsstück. Im Nichtstun sieht er seinen …
Mehr
Der russische Gutsbesitzer Oblomow verlässt nur ungern seine Liegestatt. Dort empfängt er seine Besucher, dort verbringt er den Tag, dort schmiedet er große Pläne, die er aber nie umsetzt. Der Schlafrock ist sein liebstes Kleidungsstück. Im Nichtstun sieht er seinen Lebensinhalt. Seit 12 Jahren wohnt er bereits in St. Petersburg, seit dem hat er sein Gut nicht mehr besucht. Weil er sich nicht kümmert und weil er bis an die Grenzen des Erträglichen ausgenutzt wird, fallen die Erträge jährlich geringer aus. Seine Freunde sind, bis auf eine Ausnahme, Schmarotzer, die ihm die Zeit und vor allem sein Geld stehlen. Auch sein Diener Sachar ist Nutznießer von Oblomows Desinteresse und Gleichgültigkeit. Einzig sein Freund aus der Jugendzeit, Andrej Karlowitsch Stolz, schafft es, ihn aus seiner Lethargie herauszureißen. Ist er da, was auch in Oblomows Augen viel zu selten geschieht, verlässt er seine Ruhestätte, er rafft sich auf, die vom Freund empfohlenen Bücher zu lesen und zeigt Interesse an seiner Umwelt. Stolz gelingt es auch, Oblomow mit Olga bekanntzumachen. Für kurze Zeit kann Oblomow über seinen Schatten springen und die Liebe genießen. Jedoch lassen ihn Selbstzweifel und Unentschlossenheit diese Beziehung beenden und er fällt in stärker denn je in alte Verhaltensmuster zurück.
Ilja Oblomow ist wohl der faulste, trägste, unentschlossenste und apathischste Romanheld der Literatur, aber er ist ein auf seine Art ein liebenswerter Protagonist. Der Begriff der "Oblomowerei" für die Langeweile und den Müßiggang hat auch in den deutschen Wortschatz Einzug gehalten. Als Abkömmling des russischen Landadels steht Oblomow für das feudalistische Althergebrachte, sein Gegenspieler im Roman ist der deutschstämmige Kaufmann Stolz, der den Aufbruch in die neue Zeit verkörpert. Da Gontscharow seinen Roman logisch und intelligent aufgebaut hat, ist das Ende zwar vorhersehbar, aber nicht in der Vielzahl seiner Details. Hat mir der Roman in seinen ersten drei Teilen schon gut gefallen, war der Schlussteil sozusagen die Krönung für mich. Zu Beginn des Buches stellte ich mir immer wieder die Frage, wie man so wie unser Held werden kann. Die Beantwortung folgt in "Oblomows Traum", welcher als Erzählung bereits 1848 veröffentlicht wurde. Mit seinem Protagonisten provoziert Gontscharow gekonnt, seine feine Ironie macht das Buch zu etwas Besonderem. Hervorheben möchte ich die wunderbare Charakterisierung der in der Handlung vorkommenden Personen. Alle sind sie fein gezeichnete Individuen, die beim Lesen zum Leben erweckt werden.
Heute, 150 Jahre nach seinem Erscheinen, hat dieser Roman eine ungeheure Aktualität erlangt - allerdings genau als Negation dessen, was Gontscharow aussagen wollte. In der heutigen Zeit mit ihrer Hektik, dem Hetzen von einem Termin zum anderen, dem Zeigen des aktiven Lebens, ist ein wenig Oblomowerei sicher ein gesunder Gegenpol zum geschäftigen Alltagsleben.
Mein Fazit: Mit "Oblomow" schuf Iwan Gontscharow ein Meisterwerk, das ihn als Autor auf eine Stufe mit Tolstoi und Turgenjew hebt. Dabei ist dieses Buch einfach, mit vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten und schnörkellos geschrieben. Mich hat dieses Werk überzeugt. Zu Unrecht ist es nicht so bekannt wie die anderen Werke der großen russischen Literaten.
Weniger
Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für