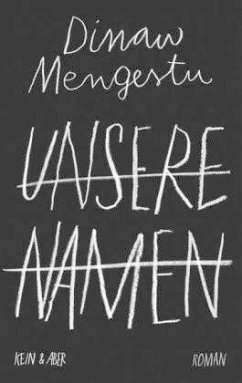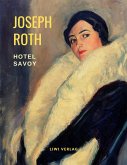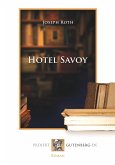Es ist ein unaufgeregtes Leben, das die Sozialarbeiterin Helen in ihrer Heimatstadt im Mittleren Westen führt. Als sie die Gelegenheit bekommt, sich um Isaac zu kümmern, sagt sie sofort zu. Etwas Geheimnisvolles geht von dem Afrikaner aus, dessen Akte nichts von ihm verrät als seinen Namen. Helen fängt an, in seiner Vergangenheit zu forschen, und kommt ihm dabei immer näher. Doch je mehr sie über Isaac in Erfahrung bringt, desto größer wird das Verwirrspiel um seine Person.Ein paar Monate zuvor in Kampala, Uganda: In Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche hoffen auch Isaac und sein Freund Langston auf eine bessere Zukunft. Für einen Umsturz sind sie bereit, große Opfer zu bringen.Mit schonungsloser Schärfe und Präzision seziert Mengestu Unterschiede wie Parallelen der westlichen und der afrikanischen Identität und formt daraus eine unerschrockene und ergreifende Liebesgeschichte.

Dinaw Mengestus Roman „Unsere Namen“ erzählt beeindruckend von einem äthiopischen
Einwanderer in den USA – aber betritt er auch literarisches Neuland?
VON CHRISTOPH BARTMANN
Was tut sich auf zwischen Kampala in Uganda und einem Kaff im Mittleren Westen namens Laurel? Eine Differenz natürlich, eher schon eine Kluft, ein Abgrund, jedenfalls für jemanden wie Isaac, der gerade noch ein etwas unbeholfener Revolutionär in Afrika war und jetzt ein Austauschstudent mit Einjahresvisum in Laurel ist, wo man als Schwarzer im Restaurant noch schief angeschaut wird, erst recht, wenn man von einer weißen Frau begleitet wird. Dinaw Mengestus Roman „Unsere Namen” spielt in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts, als in Uganda Idi Amin herrschte und in Laurel und anderswo im Herzen der USA die Rassentrennung nur auf dem Papier überwunden war.
Es könnte nach vierzig Jahren mehr Mühe machen, Kampala wieder zu erkennen als Laurel. Vom pan-afrikanischen Marxismus Isaacs und seiner Genossen ist nicht viel übrig geblieben, den kleinstädtischen Rassismus dagegen hat keine Revolution hinweg gefegt. Die jüngsten Ereignisse in Ferguson, Missouri, nicht allzu weit entfernt vom fiktiven Laurel, haben in Erinnerung gerufen, dass auch unter Obama die Lage der Schwarzen in Amerika prekär geblieben ist. Dinaw Mengestu kann seinen Roman getrost in einer längst vergangenen Zeit spielen lassen, die Gegenwart behauptet auch so ihr Recht.
„Unsere Namen“ ist der dritte Roman von Mengestu, der als Kind äthiopischer Einwanderer in den USA aufwuchs, und es ist der dritte Roman, in dem Fragen von Herkunft, Identität und Migration im Mittelpunkt stehen. Dabei wird der Moment der Ankunft selbst , der Fremdheit, der ersten Orientierung ausgespart oder vorausgesetzt. Wir sehen Isaac abwechselnd in seiner alten Welt, in der er zunehmend alle Orientierung verliert und sich selbst und seinen Mitkämpfern zum Problem wird. Und wir sehen ihn nach der Ankunft in der kleinen Universitätsstadt, mit allem Notwendigen versorgt, doch gänzlich bodenlos. Migration ist hier nicht der Übergang vom Vertrauten zum Fremden, sondern das Schwanken zwischen zwei verschiedenen Arten der Ortlosigkeit.
Man wagt kaum zu denken, was dann Integration bedeuten sollte, und käme kaum auf die Idee, deshalb die freundlichen Sozialarbeiter und Betreuer anzuklagen, die Isaac den Neustart in Amerika erleichtern wollen. Das Problem mit Isaac ist vielmehr, dass es ihn am Besten gar nicht gäbe, weder in Uganda noch in den USA. Schließlich war er schon in Uganda ein Fremder. Kein Einheimischer, sondern ein Äthiopier, den die vage Hoffnung auf eine sozialistische Revolution aus seinem Dorf mit dem Bus nach Kampala gespült hatte.
„Unsere Namen“ heißt der Roman, und vielleicht fangen Isaacs Probleme ja mit den Namen an. „Als ich geboren wurde“, erzählt er – einer von übrigens zwei Isaacs des Romans –, „hatte ich dreizehn Namen. Jeder Name stammte von einer anderen Generation meiner Familie, angefangen bei meinem Vater. Ich war der Erste in unserem Dorf, der dreizehn Namen hatte, und alle waren der Meinung, dass meine Familie sich glücklich schätzen durfte, eine so lange Geschichte vorweisen zu können.“ In Isaac hat sich die Geschichte seines Stammes vollendet, und nun bricht er auf in die große Stadt und den großen Kampf, und ist dort dann wieder nur ein Name unter vielen Namen, einer außerdem, der ihm nicht exklusiv gehört, den er zugeteilt bekam von einem anderen Isaac, dem bewunderten Freund und Revolutionär. Es gehört zu den Vorzügen des Romans, dass er zeigt – nicht analysiert, nicht erklärt – , wie Identität schon an der Quelle trübe und fraglich wird. Schon in Uganda hat Isaac gelernt, wie man plötzlich verschwindet, seine Spuren verwischt und an unerwarteter Stelle wieder auftaucht – eine Kunst, die er in Amerika noch brauchen wird.
Amerika empfängt ihn ja mit offenen Armen, wenn nicht Amerika, dann jedenfalls Helen, die Sozialarbeiterin und Zuständige für seinen Fall. Auch Helen weiß nicht recht, wie sie an ihren Namen kam. Ihr Vater habe sich, sagt sie, nicht an die Gründe für die Namenswahl erinnern können. Auf ihre Weise ist Helen nicht weniger ortsfremd als ihr Mandant und wünscht sich doch, sie könnte seine Integrationshelferin sein, mit welchem Mittel, wenn nicht mit Liebe. Die Vorstellung einer behutsamen Einführung in amerikanische Lebensart – Lebensmitteleinkauf, Postamt, Shopping Mall – zerschellt aber an einer Wirklichkeit, in der ein schwarzer Mann und eine weiße Frau nicht zusammen Mittag essen gehen können. Sie scheitert auch an Isaacs Neigung, stets dann zu verschwinden, wenn sich einmal die Aussicht auf zwei, drei Tage einer störungsfreien Beziehung ergäben. Keiner weiß, nicht Helen, nicht die Leser, was ihn umtreibt. Geht der revolutionäre Kampf auch in Laurel weiter? Erträgt Isaac die bürgerliche Mittellage nicht? Er scheint noch immer auf der Flucht, aber von wo nach wo? Von Helen ist unterdessen auch kein Heil zu erwarten. Ihr Chef hat ihr geraten: „Wenn dein Leben gerade den Bach runtergeht (. . .), dann glaub ja nicht, dass es besser wird, wenn du das eines anderen Menschen rettest.“ Hoffnung macht freilich, dass es einen Unterschied geben könne zwischen Helfersyndrom und Liebe. Gerade weil oder indem Helen alle sozialarbeiterischen Bemühungen hintan stellt, scheint sie zum Ende des Romans in der Lage, die transkontinentale Blockade in Isaac zu lösen. Aber so genau werden wir das nie erfahren. Der Grundton der Verlorenheit klingt stärker nach als der irgendeines stabilen Glücks.
Mengestu erzählt den Roman mit alternierenden Stimmen, mal ist es Isaac, der spricht, mal Helen, die halbe Zeit spielt er in Afrika, die andere Hälfte in den USA. Die Erzählung ist – formal, tonal, stilistisch – makellos. Kein Wunder, wenn Dinaw Mengestu schon, wie in der Kirkus Review , zu „den besten zeitgenössischen Autoren Amerikas“ gerechnet wird, oder, wie im New Yorker , zu den „zwanzig besten amerikanischen Autoren“ unter vierzig. Das ist interessant, denn auch wenn wir Mengestus Roman zustimmend, bewegt und sogar mitgerissen gelesen haben, hatten wir keinen Moment das Gefühl, es mit „großer Literatur“ zu tun zu haben.
Woran liegt das? Sicher nicht daran, dass Mengestus Themen, von der klassischen Bevölkerungsmehrheit her gesehen, zu randständig wären (das sind die von V. S. Naipaul und vielen anderen auch). Auch nicht daran, dass Mengestu das literarische Handwerk nicht beherrscht. Im Gegenteil, er beherrscht es vorzüglich. Was man vermisst, bei ihm wie bei anderen hoch gehandelten Talenten einer „neuen Weltliteratur“, ist ein Quantum literarischer Verwegenheit oder auch nur Subjektivität. Mit Themen allein, gut recherchierten und literarisch souverän verarbeiteten, ist es nicht getan. Dinaw Mengestu hat in den USA große Preise und attraktive akademische Jobs erhalten. Nun pendelt er zwischen der Welt der Universitätsseminare und dem literarischen Schreiben, und man fürchtet fast, er könnte dazwischen verloren gehen, wie Isaac, sein Held.
Dinaw Mengestu: Unsere Namen. Roman. Aus dem Englischen von Verena Kilchling. Verlag Kein & Aber, Zürich 2014. 336 Seiten, 22,90 Euro. E-Book 18,99 Euro.
Isaacs Problem ist, dass er am
besten gar nicht da wäre, weder
in Uganda noch in den USA
„Glaub nicht, dass dein Leben
besser wird, wenn du einen
anderen Menschen rettest.“
Im Unterschied zu den Flossen von Walen und Delfinen, die in der gesamten Länge mit dem Rücken verbunden sind, liegt ein Teil der Haiflosse frei.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Einen großartigen Roman über das Leben zwischen den Welten hat Rezensent Uwe Stolzmann mit Dinaw Mengestus "Unsere Namen" gelesen. Er folgt hier einem jungen Äthiopier, der in den Siebziger Jahren mit sozialistischen Träumen nach Uganda flieht und schnell feststellen muss, dass er auch hier Mord und Vertreibung erlebt. Bald lernt er Isaac kennen, erhält dessen Papiere für ein Studium in den USA und bricht mit neuem Namen und neuer Identität in die Fremde auf, berichtet der Kritiker. Fasziniert liest Stolzmann, wie es dem Autor gelingt, die verschiedenen Welten von Kapitel zu Kapitel einander durchdringen zu lassen, wie er mit Perspektiven und Identitäten spielt und Afrika und Amerika einander gegenüberstellt. Amerika als "spießiger", rassistischer Ort mit Amokschützen bleibt dem Rezensenten hier zwar zu einseitig, dennoch lobt er dieses realistisch erzählte Buch als ebenso spannendes wie eindringliches Werk.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH