Insgesamt 116 Bewertungen
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite...Weitere Seiten 5 Zur Seite 5 6 Zur Seite 6 7 Aktuelle Seite 8 Zur Seite 8...Weitere Seiten12Zur letzten Seite, Seite 12Zur nächsten SeiteZur letzten Seite
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite...Weitere Seiten 5 Zur Seite 5 6 Zur Seite 6 7 Aktuelle Seite 8 Zur Seite 8...Weitere Seiten12Zur letzten Seite, Seite 12Zur nächsten SeiteZur letzten Seite



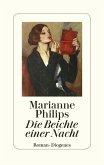
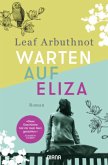
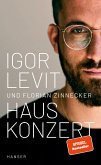
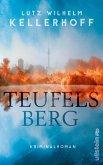
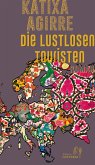
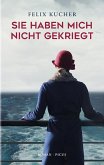
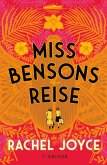


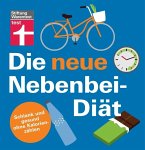
Benutzer