Insgesamt 1178 Bewertungen
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite 1 Zur Seite 1 2 Zur Seite 2 3 Aktuelle Seite 4 Zur Seite 4...Weitere Seiten99+Zur letzten Seite, Seite 100Zur nächsten SeiteZur letzten Seite
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite 1 Zur Seite 1 2 Zur Seite 2 3 Aktuelle Seite 4 Zur Seite 4...Weitere Seiten99+Zur letzten Seite, Seite 100Zur nächsten SeiteZur letzten Seite



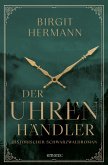
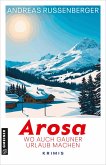
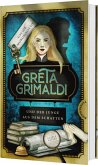

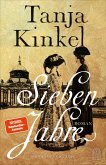

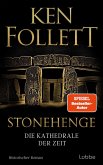
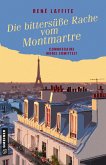
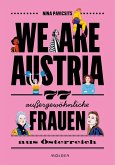

Benutzer