BenutzerTop-Rezensenten Übersicht

Bewertungen
Insgesamt 33 Bewertungen| Bewertung vom 19.08.2024 | ||

|
Spitzt sich ohne Erklärung zu schnell zu |
|
| Bewertung vom 03.08.2024 | ||

|
Das koloniale Leid |
|
| Bewertung vom 31.07.2024 | ||

|
Das Dorf der acht Gräber / Kosuke Kindaichi ermittelt Bd.3 Spannend, skurril und japanische Folklore |
|
| Bewertung vom 22.07.2024 | ||

|
Mit sprachlichen Bildern Eindrücke schaffen |
|
| Bewertung vom 20.05.2024 | ||

|
Post von Wagner in Langform |
|
| Bewertung vom 20.05.2024 | ||

|
Entlarvt den Literaturbetrieb und bedient sich seiner Mittel |
|
| Bewertung vom 19.05.2024 | ||
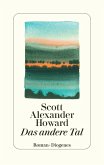
|
Liebesgeschichte oder philosophisches Gedankenexperiment? Beides! |
|
| Bewertung vom 21.04.2024 | ||

|
Ein Buch wie eine Melodie |
|
| Bewertung vom 02.04.2024 | ||

|
Zu viele Sprünge; kaum Spannung |
|
| Bewertung vom 25.02.2024 | ||

|
Streiflichter auf schwarze Biografien in den 1960er Jahren |
|