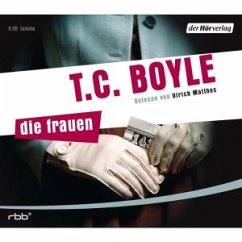Produktdetails
- Anzahl: 8 Audio CDs
- Erscheinungstermin: 16. Oktober 2009
- Hersteller: Edel Germany GmbH / DER HÖRVER,
- EAN: 9783867173674
- Artikelnr.: 25646159
Süddeutsche Zeitung Audio-Rezension
Jetzt anhören
T. C. Boyle unterschätzt den Helden seines Romans „Die Frauen”, den Architekten Frank Lloyd Wright
Die Selbstüberhöhung der Architekten ist keine Seltenheit. Schon Ineni, Baumeister im Altertum, beschrieb seine Bedeutung um 1500 vor unserer Zeit so: „Ich war Aufseher der Aufseher und hatte niemals Misserfolg.” Das konnte sich sein ägyptischer Kollege Senenmut kaum bieten lassen, der behauptete: „Ich war der Größte der Großen.” Aber auch dieses Selbstbewusstsein war steigerungsfähig. Claude-Nicolas Ledoux, französischer „Revolutionsarchitekt” im späten 18. Jahrhundert, bezeichnete seinen Beruf als „Titanentum”, sich selbst als „Herausforderer des Schöpfers”.
Wenn der amerikanische Architekt Frank Lloyd Wright (1867-1959) also einen ihn anschmeichelnden Reporter anblafft, nein, er, Wright, sei keineswegs der größte Architekt der Gegenwart, „sondern der größte Architekt aller Zeiten”, dann ist das lediglich ein ordentlicher Mittelwert auf der ewigen Skala der Bau-Arroganz. Dem jüngsten Buch „Die Frauen”, das der amerikanische Schriftsteller T. C. Boyle dem Leben dieses größten Architekten aller Zeiten gewidmet hat, ist denn auch ein prägnantes Wright-Zitat mit Bedacht vorangestellt: „Schon früh in meinem Leben musste ich mich zwischen ehrlicher Arroganz und scheinheiliger Demut entscheiden; ich entschied mich für die Arroganz.”
Da aber solche Arroganz kaum etwas Besonderes ist in der Sphäre der Architektur, mag sich Boyle noch aus einem anderen Grund für Wright entschieden haben: Wright beließ es, anders als andere wortgewaltige Architekten, in seinem Leben nicht bei der Rhetorik. Wright, der – nüchtern betrachtet – zu den einflussreichsten amerikanischen Architekten in der Geschichte der (frühen) Moderne zu rechnen ist, lebte darüber hinaus ein aufregendes, leidenschaftliches und an persönlichen Dramen kaum überbietbares Leben.
Seine Biographie ist es, genauer: seine drei Ehefrauen und eine Lebensgefährtin sind es, die Boyle zum Roman veranlasst haben. Wobei der Autor sich schon länger für amerikanische Ikonen interessiert. Zuletzt hat Boyle auch die Lebensläufe von John Harvey Kellogg („Willkommen in Wellville”) und Alfred Kinsey („Dr. Sex”) literarisiert. „Die Frauen” ist nun das Buch zum Bau. Leider, und das ist seine Schwäche, will es kaum mehr sein als eben dies: Beiwerk. Ein Werk ist es nämlich nicht. Und das enttäuscht. Thopmas John Boyle, der sich selbst – nach einem Vorfahren – T. Coraghessan Boyle nennt, ist seit „Wassermusik” (1980) zu einem Erzähler geworden, der die Historie mitunter meisterhaft, ja mit mitreißender Sprachmacht zu literarisieren vermag.
„Ich habe”, schrieb Boyle damals, „den historischen Hintergrund aus der Freude und Faszination genutzt, die er mir bereitete, keinesfalls aber in dem Wunsch, die Ereignisse genauestens zu rekonstruieren (. . .).” Es ist ein Rätsel, warum sich Boyle an diesen Anspruch nun kaum erinnert. Tatsächlich reportiert er Wrights gut dokumentiertes, ja in glamouröser Absicht von den Medien seiner Zeit stets begleitetes Leben auf fast schon brave Weise und entfaltet nur selten eine Erzähllust, die stärker wäre als die des Lebens selbst. Vielleicht scheitert Boyle deshalb am Objekt seiner Begierde, weil sich dieses in diesem speziellen Fall als vitaler erweist als Boyles dichterische Freiheit.
Wright, Workaholic, Abenteurer, Maul- und Frauenheld, Autonarr und Pferdesportler, war umgeben von Erfolg und Triumph, dazu von Bankrott und Verrat, Mord und Feuer. Zweimal wird sein wundersames Heim „Taliesin” abgefackelt, einmal wird es vom Amok eines Killers heimgesucht – jedesmal baute Wright erst die Gräber seiner Lieben und danach das Haus (und damit sich selbst) wieder auf. Taliesin ist naturgemäß der Hauptschauplatz des Buches, wird aber nirgendwo vollständig in seiner archaischen Architektur über etwas Raumbeschwörung hinaus reflektiert. Die Meisterschaft, die Boyle aufwendet, um die prägende Landschaft Wisconsins zu beschreiben, hätte hier für das Verständnis von Wright auch als Mensch – „im Raum” – viel bewirken können.
Porträt eines Muttersöhnchens
Frank Lloyd Wright, der sich (wie Boyle) seinen Namen als familiengeschichtliches Dokument selbst zusammengestellt hat, war dreimal verheiratet und dreimal geschieden. Mit seiner ersten Frau, Kitty, hatte er sechs Kinder, aus seiner dritten Ehe, mit Miriam, nochmals eine Tochter. Seine zweite Frau, Mamah, hatte zwei Kinder aus erster Ehe. Seine letzte Lebensgefährtin, Olgivanna, hatte ebenfalls Kinder. Kurz, Wright war der erste Patchworkmensch der Neuzeit – nur dass er sich kaum je für seine Kinder und Enkel interessiert hat. Und der Autor tut es ihm gleich. Aber interessiert sich Boyle stattdessen für die Frauen in „Die Frauen”? Nur zum Teil. Ausführlich zeichnet er nur das Schicksal der Morphinistin und zu Waffengewalt neigenden, Eifersuchtsdramen am Band fabrizierenden Miriam nach. Olgivanna wird mehr als einmal als „Hausdrache” beschrieben, Kitty ist offenbar von keinerlei Interesse – und Mamah, die tatsächlich wichtigste, inspirierendste Frau in Wrights Leben, kommt nicht ganz zu ihrem Recht.
Die Frauen dienen eigentlich nur dazu, Wright, der ein Leben lang unter einer extrem starken Mutter litt, als Muttersöhnchen zu porträtieren, um sein zeitgenössisches Image als Lebemann zu konterkarieren – zugleich aber, um das Amerika jener Zeit der Provinzialität und Heuchelei zu bezichtigen. Das artifiziell-komplizierte, aus der Perspektive eines Mitarbeiters und gegen den Zeitlauf erzählte Konstrukt aus Gesellschaftsbild und Biographie gelingt nicht. Die Frauen bleiben trotz ihres karikaturhaften Irreseins Staffage. Mehr als einmal bezeichnet sie Wright abschätzend als „Zierde”. Und wiederum mehr als einmal muss sich Wright an den Frauen reiben, auf dass sie „seine Lust spüren”. Spätestens an dieser Stelle bekommt man Lust, Boyle zu fragen, warum er sich nicht für den Architekten im Manne interessiert.
Denn die wahre, unfassbar starke Triebfeder Wrights war das Hausbauen. Niemand sonst hat in einem Architektenleben an die 1000 Entwürfe gezeichnet und die meisten davon realisiert; niemand sonst war so erfindungsreich und so utopisch in jener Zeit. Nichts davon kommt hier zur Sprache. T. C. Boyle, der selbst in einem großartigen Wright-Haus lebt, schreibt über Architektur erstaunlicherweise nur in Klischees. Der Künstler, der Raumerfinder Wright jenseits des (bekannten) Erotomanen wird nicht lebendig. Hier hätte sich der Literat verdient machen können. Was aber schon mehr als genug Leben ist – das muss kein Buch mehr werden. GERHARD MATZIG
T. C. BOYLE: Die Frauen. Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Dirk van Gunsteren. Carl Hanser Verlag, München 2009. 560 Seiten, 24,90 Euro.
Frank Lloyd Wright in seinem Büro in Taliesin, Wisconsin. Stubenfliegen soll er dort gerne „Mies”, „Gropius” oder „Corbusier” genannt haben. Foto: AP
Der amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle in seinem von Frank Lloyd Wright erbauten Haus in Santa Barbara, Kalifornien Foto: Jochen Siegle/dpa
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de