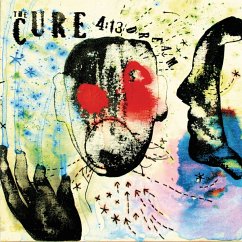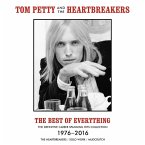| CD | |||
| 1 | Underneath The Stars | 00:06:17 | |
| 2 | The Only One | 00:03:55 | |
| 3 | The Reasons Why | 00:04:35 | |
| 4 | Freakshow | 00:02:28 | |
| 5 | Sirensong | 00:02:22 | |
| 6 | The Real Snow White | 00:04:42 | |
| 7 | The Hungry Ghost | 00:04:29 | |
| 8 | Switch | 00:03:44 | |
| 9 | The Perfect Boy | 00:03:21 | |
| 10 | This. Here And Now. With You | 00:04:06 | |
| 11 | Sleep When I'm Dead | 00:03:51 | |
| 12 | The Scream | 00:04:35 | |
| 13 | It's Over | 00:04:17 | |

Sie haben metaphysischen Hunger und sind gleichzeitig den Dingen verfallen: The Cure gelingt im dreizehnten Anlauf endlich ein ehrliches Album.
Simon Gallup spielt seit achtundzwanzig Jahren in der Schicksalsgemeinschaft The Cure. Insbesondere als die Briten Anfang der Achtziger noch ein Trio waren, das karge, wie von einem Pasolini des Pop inszenierte Alltagstragödien aufführte, schien die Essenz ihrer archaisch drohenden Musik ganz in den repetitiv pulsierenden Achtelnoten enthalten, mit denen Gallup, tief in seinen kniehoch baumelnden Bass gebückt, Stücke wie "A Forest" ins kollektive Unterbewusstsein pumpte. Porl Thompson ist der Bruder der Ex-Frau von Simon Gallup. Der vielseitige Gitarrist spielte schon 1976 bei den Easy Cure, doch zu Cure stieß er erst 1985 bei "Head On The Door". Das war das bahnbrechende Album, mit dem Bandleader Robert Smith und Produzent Dave Allen aus einem suizidgefährdeten Post-Punk-Trio eine mit Ironie und Hits à la "Close to Me" gesegnete Alternative zum Cinemascope-Sound Pink Floyds machten. Mit Thompson, wechselnden Keyboardern und dem superben Drummer Boris Williams konnten Cure dann 1987 als Quintett den globalen Durchbruch "Kiss me, Kiss me, Kiss me" sowie zwei Jahre später das Meisterwerk "Disintegration" aufnehmen. Aus einem Indie-Teenie-Grüppchen, das Ende der Siebziger in "Killing an Arab" mit Schepper-Keller-Sound Camus "L'Étranger" vertonte, war eine federnd-harte Band geworden, die es an guten Tagen fast mit den Led Zeppelin von "Physical Graffiti" hätte aufnehmen können. Auf der ersten Seite des 1992 folgenden Doppelalbums "Wish" übertrafen sie sich dann ein letztes Mal, bevor Williams und Thompson ausstiegen.
Robert Smith ist der Bruder der Frau von Porl Thompson und somit ungefähr der Schwager des Schwagers von Simon Gallup. Smith hat bewiesen, zur Not auch allein The Cure sein zu können; aber der Familienmensch bekannte sich nach jeder Krise immer nur fester dazu, mit Freunden und Verwandten jene Musik zu machen, die auch seine andere große Familie, die treue Cure-Gemeinde, hören will: Cure-Musik eben. Angesichts der letzten Platten könnte man sich nichts sehnlicher als einen verheerenden Familienstreit wünschen, damit Smith endlich eine Karriere als Solokünstler wagen möge, vielleicht mit einem Produzenten wie Nigel Godrich, der Songwritern ihr Bestes abzuverlangen weiß. Doch Smith, der einst sagte, er könne nicht spielen, wenn er fürchten müsse, man mache sich hinter seinem Rücken über seine Texte lustig, ist alles andere als ein Ego-Shooter wie etwa Sting. Er ist eher ein Gelegenheitszauberer. Durch seinen existentialistisch-punkigen Freiheitssinn, zu allem und jedem "nein" sagen zu können, gelang es ihm einst sogar, im tollkühnen Sprung vom selbstzerstörerischen Acid-Rock des "Pornography"-Albums zu "wonderfully, wonderfully, wonderfully pretty" Gassenhauern à la "Lovecats" überzugehen. Hört man heute ein Gothic-Manifest wie "Figurehead", das wie ein eiskaltes Eisen in den Ohren brennt, versteht man das Freiheitspathos hinter programmatischen Zeilen wie "I can never say no to anyone but you" im Rückblick freilich besser. Drogen sind nur die lebensgefährliche Steigerung eines blind als Akkumulation von Glücksmomenten vorwärts gelebten Lebens: "Touch her eyes / Press my stained face / I will never be clean again." Das Verfallensein an und Verführtwerden von Illusionen und Ideologien sind dann später auch die großen Themen des Sokratikers Smith geworden. Selbst auf den schwachen Platten, die seit 1992 im Vierjahresrhythmus erschienen, gab es immer wieder Sinnblitze, für die es lohnte, die Orientierungslosigkeit von "Wild Moon Swings" oder das pseudomotivierte Lärmen von "Bloodflowers" zu ertragen.
Die neue Cure-Platte "4:13 Dream" wird nicht als Meilenstein in Erinnerung bleiben. Auch wenn Simon Gallup immer noch Bass und Porl Thompson nach sechzehn Jahren endlich wieder Gitarre spielt - das Quartett leidet darunter, in Jason Cooper einen so ambitionierten wie ungeeigneten Drummer zu haben. Der bemüht sich zwar, hier und da den Stil von Boris Williams zu kopieren, aber sein Rhythmusgefühl ist letztlich das eines Einpeitschers, der nicht laid back wie Williams empfindet. Dadurch kann Gallup nicht mehr so strukturgebend spielen, und der hypnotische Groove ist mitsamt den epischen Intros dahin. Auch die Klangverliebtheit, die die Band einst zu tausendfach imitierten Pionieren machte, blitzt nur sporadisch auf. Man gewinnt zunächst den Eindruck, das inhomogen und unfertig klingende Material wäre entnervt liegengelassen und später in eine halbwegs goutierbare Form und Ordnung gebracht worden. Aber Cure-Platten klingen anfänglich immer enttäuschend - weil das Wesen, dem all dies einst so viel bedeutete, lange gestorben ist, würde Proust sagen.
Er hätte ganz recht: Nicht nur die Musik, auch ihr Hörer ist ein etwas schlechterer geworden. Der rohe Auftakt "Underneath the Stars" ertrinkt in Echo- und Chorus-Effekten, die erfahrungsgemäß desto lauter sind, je weniger am Klangraum eines Stückes gearbeitet wurde. Dennoch ist da eine zerbrechlich-zeitlose Stimmung, und in den Gitarren wird eine Kraft frei, von der man sich bald gern tragen lässt. "The only one" ist ein textlich bescheidener Ableger von "Just like Heaven". Nach dem funky Fremdkörper "Freakshow" beginnt dann das beste Drittel einer Platte, die am Ende anstrengend, beinah experimentell wie frühere Single-B-Seiten wird. Man entdeckt auch hier nichts Neues, aber der "Sirensong" ist eine luftig-shuffelnde Nummer, die mit akustischen Gitarren und inspiriertem Gesang überzeugt. "The Real Snow White" hingegen erinnert barock-rockend daran, dass Moral eine Sache ist, der sich leicht brüstet, wer nicht in kritischen Situationen auf die Probe gestellt wurde. Ein lustiges Lied!
Mit "The Hungry Ghost" ist schließlich der Diamant gefunden, für den sich das Warten gelohnt hat. Wie sich Produzent Keith Uddin seinen rohen Cure-Sound vorgestellt haben mag, kann man in diesem messerscharfen Klagelied über metaphysischen Hunger und Verfallenheit ans Dingliche hören: "Even if we turn more to most / We'll never satisfy the hungry ghost", singt Smith lakonisch. So aktuell war seine Musik schon lange nicht mehr. Später fängt man sogar an, mit Robertschem Quengeltenor die Wendung "the price we pay for happiness" mitzubrüllen und begreift zuletzt hustend: Das dreizehnte Cure-Album ist das, was man früher eine ehrliche Platte nannte.
ALESSANDRO TOPA
The Cure, 4:13 Dream. Geffen 5104864 (Universal)
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main