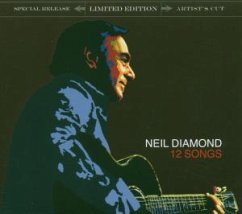Produktdetails
- Anzahl: 2 Audio CDs
- Erscheinungstermin: 8. Dezember 2006
- Hersteller: Sony Music Entertainment Germa / SMI COL,
- EAN: 0886970395823
- Artikelnr.: 20930813
| CD 1 | |||
| 1 | I'm On To You - Album Version | 00:04:28 | |
| 2 | What's It Gonna Be - Album Version | 00:04:05 | |
| 3 | Captain Of A Shipwreck - Album Version | 00:03:55 | |
| 4 | Evermore - Album Version | 00:05:19 | |
| 5 | Save Me A Saturday Night - Album Version | 00:03:32 | |
| 6 | Delirious Love - Album Version | 00:03:12 | |
| 7 | I''m On To You - Album Version | 00:04:28 | |
| 8 | What''s It Gonna Be - Album Version | 00:04:05 | |
| 9 | Man Of God - Album Version | 00:04:22 | |
| 10 | Create Me - Album Version | 00:04:10 | |
| 11 | Face Me - Album Version | 00:03:27 | |
| 12 | We - Album Version | 00:03:49 | |
| 13 | Men Are So Easy - Album Version | 00:04:03 | |
| 14 | Delirious Love - With Brian Wilson | 00:03:23 | |
| CD 2 | |||
| 1 | Oh Mary - Demo | 00:04:16 | |
| 2 | Hell Yeah - Early Take | 00:04:49 | |
| 3 | Captain Of A Shipwreck - Alternate Take | 00:04:01 | |
| 4 | Evermore - Early Take | 00:04:46 | |
| 5 | Save Me A Saturday Night - Alternate Take | 00:04:09 | |
| 6 | Delirious Love - Early Take | 00:03:13 | |
| 7 | I''m On To You - Demo | 00:03:27 | |
| 8 | What''s It Gonna Be - Alternate Take | 00:05:02 | |
| 9 | Man Of God - Early Take | 00:04:57 | |
| 10 | Create Me - Alternate Take | 00:04:28 | |
| 11 | Face Me - Demo | 00:03:23 | |
| 12 | We - Early Take | 00:04:12 | |
| 13 | Men Are So Easy - Alternate Mix | 00:06:07 | |

Wo Cash war, soll ein Edelstein werden: Neil Diamond macht mit Hilfe Rick Rubins eine ganz wunderbare Platte
Herzensbrecher älterer Damen: Das wird immer so gesagt, als handelte es sich dabei um ein unanständiges Gewerbe. Nicht nur die dumme Jugend, die noch mit jeder besten Band der Welt zufriedenzustellen ist, auch das etwas reifere Alter hat Anspruch auf billigen Trost und freut sich, wenn ein Popmusiker so tut, als interessiere er sich dafür, was in den allgemeinen Herzen vorgeht. Neil Diamond war in dieser Hinsicht immer jemand, auf den das vorwiegend weibliche Publikum hereinfiel, ohne das als schlimm zu empfinden, während die überwiegend von Männern besorgte Kritik mit dem, was sie für Kitsch hielt, nichts zu tun haben wollte.
Der "jüdische Cowboy", wie er wegen seiner Vorliebe für Western genannt wurde - seine Musik gibt die Bezeichnung jedenfalls kaum her -, konnte damit leben: Gut 120 Millionen verkaufter Platten sind mehr, als jeder andere amerikanische Solosänger vorzuweisen hat, von Elvis Presley abgesehen. Zwar ist seine Musik Kitsch in dem Sinne, in dem die Filme eines Douglas Sirk Kitsch sind; aber was bedeutet das schon? Die Kritik ist den Nachweis für ihre Behauptung schuldig geblieben, Neil Diamond tauge im Grunde nicht viel. Sie überhörte vor allem, daß er in einem sehr grundsätzlichen Sinne ein Ghettomusiker ist. Schon seine Anfänge bei Bang Records, wo er 1967 der Labelnachbar Van Morrisons war, wiesen ihn als erstklassigen Interpreten aus, dessen Bariton so viel Kraft hatte, daß er nie bis zum Äußersten gehen mußte. Die frühen Bang-Platten boten zudem die deutlich ausgegorenere Musik als die Morrisons, der noch im Lichte der "Them"-Abendröte stand und dessen große Warner-Zukunft erst noch kommen sollte.
Was Diamond in jener Zeit anderen schrieb und womit er hauptsächlich sein Geld verdiente - "I'm A Believer" (für die "Monkees"), "Kentucky Woman" ("Deep Purple") und der Überhit "Solitary Man" (der der ganzen Welt gehörte) -, war in seinem genuinen Pop-Appeal sowieso über jeden Zweifel erhaben. Niemand, mit Ausnahme von Willy DeVille, konnte so wie er ein Gefühl davon vermitteln, wie es ist, wenn das aufregende Leben in Gestalt von schönen Frauen oder des richtigen Sounds gleich um die Ecke auf einen wartet. Anders als beim fiebrig-nervösen DeVille schwang in Diamonds Stimme aber die Erkenntnis darüber mit, daß alle Sehnsucht unstillbar ist; er vermittelte nicht Lebensgier, sondern die Trauer der Vollendung. "It's a beautiful noise, coming up from the streets", raspelte er in einem seiner bezwingendsten Songs, welcher der von Robbie Robertson produzierten Platte den Titel und Höhepunkt gab, und jeder konnte der Stimme abhören, daß sie von bereits gemachten Erfahrungen sang. "Beautiful Noise": Mit dieser Platte nahm das Einwandererkind pompös und wehmütig Abschied von der Tin Pan Alley, der New Yorker 28. Straße, die einst für die amerikanische Musik schlechthin stand, die aber schon zu Diamonds Brooklyner Jugendzeit nicht mehr den alten Glanz verströmte.
Das war 1976, als Diamonds Paillettenhemden, mit denen er die Frauen auf eine vollständig folgenlose Weise scharfmachte, schon zehn Pfund wogen und der Sänger selbst sich allen Ernstes vorkam wie ein zweiter Beethoven oder Tschaikowsky. Was aus diesen Ambitionen wurde, ist bekannt. Sehr Wesentliches hat er seither nicht mehr zustande gebracht, auch wenn sich seine Sachen weiterhin gut verkauften.
He, aufwachen, alter Junge!
Dabei, bei einem durch immer noch bestens besuchte Tourneen abgesicherten Ehrenstatus, hätte es bleiben können, wenn ihn nicht eines Tages Rick Rubin aus seiner Routine aufgeschreckt hätte, jener Rick Rubin, der, seinerseits Tröster älterer Herren, schon dem alten Johnny Cash wieder auf die Beine geholfen und maßgeblich zu dessen spätem Ruhm beigetragen hatte und der hier zunächst vor einem ganz anderen Problem stand: Diamond war reserviert. Er sah nicht ein, wieso er sich mit einem zotteligen Genie einlassen sollte; er wußte vermutlich gar nicht, daß in Rubins Produzentenfingern auch die individuellste, persönlichste Musik zu etwas allgemein Verfügbarem wurde. Man kam trotzdem zusammen, spielte sich gegenseitig Platten vor, wie zwei Teenager, und danach ließ Rubin den Sänger erst einmal gewähren. Fast ein Jahr lang schrieb Diamond Songs, immer in dem Bewußtsein, daß er den e-Moll-Akkord schon noch hinkriegen werde, der allen das Herz bricht.
Es muß niemanden wundern, daß die "12 Songs", die Rubin unter Hinzuziehung des Tom-Petty-Clans - Mike Campbell an der Gitarre, Benmont Tench an den Keyboards, dazu, als zweiter Gitarrist, Smokey Hormel - einspielen ließ, das Beste geworden sind, was Neil Diamond seit dreißig Jahren, vielleicht sogar noch länger gemacht hat. Die Platte ist weniger Rubin-typisch geraten als etwa das Spätwerk Cashs, wo die Songs bis aufs Skelett zerlegt sind. Es ist im Grunde eine typische Neil-Diamond-Platte ohne den Schwulst der mittleren Phase, also eine Rückkehr in die Frühzeit, und das heißt: Ghettomusik, Gospel. Es scheint dabei eine Altersfrage zu sein - Diamond, der stimmlich überhaupt nicht gelitten hat, ist neulich fünfundsechzig geworden, was Bob Dylan und Paul Simon, die anderen beiden großen Songschreiber dieses Jahrgangs, noch vor sich haben -, daß der Bekenntnischarakter dieser Lieder so deutlich zu spüren ist; dies allerdings ohne die geringste Zerknirschung, die Diamonds Sache auch gar nicht wäre.
One, two, three - klassisch zählt der Sänger den ersten Song an: "Oh Mary, can you hear my song, does it make a mournful sound?" Allerdings, möchte man rufen, das ist ja das Gute an Neil Diamond: Trauer in Vollendung! Eine winzige, bestechende Melodie gibt den düster-verhaltenen, aber alles andere als entmutigenden Grundton dieses Albums vor, auf dem sich Rubin - denn das ist seine große Kunst - Zurückhaltung auferlegt hat. Nur ein Lied, "Evermore", schlingert mit seinen majestätischen Klavierläufen ins Seifenopernhafte, ohne dadurch an glaubwürdigem feeling einzubüßen - man sieht hier quasi den schon ganz jenseitigen Johnny Cash im Video noch einmal vor sich. Ansonsten aber haben Rubin und er der Versuchung widerstanden, diese Masche verkaufsfördernd zu reiten; es ist gerade das Maßhalten mit allen Mitteln, auch denen übertriebener Kargheit, das überzeugt.
"Hell Yeah", das zweite Lied, ist auch das zweitbeste, die Bilanz eines Lebens mit spürbar herbstlicher und sehr warmer Einfärbung, Klavier, akustische Gitarre und ein Gesang, der sich gegen Ende pastoral aufschwingt - Himmel, ja! Diamond kommt uns hier als der lucky old dreamer, der sich wie jeder anständige Mensch irgendwann fragt, ob er auch alles richtig gemacht hat. Seine Bilanz kann sich sehen lassen, auch wenn man ihm sein Bekenntnis, das Leben müsse nur gelebt und die Liebe bloß verschenkt werden, in seiner puccinihaften Rodolfo-Selbstgewißheit nicht ganz abkauft.
Denn dazu ist dieser Musiker einfach nicht lebenslustig genug. Diamond hat andere Stärken, die er vor allem in "Delirious Live" ausspielt, einem Midtempo-Song alter Rockerschule, der, wie so vieles aus seinem Repertoire, sich der grundlosen Berauschung am eigenen Lebensgefühl verdankt und dann aber auf Desillusion zielt: Wir liebten uns wie im Delirium, also falsch. "I can feel it", krakeelt er - und dies ist einer der wenigen Momente, in denen er forciert singt, womit er nicht restlos überzeugt -, bevor ihm eine Slidegitarre in die Parade fährt.
Liebe wie im Delirium
Das Album macht einen stilistisch ungemein geschlossenen Eindruck und wartet trotzdem mit Vielseitigkeit auf: Der gleichsam in homöopathischer Dosis verabreichte Tex-Mex von "I'm On To You" geht über in bar-jazzigen Xylophon-Klang, der mit schallgedämpfter Trompete unterlegt ist, und das ohne jedes Auftrumpfen. "What It's Gonna Be" und "Man Of God" sind Zeugnisse der Sinnsuche und -stiftung, gleichsam geistliche Lieder, von denen letzteres mit seiner schlierigen Orgel klingt wie vor Jahren das, was Crooner-Kollege Solomon Burke mit Joe Henry auf die Beine gestellt hat. "We" schließlich ist als verkappter Ragtime glattes "Stargazer"-Imitat, ein letzter, gar nicht trauriger Gruß von der Tin Pan Alley.
"12 Songs" also. Man kann nicht alle aufzählen, denn der Titel lügt sowieso: Die in der kommenden Woche endlich auch in Deutschland erscheinende CD-Version, der das Vinyl hoffentlich auf dem Fuße folgt, hat vierzehn, von denen der eine Bonustrack den besten Song, nämlich "Delirious Love", noch einmal in einer anderen Version präsentiert, und zwar mit Brian Wilson im Hintergrund. Der Beach Boy von der Westküste und der New Yorker - geht das zusammen? Besser, als man annehmen sollte. Sofort dringt der alte Ost-/Westküsten-Antagonismus ans Ohr, den Diamond einst in seinem wohl größten Song, "I Am . . . I Said" verhandelte: "L.A.'s fine, the sun shines most the time / And the feeling is ,lay back' / Palm trees grow, and rents are low / But you know I keep thinkin' about / Making my way back / Well I'm New York City born and raised / But nowadays, I'm lost between two shores / L.A.'s fine, but it ain't home / New York's home, but it ain't mine no more." Neil Diamond, dieser wunderliche Wanderer zwischen den Küsten, ist mit seinen "12 Songs" dort angekommen, wo er hingehört: ganz bei sich. Er konnte aber auch nicht viel falsch machen.
EDO REENTS
Neil Diamond, 12 Songs. American Recordings/Columbia 676131 (Sony/BMG)
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main